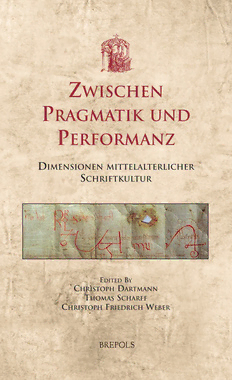Table Of ContentZWISCHEN PRAGMATIK UND PERFORMANZ
UTRECHT STUDIES IN MEDIEVAL LITERACY
18
UTRECHT STUDIES IN MEDIEVAL LITERACY
General Editor
Marco Mostert (University of Utrecht)
Editorial Board
Gerd Althoff (Westfälische-Wilhelms-Universität Münster)
Michael Clanchy (University of London)
Peter Gumbert (University of Leiden)
Mayke de Jong (University of Utrecht)
Rosamond McKitterick (University of Cambridge)
Arpád Orbán (University of Utrecht)
Armando Petrucci (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Richard H. Rouse (UCLA)
ZWISCHEN PRAGMATIK
UND PERFORMANZ
D
IMENSIONEN MITTELALTERLICHER
S
CHRIFTKULTUR
herausgegeben von
Christoph Dartmann – Thomas Scharff
Christoph Friedrich Weber
H
F
British Library Cataloguing in Publication Data
Zwischen Pragmatik und Performanz: Dimensionen
mittelalterlicher Schriftkultur. – (Utrecht studies in
medieval literacy ; v. 18)
1. Written Communication – Europe – History – To 1500 –
Congresses. 2. Communication in politics – Europe –
History – To 1500 – Congresses. 3. Literacy – Europe –
History – To 1500 – Congresses.
I. Series II. Dartmann, Christoph. III. Scharff, Thomas,
1963- IV. Weber, Christoph Friedrich.
302.2'244'094'0902-dc22
ISBN-13: 9782503541372
© 2011 – Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without the prior permission of the publisher.
D/2011/0095/68
ISBN-13: 978-2-503-54137-2
Printed on acid-free paper
Inhalt
Vorwort
DIE HERAUSGEBER vii
Zur Einführung: Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur
zwischen Pragmatik und Performanz
CHRISTOPH DARTMANN 1
Writing Power in the Ninth Century
JANET L. NELSON 25
Anstrengungen des Erinnerns: Montecassino nach der
‘Zweiten Zerstörung’ 883
WALTER POHL 39
Charles le Chauve, Bérenger, Hugues de Provence: Action politique et
production documentaire dans les diplômes à destination de l’Italie
FRANÇOIS BOUGARD 57
Memoria, Schriftlichkeit, symbolische Kommunikation: Zur
Neubewertung des 10. Jahrhunderts
GERD ALTHOFF 85
Getting Justice in Twelfth-Century Rome
CHRIS WICKHAM 103
La riscrittura dei diritti nel secolo XII: Astrazione e finzione nelle
sentenze consolari
MASSIMO VALLERANI 133
Petrus Abaelardus als Kronzeuge der ‘Individualität’ im 12. Jahrhundert?
Einige Fragen
FRANZ-JOSEF ARLINGHAUS 165
The Efficacy of Signs and the Matter of Authenticity
in Canon Law (800-1250)
BRIGITTE MIRIAM BEDOS-REZAK 199
vi Inhalt
L’oratoria politica comunale e i “laici rudes et modice literati”
ENRICO ARTIFONI 237
Podestà verweigert die Annahme: Gescheiterte Präsentationen von
Schriftstücken im kommunalen Italien der Stauferzeit
CHRISTOPH FRIEDRICH WEBER 263
Before the Buongoverno: The Medieval Painting of Brescia’s Broletto
as Visual Register
GIULIANO MILANI 319
Pragmatik und Symbolik: Formen und Funktionen von Schriftlichkeit
im Umfeld des Braunschweiger Rates um 1400
THOMAS SCHARFF 351
Urkunden im Reagenzglas: Altersbestimmungen und Schriftlichkeit
ROGER SABLONIER † 371
Pragmatische Schriftlichkeit und Macht: Methodische und inhaltliche
Annäherungen an Herstellung und Gebrauch von Protokollen auf
politischen Treffen im Spätmittelalter
MICHAEL JUCKER 405
Beatus Vir: Herrschaftsrepräsentation durch Handschriftenpolitik bei
Karl V. von Frankreich
MARTIN KINTZINGER 443
Die Ethik politischer Kommunikation im franko-burgundischen
Spätmittelalter
PETRA SCHULTE 461
Vorwort
Der vorliegende Band dokumentiert die Erträge einer Tagung zu
mittelalterlichen Schriftkulturen, die vom 2. bis 4. Mai 2007 in Münster
anlässlich des siebzigsten Geburtstags von Hagen Keller stattgefunden
hat. Dieses Treffen war dem Ziel verpflichtet, die Ansätze und Ergebnisse
zweier langjähriger Forschungsprojekte zu diskutieren, die unter der Leitung
des Jubilars den pragmatischen Dimensionen mittelalterlicher Schriftlichkeit
sowie den Interferenzen zwischen Schrift und symbolischer Kommunikation
gewidmet waren. Daher haben wir internationale Spezialisten eingeladen, sich
mit dem aktuellen Stand der Debatten um Schriftlichkeit und Kommunikation
im Mittelalter zu befassen. Uns erscheint es angemessen, wenn die Erträge
dieser Initiative nicht in die Form einer Festschrift gebracht werden, sondern
als themenbezogener Sammelband erscheinen. Das entspricht dem kollegialen
und konzeptionell ausgerichteten Arbeitsstil Hagen Kellers, den nicht zuletzt
wir Herausgeber als Mitarbeiter in den genannten Forschungsprojekten kennen
gelernt haben.
Die Realisierung einer internationalen Tagung und der Publikation ihrer
Ergebnisse kann nur mit breiter Unterstützung gelingen. Unser Dank gilt
selbstverständlich zuerst den Referentinnen und Referenten, die nicht nur zum
Teil weite Reisen und die Mühen einer mehrsprachigen Tagung auf sich
genommen, sondern uns auch ihre Texte zuverlässig zur Verfügung gestellt
haben. Dass Roger Sablonier das Erscheinen des Tagungsbandes nicht mehr
erlebt, erfüllt uns mit Trauer. Wir erinnern uns an ihn als ebenso anregenden
wie angenehmen Gesprächspartner. Michael Mente hat uns bei der Redaktion
seines Beitrags freundlicherweise unterstützt. Der Sonderforschungsbereich
496 ‘Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom
Mittelalter bis zur Französischen Revolution’ hat uns alle nötigen finanziellen
Mittel und viel hilfreiche Unterstützung zur Verfügung gestellt, wofür wir vor
viii Vorwort
allem seinen Sprechern Gerd Althoff und Barbara Stollberg-Rilinger danken.
Maria Hillebrandt hat sich erneut als ebenso verlässliche wie geduldige
Ansprechpartnerin für die zahllosen kleinen und großen Fragen erwiesen, die
sich im Umfeld von Tagung und Publikation ergaben. Wenn wir die Tagung in
guter Erinnerung haben, liegt das nicht zuletzt an der engagierten Mithilfe von
Johanna Kasch, Kathrin Nieder und Franz Strukamp, die uns jede Sorge um
organisatorische Pannen genommen haben. Während der redaktionellen Phase
des Bandes konnten wir uns auf die Mitwirkung von Agnes Weichselgärtner,
Julia Bröcker, Rieke Buntemeyer und Benjamin Wolf verlassen. Es war abseh-
bar, dass es nicht ganz einfach sein würde, einen Verlag zu finden, der einen
viersprachigen Sammelband veröffentlicht. Deswegen haben wir uns über die
prompte Zusage Marco Mosterts gefreut, das Buch in die Utrecht Studies in
Medieval Literacy aufzunehmen. Dass sich unsere Publikation so auch in eine
Reihe von Beiträgen einfügt, die die internationale Diskussion über mittelalter-
liche Schriftkultur wesentlich geprägt haben und prägen, erachten wir als einen
zusätzlichen Gewinn. Allen genannten gilt unser Dank für die ebenso effiziente
wie angenehme Kooperation.
Münster und Braunschweig Die Herausgeber
Zur Einführung:
Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur
zwischen Pragmatik und Performanz
CHRISTOPH DARTMANN
Der Diener des Grafen Almaviva kam gerade an seinem Hochzeitstag in
die Bredouille. Just zu dem Zeitpunkt, als er Susanna, die Zofe der
Gräfin, heiraten wollte, tauchte mit Marcellina eine alte Bekannte von
ihm auf. Sie gehörte zu der Kategorie unerwarteter Hochzeitsgäste, auf deren
Besuch man lieber verzichtet hätte, denn vor Jahren hatte sich der Bräutigam
auf einen Handel eingelassen, der ihm jetzt zum Verhängnis zu werden drohte.
Mit einem schriftlichen Vertrag hatte er von Marcellina einen nicht unerhebli-
chen Geldbetrag geliehen und als Sicherheit ein Eheversprechen abgegeben.
Als diese nun wegen ausbleibender Rückzahlung der Schulden die Einhaltung
des Versprechens forderte, drohte für Figaro eine Welt zusammenzubrechen:
Der zuständige Gerichtsherr, der Graf Almaviva, ließ sich den Vertrag vorle-
sen, und weil zusätzlich ein Zeuge von bekannt gutem Ruf bereitstand, der die
Gültigkeit des Vertrags bestätigte, fällte er das Urteil, sein Diener müsse zahlen
oder statt seiner auserwählten Susanna die etwas betagte Marcellina heiraten
(Mozart, Le nozze di Figaro, Akt 2, Szene 11). Die Appellation des Dieners an
seinen Herrn nutzte nichts, kurz hieß es: “È giusta la sentenza – o pagar, o
sposar” (ebd. 3,5). Da spielte es keine Rolle, welche Hintergedanken den Gra-
fen zu seinem Urteil geführt hatten, obwohl sein allzu ausgeprägtes Wohlwol-
len für die Zofe seiner Gattin bei Hofe bekannt war – erst ein typischer Thea-
terzufall konnte Figaro retten. Eine Körpermarkierung auf dem rechten Arm
2 CHRISTOPH DARTMANN
diente als Beweis dafür, dass er das als Säugling geraubte Kind adeliger Eltern
war, und ausgerechnet Marcellina gab sich als seine Mutter zu erkennen (ebd.).
Zieht man die Handlungsmomente ab, die dem Genre des Opernlibrettos
geschuldet sind, bietet diese Episode aus Mozarts Le nozze di Figaro einige
typische Züge der vormodernen Schriftkultur. Grundsätzlich war der Umgang
mit schriftlichen Aufzeichnungen seit dem europäischen Hochmittelalter in
zahlreichen gesellschaftlichen Zusammenhängen zur Routine geworden. Man
war es gewohnt, Erinnernswertes aufzuschreiben, um Informationen unabhän-
gig von der Verformungskraft des individuellen oder kollektiven Gedächtnisses
zuverlässig zu speichern. Diese konnten dann in einer gänzlich gewandelten
Situation erneut aufgerufen werden, je nach Perspektive wurde das zum Segen
oder zum Fluch für die Akteure. Vor allem die vormoderne Rechtskultur, die
Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte persifliert, ist in Italien und einigen an-
deren Ländern bereits seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert, in Deutschland
spätestens seit dem ausgehenden Spätmittelalter nicht mehr ohne den Rekurs
auf Geschriebenes – auf Gesetze, Urkunden, Akten – vorstellbar. Dies führte
jedoch vor allem in überschaubaren politischen und sozialen Formationen nicht
dazu, dass körpergebundene, direkte Interaktion vollständig entwertet worden
wäre zugunsten einer reinen Aktenwirklichkeit. Vielmehr war die Entstehung
wie die Wiederverwendung von Schriftstücken grundsätzlich an die direkte
Begegnung der Akteure gebunden. Dabei konnte es sich um typische Situatio-
nen mit erwartbaren Abläufen handeln, wenn etwa ein Vertrag erst vor einer
größeren Zeugenschaft abgeschlossen, dann das Dokument angefertigt wurde,
noch einmal zu Gehör gebracht und von den Umstehenden bestätigt werden
musste, ehe es Rechtskraft beanspruchen konnte. Überraschender für den
modernen Betrachter ist es aber, wenn der vermeintlich eindeutige Inhalt einer
Urkunde in der Wiederverwendungssituation kaum eine Rolle spielt, wenn er
nach unserem Verständnis grob missdeutet oder schlicht übergangen wird.
Offensichtlich konnte entweder das Verständnis des Wortlauts oder seine
Adaptation an eine konkrete Situation zu sehr viel kreativeren Resultaten füh-
ren, als man dies für die Moderne gemeinhin annimmt. Umgekehrt kann auch,
wie im Falle Figaros, die strenge Orientierung am Wortlaut in Zusammenhänge
führen, die in unserem Selbstverständnis kaum tolerierbar erscheinen, wenn der
Graf ein Urteil fällt, das vor allem deswegen zuungunsten Figaros gesprochen
wird, weil der Richter dadurch seine Chancen bei der Braut des Verurteilten zu
verbessern meint.