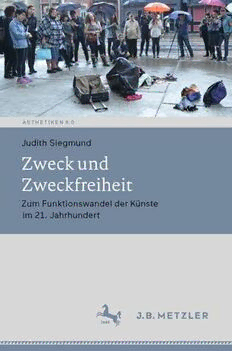Table Of ContentÄSTHETIKEN X.0
Judith Siegmund
Zweck und
Zweckfreiheit
Zum Funktionswandel der Künste
im 21. Jahrhundert
Ästhetiken X.0 – Zeitgenössische
Konturen ästhetischen Denkens
Reihe herausgegeben von
Judith Siegmund, Stuttgart, Deutschland
Michaela Ott, Hamburg, Deutschland
Christian Grüny, Witten, Deutschland
Wissenschaftlicher Beirat:
Eva Schürmann, Magdeburg, Deutschland
Daniel M. Feige, Stuttgart, Deutschland
Rachel Zuckert, Chicago, USA
Douglas Barrett, New York, USA
Die Reihe Ästhetiken X.0 folgt einem Verständnis von Kunstphilosophie und phi-
losophischer Ästhetik, das auf Sachhaltigkeit und historische Konkretheit setzt.
Danach sind philosophische Reflexion, wissenschaftliche Auseinandersetzung und
kulturelle Situiertheit aufeinander verwiesen und sollten den Entwicklungen der
ästhetischen Praxis in den verschiedenen künstlerischen Feldern, aber auch jenseits
dieser Rechnung tragen. Ohne auf eine bestimmte theoretische Position festgelegt
zu sein, bringt die Reihe Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen und Feldern
zur Artikulation, die für die Gegenwart symptomatisch und wegweisend erschei-
nen. Dabei ist die Frage ausschlaggebend, was ästhetische Praxis heute bedeutet, in
welchen (De)Form(ation)en sie stattfindet und welche gesellschaftlich-symbolische
Position sie bezieht. Dazu gehört die Reflexion der Ästhetik als westlich-bürgerli-
che Emanzipationswissenschaft und normsetzend-universalisierende Disziplin.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/16310
Judith Siegmund
Zweck und Zweckfreiheit
Zum Funktionswandel der Künste
im 21. Jahrhundert
Judith Siegmund
HMDK Stuttgart
Stuttgart, Deutschland
ISSN 2662-1398 ISSN 2662-1401 (electronic)
Ästhetiken X.0 – Zeitgenössische Konturen ästhetischen Denkens
ISBN 978-3-476-04804-2 ISBN 978-3-476-04805-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-476-04805-9
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
J.B. Metzler
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in
diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung
zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die
Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch
die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des
Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen
und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Einbandgestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart (Foto: Henry Chan © Tanja Ostojić; Foto der Perfor-
mance „Misplaced Women? Dedicated to the Missing and Murdered Indigenous Women in Canada“,
Toronto 2016)
J.B. Metzler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil
von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
Für Mojca
Inhaltsverzeichnis
1 Funktionswandel der Künste als Herausforderung für die
ästhetische und soziologische Theorie ........................... 1
1.1 Tendenzen der Integration der Künste ins Gesellschaftliche –
das Selbstverständnis der Akteure ........................... 2
1.1.1 Die Künste und das Politische ........................ 4
1.1.2 Social Arts und Partizipative Kunst .................... 9
1.1.3 Künste als Bildung, Künste als Vermittlung ............. 13
1.1.4 Der kreative Imperativ – innerhalb und außerhalb
der Künste ....................................... 15
1.1.5 Kunst als gesellschaftliche Arbeit ..................... 18
1.1.6 Kunst als Wissensproduktion ......................... 22
1.2 Funktionsbegriff und Gesellschaftsbegriff in der Soziologie ...... 26
1.2.1 Niklas Luhmann – Differenz von Funktion
und Leistung ...................................... 28
1.2.2 Ein anderer Funktionsbegriff in einer veränderten
Gesellschaft ...................................... 31
1.2.3 Von den Funktionen der Künste in der Gesellschaft ....... 35
1.3 Kunst und Design im Wechselverhältnis von Funktionalität
und Nichtfunktionalität ................................... 36
1.3.1 Die Entstehung des Funktionalismus als Stilbegriff
sowie der Begriff der Funktionalität des Designs zur
Abgrenzung vom Nichtfunktionalen der Kunst ........... 37
1.3.2 Design als Gestaltungsprozess – ein alternativer
Denkansatz ....................................... 42
1.4 Was ist ein gesellschaftlicher Funktionswandel der
Künste in der ästhetischen Theorie? ......................... 47
VII
VIII Inhaltsverzeichnis
2 Über Autonomie und Zweckfreiheit der Kunst in der
Geschichte der ästhetischen Theorie der Moderne ................ 49
2.1 Kant-Rezeptionen der Kunstphilosophie seit Adorno ............ 50
2.2 Die Zuspitzung des Autonomiegedankens bis zum
Dogma der Zweckfreiheit der Kunst ......................... 55
2.2.1 Ein Versuch, die autonome Kunst mit ihrer
gesellschaftlichen Funktionslosigkeit zu
versöhnen (Peter Bürger) ............................ 58
2.2.2 Die Inanspruchnahme der Autonomie der Kunst
im Kalten Krieg ................................... 64
2.2.3 Kritik der zweckfreien Kunst ......................... 69
3 Zweck – Zur Geschichte des philosophischen Begriffs ............. 71
3.1 Zweck als Ursache eines teleologischen Bewegungsprinzips
(Aristoteles) ............................................ 72
3.1.1 Differenzen und Gemeinsamkeiten bei Platon
und Aristoteles .................................... 72
3.1.2 Der Zweck im künstlerischen Tun und das zweite
poietische Regime bei Jacques Rancière ................ 77
3.2 Zweckmäßigkeit als subjektive Unterstellung .................. 82
3.2.1 Über die Annahme einer Zweckmäßigkeit als
Ordnungsunterstellung an die Natur – die
Teleologie in der Kritik der Urteilskraft ................ 84
3.2.2 Zweckmäßigkeit in der Wahrnehmung der
schönen Form – aber ohne Zweck ..................... 91
3.2.3 Die ästhetischen Ideen des Genies als naturgegebener
Zweck der Erkenntnis .............................. 99
3.3 Zweck des Handelns und Zweck des Herstellens
(zwei Aristoteles-Lesarten: Thomas von Aquin
und Hannah Arendt) ...................................... 106
3.3.1 Zweck im zielgerichteten Handeln bei
Thomas von Aquin ................................. 107
3.3.2 Die Zweck-Mittel-Relation in Hannah Arendts
Begriff des Herstellens .............................. 110
3.3.3 Handeln als selbstzweckhafte Praxis – Hannah
Arendts Handlungsbegriff ........................... 116
3.3.4 Mit Homo faber siegt die instrumentale Verfolgung
von Zwecken – Arendts Analyse der Neuzeit ............ 124
3.4 Vom idealtypischen zweckrationalen Handeln (Max Weber) ...... 127
3.4.1 Die Einbettung des Begriffs Zweckrationalität in
Webers Konzept einer verstehenden Soziologie .......... 128
3.4.2 Die theoriegeschichtliche Subjektivierung und
gleichzeitige Radikalisierung des Zweckbegriffs ......... 131
Inhaltsverzeichnis IX
3.5 Innere Zwecke und die Sozialität des künstlerischen
Handelns (John Dewey) ................................... 133
3.5.1 Die Denkfigur des menschlichen Handelns und
ihre erkenntnistheoretischen und anthropologischen
Grundbestimmungen ............................... 135
3.5.2 Kunst als ein Umgehen mit Mittel-Zweck-Mittel-
Relationen – ein Prototyp für sinnerfülltes Handeln ....... 143
3.5.3 Künstlerische Zweck-Mittel-Konstellationen in
Deweys Demokratietheorie und seiner Pädagogik ........ 154
4 Eine nicht (nur) rationale Gesellschaft .......................... 163
4.1 Kritik der Zweckrationalität als Gesellschaftsbestimmung ........ 164
4.2 Gesellschaftliche Entgrenzungen von Selbstdarstellung
als ästhetische Form ...................................... 167
4.3 Digitalisierung .......................................... 171
5 Zwecke von Künsten – eine teleologische Perspektive? ............. 175
5.1 Zum Verhältnis von ästhetischer Theorie und
Gesellschaft heute ....................................... 177
5.2 Der Zweckbegriff und die Künste ........................... 180
5.3 Kunst als Handlung ...................................... 184
5.4 Die Unterscheidung der Begriffe Nutzen,
Instrumentalisierung, Funktion und Zweck
in der ästhetischen Theorie der Künste heute .................. 186
Literatur ...................................................... 195
Einleitung
„Jedes Kunstwerk ist in einem gewissen Sinn ‚die Welt noch einmal‘, nämlich: die
Welt gereinigt von den unmittelbaren Zwecken […].“1 Dass der ‚Zweck‘ etwas
ist, von dem das Kunstwerk ‚gereinigt‘ werden muss, ist nicht untypisch für die
Kunstphilosophie des 20. Jahrhunderts. Man könnte eventuell so weit gehen zu
sagen, dass hier ein Mythos entstanden ist: ein Mythos von einer Kunst bzw. von
Künsten, die konträr zu einer von Zwecken regierten Welt stehen. Dieser Narration
möchte ich in dem Buch nachgehen, sie zerlegen und neu zusammensetzen. Dabei
geht es nicht allein um die Künste, ihr Verhältnis zu angrenzenden Bereichen und
ihre Funktion in der Gesellschaft. Ein Teil meiner Überlegungen handelt davon,
dass die Rede von Zwecken und ihrer rationalen Verfolgung eine unterkomplexe
Beschreibung der Gesellschaften ist, in denen wir heute leben. In Zeiten der Digi-
talisierung, eines ästhetisierten Lifestyles und eines kreativen Imperativs, der sich
an die meisten richtet, wäre es nicht nur unangemessen, die Praxis der Künste
einfach einer ‚draußen‘ herrschenden Zweckrationalität gegenüberzustellen, son-
dern das kausale Zweck-Mittel-Modell in seinen simpleren Varianten genügt
auch nicht mehr, um das allgemeine Gesellschaftliche, also das ‚Draußen‘ richtig
zu beschreiben. So sind beide Seiten in Bewegung geraten – diese Einsicht stellt
einen zeitdiagnostischen Anspruch des folgenden Textes dar.
Meine ausführliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des philosophi-
schen Zweckbegriffs verstehe ich als den Vorgang einer Materialhebung für den
ästhetischen Diskurs. So ist das Kapitel zur Geschichte des Begriffs als eine Art
Fundgrube zu denken, in der viele Möglichkeiten des Weiterdenkens schlummern
und aus der ich längst nicht alle Impulse für meine eigene Theoriebildung nutzen
konnte. Vermitteln möchte ich, dass es sich lohnt, handlungstheoretisch sowie aus
einer teleologischen Perspektive an kunstphilosophische Fragestellungen heranzu-
gehen. Die Theorie der Zwecke von Künsten, mit der ich ende, erscheint daher
einstweilen nur in Umrissen, sie konnte hier noch nicht genauer ausgearbeitet wer-
den. Das hängt auch damit zusammen, dass die Stunden konzentrierter Schreibar-
beit für Professor*innen dermaßen gezählt sind, dass eine präzisere Ausarbeitung
des Themas weitere Jahre dauern würde.
1Theodor W. Adorno: Ästhetik (1958/59), hg. von Eberhard Ortland, Berlin 2017, S. 77.
XI