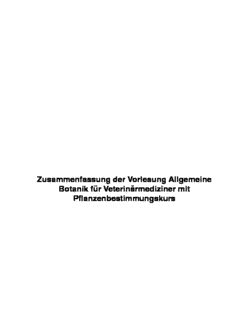Table Of ContentZusammenfassung der Vorlesung Allgemeine
Botanik fu¨r Veterina¨rmediziner mit
Pflanzenbestimmungskurs
INHALTSVERZEICHNIS 2
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines 5
1.1 WasistBotanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Botanikunddieu¨brigenTeilgebieteder Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Betrachtungsebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 AbgrenzungderBiologie/Botanikgegenu¨berderPhysikundderChemie . . . . 6
1.5 EigenschaftenderlebendigenSysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.1 Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.2 Erna¨hrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5.3 Wachstum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.4 Mutabilita¨t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 WasisteinePflanze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.7 EinflußderUmweltaufdiePflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8 ZusammenlebenvonOrganismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.1 Parasitismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.2 Commensalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8.3 Symbiose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.8.4 Saprophytismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.9 EntwicklungdespflanzlichenLebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.10 GrenzendesLebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.10.1 VerbreitungsgrenzendesLebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.10.2 Gro¨ßteundkleinsteLebensformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Cytologie 14
2.1 Organisationsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1 Prokaryoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Eukaryoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.3 VorkommenvonPro-undEukaryoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Generationswechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1 GenerationswechselbeidenPflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 U¨bergangzurterrestrischenLebensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 DieBestandteilederpflanzlichenZelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.1 DieZellwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4.2 DiePlasmalemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4.3 Plasmodesmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.4 Nucleus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.5 CytoplasmaundNucleoplasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.6 Cytoskelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.7 Plastiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.8 Mitochondrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.9 Geißeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.10 Olesomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
INHALTSVERZEICHNIS 3
2.4.11 Ribosomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.12 Kompartimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.13 Membranfluß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.14 Endoplasmaretikulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.15 Golgiapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.16 Vakuole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.17 Lysosomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 U¨bersichtu¨berdasPflanzenreich 27
3.1 Bakterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.1 AutotropheBakterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Symbiosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Cyanophyta,Blaualgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4 Gru¨ne,landlebendePflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.1 Moose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.2 Farne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4.3 Samenpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4 Pflanzenphysiologie 44
4.1 Erna¨hrungderPflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1.1 Wasserhaushalt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.1.2 Photosynthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.3 Chemoautotrophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.1.4 Sta¨rkeabbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.1.5 O¨le,Fette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1.6 Stickstoffassimilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Sekunda¨reStoffwechselprodukte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.1 Pflanzengifte,-toxineundRauschmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.2 PflanzlicheMedikamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3 Entwicklungsphysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3.1 EntstehungvonTumorenbeiPflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3.2 DasPflanzengenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.3 Pflanzenhormone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3.4 ExterneFaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 GiftundHeilpflanzen 65
5.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.1 Bla¨tter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.2 Blu¨tensta¨nde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.1.3 Kra¨uter, Stauden,Stra¨ucherundBa¨ume . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Rosaceae,Rosengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.3 Brassicaceae,Kreuzblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.4 Ranuculaceae,Hahnenfußgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
INHALTSVERZEICHNIS 4
5.5 Lamiaceae,Lippenblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.6 Fabaceae,Schmetterlingsblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.7 Papaveraceae,Mohngewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.8 Rubiaceae,Ro¨tegewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.9 Caryophyllaceae,Nelkengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.10 Liliaceae,Liliengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.11 Asteraceae,Korbblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.11.1 Asteraceaei.e.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.12 Poaceae,Su¨ßgra¨ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.13 Apiaceae(Umbelliferae),Doldenblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.14 Caprifoliaceae,Geißblattgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.15 Boraginaceae,Rauhblattgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.16 Fumariaceae,Erdrauchgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.17 Solanaceae,Nachtschattengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.18 Polygonaceae,Kno¨terichgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.19 Euphorbiaceae,Wolfsmilchgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.20 Scrophulariaceae,Rachenblu¨tler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.21 Valerianaceae,Baldriangewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.22 Juncaceae,Binsengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.22.1 Juncus,Binse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.22.2 Luzula,Simse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.23 Cuperaceae,Sauergra¨ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.24 Equisetaceae,Schachtelhalmgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.25 Cucurbiaceae,Ku¨rbisgewa¨chse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.26 Hypericaceae,Hartheugewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.27 Pinaceae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.27.1 Pinus,Kiefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.27.2 Picea,Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.27.3 Abies,Tanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.28 Taxaceae,Eibengewa¨chse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.29 Cupressaceae,Zypressengewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.30 Apocyanaceae,Hundsgiftgewa¨chse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1 ALLGEMEINES 5
1 Allgemeines
gelesenvonProf.Dr.Ringe
1.1 Was ist Botanik
Theophras: Heilkra¨uterkunde,wurdevonDioskoridesinsLateinischeu¨bersetzt.
Hildegard von Bingen setzte die Botanik in Form der Heilkra¨uter-
kundefort
Philosophie: Auch die Philosophie hatte Einflu¨sse Auch die Philosophie hatte
Einflu¨sse auf die BotanikaAuch die Philosophiehatte Einflu¨sse auf
die BotanikuAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die Botanikf
AucAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die BotanikAuch die
Philosophie hatte Einflu¨sse auf die BotanikAuch die Philosophie
hatteEinflu¨sseaufdieBotanikAuchdiePhilosophiehatteEinflu¨sse
auf die BotanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die Bo-
tanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die Botanikh Auch
diePhilosophiehatteEinflu¨sseaufdieBotanikAuchdiePhilosophie
hatteEinflu¨sseaufdieBotanikAuchdiePhilosophiehatteEinflu¨sse
auf die BotanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die Bota-
nikdAuchdiePhilosophiehatteEinflu¨sseaufdieBotanikiePhiloso-
phiehatteEinflu¨sseaufdieBotanikAuchdiePhilosophiehatteEin-
flu¨sse auf die BotanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die
BotanikdAuchdiePhilosophiehatteEinflu¨sseaufdieBotanikAuch
die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die BotanikAuch die Philoso-
phie hatte Einflu¨sse auf die Botanikie Auch die Philosophie hatte
Einflu¨sse auf die BotanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf
die BotanikAuch die Philosophie hatte Einflu¨sse auf die Botanik-
Botanik
Biologie: Selbstversta¨ndlich hatte die Biologie einen starken Einfluß auf die
Botanik
(cid:0)
BotanikistgenauergesagtPhytologie,wassovielheißtsie“Pflanzenwissenschaft”
1.2 Botanik und die u¨brigen Teilgebiete der Biologie
Biologie=dasGesamtwissenvomLeben.Siekannwiefolgtgegliedertwerden
1. Botanik
1 ALLGEMEINES 6
(a) Morphologie:WiesinddiePflanzenaufgebaut?
(b) Physiologie:Wiefunktioniertder StoffwechselderPflanzen?
(c) O¨kologie:WiesiehtdieInteraktionzwischendenverschiedenPflanzenkulturenaus?
2. Zoologie
3. Anthropologie
4. Genetik:Istauf Mendelbegru¨ndet
5. Mikrobiologie:IstaufPasteurbegru¨ndet
1.3 Betrachtungsebenen
Wie in der Biologie so werden auch speziell in der Botanik verschiedene Betrachtungsebenen
verwendetumdieForschungtransparenterzugestalten.Sowurdebei1.2schonmaldieUnter-
teilungderBotanikinMorphologie,PhysiologieundO¨kologieaufgefu¨hrt.Weiterhinkannman
aberauchnochdieEbenen
(cid:1)
Population: z.B. Untersuchung des Verha¨ltnisses zwischen einer Population und ihrer
Umwelt,wiebeeinflußensichbeidegegenseitig
(cid:1)
Individuum(cid:2) Population
(cid:1)
Gewebe:UntersuchungvonOrganen,Individuum
(cid:1)
Zellen:UntersuchungderverschiedenenZelltypenundihrerOrganisationsformen
(cid:1)
Moleku¨le (cid:3) Molekularbiologie
1.4 AbgrenzungderBiologie/Botanikgegenu¨berderPhysikundderChe-
mie
Die Zelle ist die kleinste Lebenseinheit!
Die Einteilung der naturwissenschaftlichen Disziplinen richtet sich an der Organisationsform
derMaterieaus:
geistigesSein Mensch
animalesSein Tier/Tierreich(cid:3) Zoologie
vegetarischesSein Pflanzenwelt(cid:3) Botanik
anorganischesSein Stoffwelt(cid:3) PhysikundChemie
1 ALLGEMEINES 7
1.5 Eigenschaften der lebendigen Systeme
(cid:1)
morphologische
– Individuum(Gestalt,Struktur)
(cid:1)
stoffliche
– spezifischeZusammensetzung(Nukleinsa¨ure,Proteine,Kohlenhydrate,Polysaccha-
ride,Lipide)
(cid:1)
dynamische
– Bewegung
(cid:4)
Dinese
(cid:4)
Tropie
(cid:4)
Taxie
(cid:4)
Nastie
– Reizbarkeit
– Stoffwechsel
– Wachstum
– Fortpflanzung
– Vermehrung
– Vererbung
– Mutabilita¨t(Evolution)
1.5.1 Bewegung
Plasmabewegung = Dinese. Sie tritt in den Formen Photo-, Chemo- und Traumato-
dinese(durch Verwundung hervorgerufen) auf. Erkennen kann man
dieDinesedadurch,daßmit demPlasmaauch diedarinenthaltenen
“Plasmide” und Mitochondrien mitbewegt werden . Aber der Zell-
kern(undandereStrukturen)ko¨nnenauchaktivbewegtwerden.
Gel
Sol
Vakuole
1 ALLGEMEINES 8
Tropie: Bewegung eines Organs auf einen Reiz hin. Dies kann zum Bei-
spiel Phototropismus sein. Man spricht von positiven Phototropis-
mus wenndiePflanzesichzumLichthin neigt.NegativerPhototro-
pismusistfolglichwennsichdiePflanzevomLichtwegneigt.
Eine andere Form des Tropismus ist der Geotropismus, welcher als
bestimmendenReiz die Schwerkraft besitzt. So ist die Vorzugsrich-
tung der Sproßachse entgegen der Schwerkraft, na¨mlich nach oben,
diederWurzelnabermitderSchwerkraft,alsonachunten.
FreieOrtsbewegung: = Taxie. Hierzu sei als Beispiel die Chemotaxie genannt, bei der
sich ein Organismus in Richtung des fu¨r in optimalen chemischen
Milieusbewegt.
Nastie: Die Nastie ist eine Bewegung eines Organes einer Pflanze, bei der
aber die Richtung des Reizes und die Richtung der Bewegung von-
einander unabha¨ngig sind. Hierzu za¨hlt der Spiralwuchs der Bohne,
aberauchdasO¨ffnen,bzw.dasschließenderBlu¨ten.MankannPho-
tonastieundThermonastieunterscheiden.
Reizbarkeit: Eine Pflanzliche Zelle kann u¨ber einen chemischen Rezeptor einen
Reiz/Signal aufnehmen, diesen Reiz verarbeiten und als Schlußfol-
gerungeineReaktionzeigen.
Reaktion: Der Organismus erzeugt eine Bewegung und bringt die Energie
dazu selber auf
1.5.2 Erna¨hrung
Nahrungsaufnahme: IstdieAufnahmevontoterMaterie((cid:3) autotrophie)
Assimilation: IstderUmbauderNahrungin organgerechteStoffe
Dissimilation: IstderAbbauvonSubstanzenimOrganismus
Makroelemente: Sind die Stoffe die der Organismus zum leben braucht. Dies sind
Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor, Kalium,
Calcium, Magnesium und Eisen1. Aufgenommen werden die Stof-
fe aber meist nicht Elementar sondern in Verbindungen wie (cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:9)(cid:8) ,
(cid:10)(cid:12)(cid:11) (cid:11)
(cid:5)(cid:7)(cid:6)(cid:9)(cid:13)(cid:15)(cid:14) , (cid:8)(cid:15)(cid:6) und (cid:16)(cid:17)(cid:6)(cid:9)(cid:13) .
Mikroelemente: Spurenelemente,Stoffe die nur in geringsten Mengen beno¨tigt wer-
den
1Merke:COHNSeiPfiffigKaufCauMguFeein.
1 ALLGEMEINES 9
1.5.3 Wachstum
WenngenugNahrungvorhandenistkanneszuWachstumkommen.Wachstumbestehtauszwei
Teilvorga¨ngenna¨mlichderZellteilungundderZellstreckung.
EineganzspezielleFormdesWachstumsistdieFortpflanzung/Vermehrung.
1.5.4 Mutabilita¨t
Mutabilita¨tistdieVariabilita¨tdiehervorgerufenwirddurchVererbungaberauchdurchMutati-
on. Durch Selektion und weitere a¨ußere Einflu¨ße kommt es zur Evolution. Erfolg der Evoluti-
on/Mutabilita¨tistdieArtentfaltung.
NurdieSummederKriteriendesLebensmachtdenOrganismusLebensfa¨hig
Nicht Kausalita¨t sondern Finalita¨t(zielgerichtete Entwicklung)
1.6 Was ist eine Pflanze?
DieseFrageistsehrschwierigzuBeantworten,weildieBehauptung,daßallePflanzengru¨nsind
nicht zutrifft(nicht alles was Pflanze ist, ist auch gru¨n). Nicht alle Pflanzen erna¨hren sich rein
autotroph(z.B. parasitierende Pflanzen). Bei Pilzen wird noch heute gera¨tselt ob sie u¨berhaupt
zurBotanikgerechnetwerdensollen.ImfolgendensindeinigeUnterschiedegegenu¨bergestellt
typischePflanze typischesTier
autotropheAssimilation heterotropheAssimilation
Photoautotrophie indirekteEnergiegewinnungdurchNahrung
Chlorophyll keinChlorophyll
ErzeugervonSta¨rkeundGlykogen Verbraucher / Konsument v. Sta¨rke und Glyko-
gen
vertikaleAchsenpolarita¨t horizontaleAchsenpolarita¨t
radia¨rsymmetrisch bilateral
festgewachsen Ortsbewegungmo¨glich
1 ALLGEMEINES 10
- kompakterKo¨rperbau
freinachaußenentwickelteOrgane Organeinnen
OrganeingroßerZahl meistOrganenureinfachoderingeringerAnzahl
Ausfaltung Einfaltung
großea¨ußereAustauschfla¨che großeinnereAustauschfla¨che
Ko¨rperoberfla¨chemaximiert Ko¨rperoberfla¨cheminimiert
unbegrenztesWachstum begrenztesWachstum
(cid:18)(cid:29)(cid:22) (cid:8)
(Ko¨rperoberfla¨che eines Baumes mit Bla¨ttern = Ko¨rperoberfla¨che einesMenschen= (cid:23)(cid:20)(cid:24)(cid:26)(cid:25)(cid:28)(cid:27) ,
(cid:18)(cid:20)(cid:19)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:22) (cid:8) (cid:19) (cid:22) (cid:8)
) a¨ußere Lungenoberfla¨che = (cid:24)(cid:30)(cid:23) , innere Lun-
(cid:19) (cid:19)(cid:20)(cid:22) (cid:8)
genoberfla¨che= (cid:31) (cid:27) (cid:23)(cid:30)!
Wachstum an der Pflanzenspitze und den Wur- geschlossenerOrganismus
zelspitzen(embryonale Zentren = Wachstums-
zentren;bleibeneinganzesLebenlang)" Able-
ger aus embryonalen Zentren; Stecklinge " of-
fenerOrganismus
relativ geringe Spezialisierung der Gewebe und sehrhoheSpezialisierungvonGewebenundOr-
Organe ganen
hoheRegenerationsfa¨higkeit geringeRegenerationsfa¨higkeit,Lebensdauerge-
ring
physiologischeR.: ErneuerungvonZellen
traumatischeR.: Erneuerung von verlet-
zungsbedingt zersto¨rtem
Gewebe
" Neusprossung von geschlagenen Ba¨umen,
zuru¨ckschneiden von Fichtenhecken, Triebbil-
dung eines einzelnen Begonienblattes. Toti-
potenz: Die Zelle entha¨lt alle Erbinformati-
on und kann daher wieder andere Aufgaben
erfu¨llen(Bsp.: Einzelne Zelle einer Ru¨be kann
wiederwieEizellefunktionierenundeineganze
Pflanzebilden
Warum die Einteilung von Pflanze und Tier so schwierig ist soll hier noch kurz an einigen
Beispielenerla¨utertwerden.Beispiel:Euglena[gracilis].DieserOrganismusbesitztpflanzliche
und tierische Karakterzu¨ge. Seine Erna¨hrung erfolgt mixotroph, das heißt er kann sich je nach
a¨ußerenBedingungensowohlheterotrophalsauchautotropherna¨hren.
Description:Die Schwerkraft hat auch Einflüsse auf die Pflanze(siehe Geotropie) Paracelsus: “Vitalkräfte beflügeln die Materie und erwecken sie zum Leben”. ¡ Pasteur: als t¶ = Phytochrom rot und t Ü ¶ = Phytochrom “far red” = dunkelrot. Beide sind im Internet für Linux-Plattformen mit X-Windo