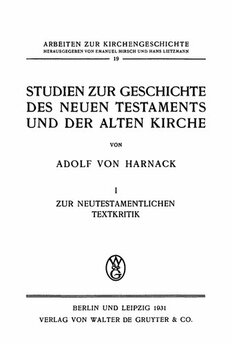Table Of ContentARBEITEN ZUR KIRCHENGESCHICHTE
HERAUSGEGEBEN VON EMANUEL HIRSCH UND HANS LIETZMANN
19
STUDIEN ZUR GESCHICHTE
DES NEUEN TESTAMENTS
UND DER ALTEN KIRCHE
VON
ADOLF VON HARNACK
I
ZUR NEUTESTAMENTLICHEN
TEXTKRITIK
BERLIN UND LEIPZIG 1931
VERLAG VON WALTER DE GRUYTER & CO.
Archiv-Nr. 32 02 31
Druck von Walter de Oruyter ft Co., Berlin W
VORWORT
In drei Bänden sollen diese Studien die wichtigsten der
zahlreichen Untersuchungen vereinigen, die Harnack in den
Sitzungsberichten der Preußischen Akademie und in Zeit-
schriften oder Festschriften veröffentlicht hat, und die bisher
in keiner Bibliothek vollständig beisammen waren, auch viel-
fach sogar in den nächsten Fachkreisen unbekannt geblieben
sind. Dieser erste Band vereinigt sämtliche Beiträge zur neu-
testamentlichen Textkritik, die als Aufsätze erschienen sind,
und ermöglicht dadurch zum erstenmal einen vollständigen
Überblick über die Fülle fruchtbarer Gedanken, die der ver-
ewigte Verfasser in die noch immer sehr lebhafte Diskussion
der Probleme hineingetragen hat. Hier erscheint auch zum
erstenmal die 1920 angekündigte Rekonstruktion der griechischen
Vorlage für die Vulgata des Hebräerbriefs.
Die Korrektur des Druckes hat mit unermüdlicher Sorg-
falt eine treue Schülerin Harnacks, Frl. Berta Schulze über-
wacht und dabei auch sämtliche Zitate nachgeprüft. Eine
Umstellung der Zitate auf neuere Ausgaben oder Auflagen
erwies sich als untunlich, da die Argumentation des Verfassers
vielfach eben auf die benutzten Bücher eingestellt ist. Der
Benutzer wolle also daran denken, daß immer nur Texte vor
dem beim Titel genannten Erscheinungsjahr zitiert sein können.
Möge dies Buch dazu beitragen, daß die Harnack so sehr am
Herzen liegenden Probleme der neutestamentlichen Text-
geschichte weiter gefördert werden.
Berlin, am 7. Mai 1931,
am 80. Geburtstag Adolf v. Harnacks
Hans Lietzmann
Inhaltsverzeichnis,
Seite
ι) Das Aposteldekret (Act. 15, 29) und die Blaßsche
Hypothese 1—32
Die Blaßsche Hypothese S. 1. Ein uralter christlicher
Katechismus S. 2—4. Bezeugung der zwei verschiedenen
LAA des Aposteldekrets S. 4 — 7. Zahns Hypothese und
ihre Widerlegung S. 7—8. Textgestalt und Sinn der west-
lichen LA S. 9 —Ii. Hilgenfelds Argumente für den Vorzug
des westlichen Textes S. 11 —14. Ursprünglichkeit des
morgenländischen Textes S. 14 — 17. Zahns Verteidigung
des Dekrets als Dokument des Apostelkonzils S. 18 — 20.
Sinn und Geschichtlichkeit des Dekrets S. 20 — 22. Πορνεία
S. 22 — 23. Act. 21, 25 S. 23 — 24. Ein Erlaß der jerusalemi-
schen Presbyter S. 24—26. Seine Legitimation als apostolisch
S. 26. Seine Herrschaft im Orient S. 27. Motiv zur Korrek-
tur im Abendland S. 27. Ersatz durch einen »apostolischen«
Katechismus S. 27 — 28. Zeit des Korrektors S. 29. Die
Tätigkeit des Korrektors S. 29—32.
2) Uber den ursprünglichen Text Act. Apost. 11, 27. 28. . 33—47
Das »Wir« im westlichen Text S. 33 — 35. Charakter
dieses »Wir« S. 35 — 37. Unmöglichkeit des »Wir« im Kon-
text S. 37 — 38. Vorliebe des Korrektors für Ausmalungen
S. 39—41, für volle Übergänge S. 41—42. Überlieferung
des ήμώυ S. 43. Seine Nichtursprünglichkeit S. 43—46.
Eigentümlichkeiten und Zeit des Korrektors S. 46 — 47.
3) Über die beiden Rezensionen der Geschichte der Prisca
und des Aquila in Act. Apost. 18, 1—27 .... 48 — 61
Widerlegung der Einwände von Blaß S. 48—49. Text
S. 50—51. Versuchte Verbesserungen im westlichen Text
S. 52 — 53. Ehrenvolle Erwähnung der Prisca bei Paulus
und Lukas S. 53 — 56. Zurückdrängung der Prisca im west-
lichen Text S. 56 — 58. Entgegnung auf das Schlußwort
von Blaß S. 58-60.
VI Inhaltsverzeichnis.
Säte
4) Das Magnificat der Elisabet (Luk. 1, 46—55) nebst
einigen Bemerkungen zu Luk. 1 und 2 62—85
Elisabet statt Maria in Luk. 1, 46 S. 62—63. Bezeugung
beider LAA S. 63 — 64. Argumente für »Elisabet« S. 65 — 66.
Spätere Zufügung des Namens S. 66 — 67. Die alttestament-
lichen Grundlagen S. 68 — 69. Versbau S. 69. Anordnung
der Pronomina und Fortschritt des Gedankens S. 70. Be-
arbeitung der Vorlagen S. 71 — 73. Lukanischer Charakter
des Magnificat S. 73 — 75.
Exkurs I: Der lukanische Charakter des Kontextes
S. 75 — 77. Der lukanische Charakter von Luk. 2, 15 — 20
S. 77—78, von Luk. 2, 41 — 52 S. 78 — 79, von Luk. i, 5—15
S. 79-80.
Exkurs II: Vergleich mit dem Benediktus S. 80. Die
Vorlagen des Benediktus und ihre Bearbeitung S. 81—83.
Originalität beider Gesänge S. 84 — 85.
5) Probleme im Texte der Leidensgeschichte Jesu.. . 86—104
I. Zu Luk. 22, 43. 44. S. 86—91 : Überlieferung S. 86
—87. Lukanische Anschauung und Sprache in dem an-
gezweifelten Stück S. 88. Sein Fehlen in Ägypten und
Umgegend seit c. 200. Motive zur Fortlassung S. 89—90.
Umwandlung in Joh. 12, 27fi. S. 90. Echtheit der Worte
S. 91.
II. Zu Luk. 23, 33. 34. S. 91—98: Überlieferung S. 91
—92. Gründe zur Streichung des zweifelhaften Satzes
S. 92. Ihre Widerlegung, besonders der Verweisung auf
Acta 7,60 S. 92 —96. Antijudaismus als mögliches Motiv
zur Streichung S. 96—98. Übertriebenes Vertrauen zu
Cod. Β S. 98.
III. Zu Mark. 15, 34. S. 98—103. ώνείδισας als die
abendländische LA S. 98—99. Ursprünglichkeit des ώνείδισαΐ
S. 99 —100. ώνείδισαΐ als Erleichterung gegenüber έγκατέ-
Xrrres S. 100 —101. Der όνειδισμός τοΰ Χριστού S. ιοί —102.
Beseitigung des ώνείδισας S. 102 — 103. Gebundenheit des
Markus an ein überliefertes Kreuzeswort S. 103.
Dogmatische Korrekturen im Neuen Testament und
Wichtigkeit der abendländischen Überlieferung S. 103 — 104.
6) Zur Textkritik und Christologie der Schriften des Johannes.
Zugleich ein Beitrag zur Würdigung der ältesten
lateinischen Überlieferung und der Vulgata. ... 105 —152
1) Joh. 5, 18. S. 105—115: Zwei verschiedene Aus-
legungen S. X05 —106. Schwierigkeit, 6 γεννη6εΙΐ... auf
ό γεγεννημέυοΐ zu beziehen S. 106—108. Schwierigkeit, es
auf Christus zu beziehen S. 108 —ni. I. Joh. 3, 9 f. S. 112.
Inhaltsverzeichnis. VII
Seite
Richtige LA: ή γέννηση S. 112 —114. Verlesung S. 114.
Wichtigkeit der lateinischen Überlieferung S. 114 —115.
2) Joh. ι, h—14. S. 115—127: Uralte Kontroverse,
ob 01 Ιγεννήθησαυ oder ôç... Ιγεννήθη S. 115 —116. Ter-
tullians Stellung und Text S. 116. Überlieferung S. 117.
Behauptung einer wunderbaren Geburt S. 118 — 120. Un-
möglichkeit beider LAA S. 120—124. Eine Randglosse aus
dem johanneischen Kreise S. 124—125. Das Relativ-
pronomen S. 125 — 126. Bearbeitung des 4. Evangeliums
durch den johanneischen Kreis S. 126 — 127.
3) Joh. ι, 33. 34. S. 127—132: Ablehnung der LA
ό εκλεκτός durch fast alle Herausgeber S. 127 — 128. Be-
zeugung S. 128 — 129. δ εκλεκτός im Neuen Testament
und in der späteren Christologie S. 129 — 130. Ersatz durch
ó ulós S. 130 —131. Jüdische Theologie im 4. Evangelium
S. 131 —132.
4) I. Joh. 4, 2 f. S. 132—137: Vernachlässigung der
LA λύει S. 132. Bezeugung S. 132 — 135. Innere Gründe
für λύει S. 135 — 137. Verbindung mit II. Joh. 7 S. 137.
Sinn des λύει S. 137.
5) I. Joh. 2, 17. S. 138—140: Übergehen des Zusatzes
in den Kommentaren S. 138. Seine Bezeugung S. 138 — 139.
Erwägungen, die ihn schützen S. 139 — 140.
6) I. Joh. 2, 20. S. 140—141: Stellung der Heraus-
geber zur LA ττάντα S. 140. Ihre Bezeugung S. 140. Ein-
wände gegen diese LA und deren Widerlegung S. 140—141.
Entstehung der falschen LA S. 141.
7) I. Joh. 3, 10. S. 141—143: Stellung der Herausgeber
zur LA ό μή ών δίκαιοί S. 141. Bezeugung S. 141 —142.
Gründe für ihre Echtheit und mechanische Verschreibung
S. 141 —143.
8) I. Joh. 5, 16 f. S. 143—149: Bezeugung des ού und
Stellungnahme der Herausgeber S. 143. Streichung aus
inneren Gründen S. 143 — 144. Gründe für seine Ein-
schiebung S. 144.
Bedeutung der lateinischen Uberlieferung S. 144—145.
Vorschlag bei der Textkritik von der Vulgata auszugehen
S. 145 — 148. Wichtigkeit der Neuentdeckungen S. 148.
Die Komposition des Johannesevangeliums S. 148. Die
johanneische Theologie S. 148 — 149.
Anhang A: Hinzufügung eines Stückes einer alten
Glaubensregel zu I. Joh. 5,20 S. 149 —150. Absicht und
Zeit der Zufügung S. 150 —151.
Anhang B: Ablehnung von Künstles Hypothese, Pris-
cillian sei Urheber des Komma johanneum S. 151 —152.
Nachaugustinische Bearbeitung eines alten Zusatzes S. 152.
ΥΠΙ Inhaltsverzeichnis.
Seite
.Zeit des alten Zusatzes S. 152. Seine Unabhängigkeit von
der Christologie des Johannes S. 152.
7) Über den Spruch »Ehre sei Gott in der Höhe«, und
das Wort »Eudokia.« 153—179
1) Die Überlieferung S. 155—157: a) Die griechische
Überlieferung S. 152 — 154. b) Die lateinische Überlieferung
S. 154. c) Die syrische Überlieferung S. 155. d) Aus der
sonstigen Überlieferung S. 155 — 156.
Erklärung der Varianten bis auf ευδοκία S. 156—157.
2) Der Bau und Sinn des Spruchs S. 157—177:
Notwendigkeit einer Zweiteilung nach έπΐ yf)Ç S. 157—162.
Die Annahme eines Hyperbatons: εΙρήνη.. .ευδοκίας
S. 162 — 165. ευδοκία in der LXX S. 165 — 169, bei Paulus
S. 169 — 171, in der Folgezeit S. 171 —174. Vieldeutigkeit
des Ausdrucks: άνθρωποι ευδοκίας S. 174 — 175. Stützen
der Annahme eines Hyperbatons S. 175 — 177.
Anhang: Die Übersetzungshypothese S. 177. Syrien
als Ausgangspunkt der LA ευδοκία S. 178. Widerlegung
von Einwänden S. 178 — 179.
8) Über I. Kor. 14,3 2 ff. und Rom. 16, 2 5 ff. nach der ältesten
Überlieferung und der marcionitischen Bibel 180—190
ι. Eine doppelte Schwierigkeit in I. Kor. 14, 33 S. 180
— 182. Der richtige Text S. 182 —183. Einschiebung von
ó θεόΐ durch einen Kopisten S. 183. Wert des westlichen
Textes S. 183-184.
2. Marcionitisches im Neuen Testament S. 184. Un-
echtheit und die Hypothese marcionitischen Ursprungs von
Rom. 16, 25 ff. S. 185-186. Varianten S. 186—189. Not-
wendigkeit von zwei Streichungen und marcionitischer
Charakters. 186 — 189. Entstehungsgeschichte der Doxologie
S. 189 — 190.
9) Studien zur Vulgata des Hebräerbriefs 191—234
ι. Verhältnis der Vulgata des Hebräerbriefs zum
»echten« Text S. 191 —193. Charakter der Varianten S. 193
—194. Folgerungen für das griechische Original der Vulgata
S, 194.
2. Vorlagen des Hieronymus S. 195 — 197. Zwei vor-
hieronymianische lateinische Zitate aus dem Hebräerbrief
S. 197 — 199. Das Verhältnis des Zitats bei Lucifer zu dem
lateinischen Text des Claromontanus-Parisiensis S. 199 — 202.
Vergleichung des Vulgatatextes mit dem des Claromontanus-
Parisiensis und dem des Freisingensis-Monacensis S. 202
— 204. Nachweis der grundlegenden Benutzung des durch
Inhaltsverzeichnis, U
Seite
den Claromontanus-Parisiensis vertretenen Textes bei
Hieronymus mit Verwendung des durch den Freisingensis-
Monacensis vertretenen zu Verbesserungen S. 204—206.
Nachweis von selbständigen Verbesserungen des Hieronymus
S. 206 — 211. Alter der vorhieronymianischen Übersetzungen
und der griechischen Vorlage des Freisingensis-Monacensis
S. 211—212. Die Vulgata als stilistische Revision nach-
gewiesen an c. 13 S. 213 — 214. Unmöglichkeit, die Benutzung
einer griechischen Handschrift durch Hieronymus nachzu-
weisen S. 214 — 215. Verwertung der lateinischen Zeugen
für den Originaltext S. 215 — 216. Nichtberücksichtigte
Itala-Codd. S. 217.
Retroversion des Hebräerbriefs nach der Vulgata
S. 217—234.
10) Zwei alte dogmatische Korrekturen im Hebräerbrief 235—252
Anlaß zu dogmatischen Korrekturen im Hebräerbrief
S. 235-236.
I. 2, 8 —10 S. 236 — 245 : Die Überlieferung von χω pis >
χάριτι S. 237 —239. Schreibfehler? S. 239 —240. Sach-
liche Erwägungen, besonders des Kontextes S. 240 — 243.
Zwei Parallelstellen S. 244 — 245.
II. 5, 7—9 S. 245 — 248: Verwendung der Gethsemane-
szene S. 245 — 246. ευλάβεια S. 246 — 248. Unmöglichkeit
des überlieferten Textes S. 248 — 249. Einschiebung eines
ούκ S. 249—252.
Register der Bibelstellen 253—256
Hainack, Studien I. b