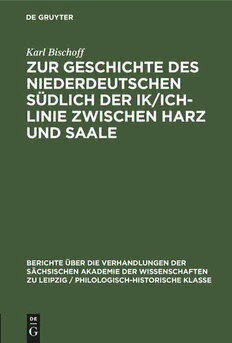Table Of ContentBERICHTE ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER SÄCHSISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU LEIPZIG
Philologisch-historische Klasse
Band 102 • Heft 6
KARL BISCHOFF
ZUR GESCHICHTE DES NIEDERDEUTSCHEN
SÜDLICH DER IK/ICH-LINIE
ZWISCHEN HARZ UND SAALE
19 5 7
AKADEMIE-VERLAG B E R L I N
Vorgetragen in der Sitzung vom 7. Mai 1956
Manuskript eingeliefert am 18. Mai 1956
Drnckfertig erklärt am 4. Februar 1957
Erschienen im Akademie-Verlag GmbH., Berlin W 8, Mohrenstraße 39
Lizenznummer 202 • 100/552/56 • Mdl der DDR, Xr. K 11/2831
Satz und Druck der Buchdruckerei F. Mitzlaff KG., Rudolstadt V/14/7 —
Bestell- und Verlagsnummer 2026/102/6
Preis: DM 3,70
Printed in Germany
Wir haben uns daran gewöhnt, in der Linie, die nördliches
ik, ek von südlichem ich, eck scheidet, die Südgrenze des Nieder-
deutschen zu sehen. Nach der auf Erhebungen von 1880 zu-
rückgehenden Sprachatlaskarte1 biegt sie, vom Eichsfeld kom-
mend, westlich Worbis nach Norden um, trifft zwischen Lauter-
berg und Sachsa auf den Harz, schlägt um Hohegeiß einen
Bogen und überquert dann in westöstlicher Richtung das
Gebirge südlich von Benneckenstein, Hasselfelde, Treseburg,
Gernrode, Opperode, Meisdorf, Ermsleben. An Aschersleben,
Staßfurt und Calbe vorbeiziehend, geht sie kurz oberhalb ihrer
Mündung über die Saale und läuft bis dicht vor Wittenberg
an der Elbe entlang. Ohne das Ergebnis der Sprachatlas-
aufnahme zu kennen, hatte 1882 HAUSHALTER in einem summa-
rischen Verfahren die Sprachgrenze zwischen Mittel- und
Niederdeutsch festzulegen versucht2. Er war im ganzen zum
gleichen Verlauf gekommen, nur in der Gegend von Aschers-
leben zog er sie ein paar Orte nördlicher, zeichnete da aber
auf seiner Karte ein kleines Gebiet ein, in dem das Nieder-
deutsche in den vorausgegangenen zwei, drei Jahrzehnten zu-
rückgedrängt war, in dem er es nur noch als veraltet, resthaft
feststellen konnte. Auf dem Harz ist die Grenze bis heute
unverändert geblieben, östlich von ihm sind die Städte Aschers-
leben, Staßfurt und Calbe ins ¿cA-Gebiet gezogen worden.
Seit TÜMPELS Untersuchungen von 1880 über „Die Mundarten
1 Wrecle, Mitzka, Martin, Deutscher Sprachatlas. Marburg 1926 ff., Karle 4.
2 Bruno Haushalter, Die Sprachgrenze zwischen Mittel- und Niederdeutsch
von Helemünden an der Werra bis Staßfurt an der Bode. Mitt. d. Yer. f.
Erdk. zu Halle. 1883, S. 31—51.
4 KARL BISCHOFF
des alten niedersächsischen Gebietes zwischen 1300 und 1500"1
gehört es zu den festen Einsichten der deutschen Sprach-
geschichte, daß das Niederdeutsche zwischen Harz und Saale
ursprünglich viel weiter nach Süden gereicht hat. Auf Grund
verhältnismäßig weniger Urkunden und Namensformen hatte
er geschlossen, daß es sich im 13. Jahrhundert bis an die Un-
strut und bis an den Südrand des Harzes erstreckte. Er hatte
nachdrücklich darauf hingewiesen, daß das Niederdeutsche in
diesem dem Niederdeutschen später verlorengegangenen Ge-
biet nicht bloß Urkunden- und Rechtssprache gewesen ist,
sondern daß es auch das Volk gesprochen hat. Was TÜMPEL
im Mansfeldischen aus den Urkunden ablas und für die mittel-
alterliche Volkssprache erschloß, das findet in HAUSHALTERS
Übergangsgebiet bei Aschersleben und in den kleinen Ver-
änderungen seit der Sprachatlasaufnahme seine Fortsetzung:
zwischen dem Niederdeutschen und dem Mitteldeutschen
herrscht keine Ruhe, die südlichen Formen, Wörter und Laute
gewinnen nach Norden hin an Boden.
Wenn man die ik/ich-JAme den Südrand des Niederdeutschen
begrenzen läßt, dann nimmt man als dessen Hauptmerkmal
die nichtdurchgeführte zweite Lautverschiebung. Für die
Frage der ehemaligen sprachlichen Zugehörigkeit unseres Ge-
bietes ist das zweifellos das ergiebigste Kriterium. Auch vor
dem Einsetzen der deutschen Urkundensprache vermag man
mit seiner Hilfe den deutschen Namen in den lateinischen
Diplomen des 14. bis 11. Jahrhunderts noch einige Aussagen
abzunötigen. Auf Abb. 1 sind Orts- und Flurnamen mit un-
verschobenem Konsonantenstand aus solchen Urkunden zu-
sammengetragen worden, die, soweit das mit Sicherheit oder
einiger Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann, südlich
der heutigen ik/ich-Linie ausgefertigt sind. Magdeburger,
Halberstädter, Ilsenburger, Drübecker Urkunden z. B. sind
nicht einbezogen worden, weil bei ihnen die Möglichkeit be-
steht, daß die Schreiber, soweit sie Niederdeutsche waren,
1 PBB 7 (]880), 1—104.
Zur Geschichte ties Niederdeutschen 5
etwa Ortsnamen auf -dorf in solche auf -dorp umgesetzt haben
könnten. Das ist natürlich auch in den südlich der genannten
Grenze geschriebenen nicht ausgeschlossen, aber dann wären
eben hier schon niederdeutsche Schreiber in niederdeutschen
„Schreibstuben" am Werk gewesen.
Das ganze Mansfeldische ist bis hin zur Unstrut mit unver-
schobenen Ortsnamen übersät: Walbike, Koningeswik, Krc-
vetenvelt, Helpede, Rodenscerenbeke, Eilwardestorp, Reynsdorp
usw. Auch wenn hier nur das Urkundenbuch der Klöster der
Grafschaft Mansfeld ausgewertet ist1, genügt das Ergebnis,
um TÜMPELS Feststellungen zu unterstreichen. Seine Süd-
grenze kann nun aber fürs 13. und 12. Jahrhundert erheblich
weiter nach Süden, über die Unstrut und die Helme hinaus,
zurückgeschoben werden.2 Urkunden der Grafen von Hohn-
stein und der Grafen von Klettenberg aus dem 13. Jahrhundert
nennen in der Gegend von Walkenried die Flurnamen Himel-
rike, Ekeneberg, Cranekestein (14. Jahrh.), Cranekesbürne und
die südlich von Walkenried gelegenen Orte Elrike 'Ellrich',
Saswerp 'Sachswerfen', Urbeke 'Urbach', Leynbeke 'Leimbach',
Gersbeke 'Görsbach', südlich der Helme (wüst) Fladekendorp,
Merbeke 'Mörbach', die Grafen von Kirchberg heißen de Kirk-
berch, Kercberg, Kercberch2. Da es sich in den Diplomen um
1 Bearbeitet von Max Krühne. Halle 1888.
2 Auf der Karte ist immer nur e i n Namensbeleg aus einem bestimmten
Jahr eingetragen. Die folgenden Anmerkungen geben einige weitere, streben
aber keine Vollständigkeit an. Ein systematisches Suchen wird die Dichte
auf der Abbildung sicherlich verstärken können. — silvae, quae vocatur Jaget-
hus et terminis, quorum nomwa sunt haec Ekeneberg, Bogestal, Himelrike,
Sassenberg . . . 1242, Vergleich der Grafen von Klettenberg mit Walkenried.
Or. Die Urkunden des Stifts Walkenried. In: Urkundenbuch des hist. Ver.
f. Niedersachsen II. III. Hannover 1852 (abgek. UB. Walk.). Nr. 236. —
sub scopulis Cranekestein 1322. Grafen von Hohnstein f. Walkenried. Or.,
ebd. 803. — Cranekesbürne 1233, Urk. Grafen von Hohnstein, Or., ebd. 186
(Reg.). — in oppido nostro Elreke 1229, Urk. Graf von Klettenberg, C.'op.
Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae.
Jena 1896 ff. 3, 69. Zeuge Henricus de Elrike 1229. Nordhäuser Urk. Or.,
UB. Walk. 164 (Reg.); 1236, Nordhäuser Urk. Or., ebd. 206 (Reg.). Hart-
6 KARI BISCHOFF
Verkäufe, Überlassungen, Vergleiche zugunsten der Walken-
rieder Mönche handelt, könnte man vielleicht bei allen Ur-
kunden Empfängerausfertigungen vermuten und die unter-
schobenen Formen der Namen auf die Rechnung der Walken-
rieder setzen. Sie sagten dann wenigstens für die südlicheren
Orte selber nichts aus. Das gilt auch für gelegentliche Nen-
nungen in Urkunden des Grafen von Beichlingen, des Land-
grafen von Thüringen und des Stifts Jechaburg. Immerhin
gibt es auch in Nordhausen Bürger, die de Elrike genannt
werden, und der Graf von Hohnstein hat in einer hohnstei-
nische Familienangelegenheiten behandelnden Urkunde Sas-
werpen und Wigradisdorp 'Wiegersdorf'1. Den Bericht zweier
Grafen von Klettenberg, in dem sie mitteilen, was sie als
Augenzeugen und durch Erkundigungen über bestimmte Be-
sitzverhältnisse erfahren haben, in dem gesagt wird, daß
Bertoldus . . . incendit Vladekendorp, in dem bona in Merbeke,
in Gersbeke, in Boykendorp 'Peukendorf' b. Ebeleben erwähnt
werden, wird man hinsichtlich der Namen schon eher für die
•wictis de Ulrike, Bürger in Nordhausen, 1301. Or., ebd. 606 (Reg.), villa
Elrike 1256, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 317 (Reg.). Heriwicus de
Elreke, Nordhausen 1303, Or., ebd. 623 (Reg.). — in Saswerp 1235, in pla-
cito provinciali Clettenberch, Or., ebd. 200 (Reg.); in Saxwerpe 1237, Urk.
Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 216 (Reg.); in Saswerpe 1279, Urk. Graf
von Klettenberg, Or., ebd. 454 (Reg.). — Z. Conradus de Leynbeke 1254, Urk.
Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 304 (Reg.). — in Urbcke 1206, Urk. Jecha-
burg/Walkenried, Or., ebd. 59 (Reg.), 1217 Urk. Graf von Hohnstein, Or.,
ebd. 100 (Reg.), 1313 Urk. Nordhausen, Or., ebd. 741 (Reg.). — Z. lieinoldus
de Gersbeke 1232, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 181 (Reg.); in Gersbeke
1246, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 251, 1327 Urk. Grafen von Hohn-
stein, Or., ebd. 845 (Reg.). — Fladekendorp 1229, Urk. Graf von Klettenbeiy,
Or., ebd. 165 (Reg.), 1251 Urk. Grafen von Klettenberg, Or., ebd. 277 (Reg.).
— Merbeke 1231, Urk. Graf von Beichlingen, Or., ebd. 178. — Gosmants de
Kit ober ch 1209, Urk. Graf von Klettenberg, Or., ebd. 72; Z. eomes Heinricus
de Kercberg 1229, Urk. Graf von Hohnstein, Or., ebd. 163 (Reg.); Z. comes
Heinricus de Kirkberch 1234, Urk. Landgraf von Thüringen für Klo. Walken-
ried, Or., ebd. 193; H. comes de Kirkberg 1242, Urk. Grafen von Klettenberg,
Or., ebd. 236.
1 ca. 1240. Or., Dobenecker 3, 940 (Reg.).
/IS
ÛERNRODE
o
BENNECKENSTEM
HARZOÛ ERODE
DUDERSTADT
o
tKukberch 1234
• Yekaburg 1196
"Biscopesholt 126 5
i Boykendorp '239
Heker,
1264
BEICHLINÛEN
o vogetsco
? munse 1233 1 Bassendorp
• / 1264 • %Eyc>
MÜH IHAUSEN
1242 i" Cranicàurne /
' Jheodericus Leimenchth
• de Vichbeke 1234
Ekenstete 1231
»Bacsteden H44
o
WEM
Abb. 1
o/ERBST
ik 0
AKEN
ich
ASCHERSLEBEN
o
Walbike
Welpzholt . Misselendorp
* Adendhorp
)Koningeswik
Bunstorp »Ostdagestorp
• Bennendhorp
eippoldestorp • .Rystorp
Krevetenv't 'tercendorp
» Helpede
(o HALLE
•Karlestorp
Amelunckestorp
Mf Sìdikenbische • 'Rodenscerenbeke Bossendorp
Einestorp *
Gotistorp
• Nyendorp
*Asendorp
EHwardestorp
YPeflede
. Hemennighestorp L EIPZIO
» Heygendorp o
Oherrendorp
•v r Reynsdorp
Hekendorp
1264 •
Me inrichesdorp
ÙEN 1*64
o VGqetscot 1231
dorp
• x Eyckenberg 1264
Wincendorp
1206 o '
NAUMBURG
KLOSTER • Mìrtendorp
ke /¿M PFORTE /209
. Rurbeke 1250 tKaskeriken
eden /«< 1250
•Hugestorp
Suauirstorp tm Mascettorp 976
o /Börsen dorp ALTENBURQ o
WEIMAR 1206 Aldenkirkin tHO
Arnoidesdorp
1266
Hermesdorp I25b
• Craftestorp 1256
Abb. 1.