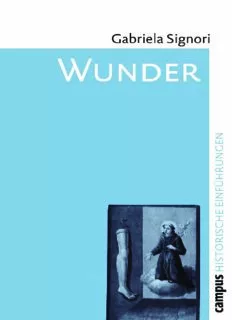Table Of ContentWunder
4806 [email protected]
Historische Einführungen
Herausgegeben von Frank Bösch, Angelika Epple, Andreas Gestrich,
Inge Marszolek, Barbara Potthast, Susanne Rau, Hedwig Röckelein,
Gerd Schwerhoff und Beate Wagner-Hasel
Band 2
Die Historischen Einführungen wenden sich an Studierende aller Semes-
ter sowie Examenskandidaten und Doktoranden. Die Bände geben Über-
blicke über historische Arbeits- und Themenfelder, die in jüngerer Zeit in
das Blickfeld der Forschung gerückt sind und die im Studium als Seminar-
themen angeboten werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf sozial- und
kulturgeschichtlichen Themen und Fragestellungen.
Unter www.historische-einfuehrungen.de finden sich zu jedem Band nützli-
che Ergänzungen für Studium und Lehre, unter anderem eine umfassende,
jährlich aktualisierte Bibliographie sowie zusätzliche schriftliche, Bild- und
Audioquellen mit Kommentar.
Gabriela Signori ist Professorin für Geschichte des Mittelalters an der
Universität Konstanz.
Gabriela Signori
Wunder
Eine historische Einführung
Campus Verlag
Frankfurt/New York
4806 [email protected]
Besuchen Sie unsere Seite zur Reihe:
www.historische-einfuehrungen.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-593-38453-5
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2007 Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln
Umschlagmotiv: Motivbild aus der Windschnurkapelle in Niederrasen
bei Bruneck im Pustertal. Quelle: Klaus Beitl, Votivbilder, Salzburg 1973.
Fotosatz: Fotosatz L. Huhn, Linsengericht
Druck und Bindung: Druckpartner Rübelmann, Hemsbach
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Printed in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
Inhalt
Vorwort: »Star of wonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Die christlichen Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1. Augustinus von Hippo († 430) . . . . . . . . . . . . 16
1.2. Gregor von Tours (ca. 539–594) . . . . . . . . . . . . 23
1.3. Gregor der Große († 604) . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4. Kirchliche Wunderkritik . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5. »Populäre« Wundervorbehalte . . . . . . . . . . . . 33
2. W underberichte: Hören und Sehen, Schreiben
und Lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1. Erzählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2. Augenzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3. Dingzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4. Berufsschreiber und Schönschreiber . . . . . . . . 52
2.5. Die Ordnung der Wunder . . . . . . . . . . . . . 61
2.6. Abschreiben, Vervielfältigen, Drucken . . . . . . . 62
2.7. Mirakelbilder – Votivbilder . . . . . . . . . . . . 66
3. Die soziale Welt des Wunders . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1. Frauen und Männer . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2. Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.3. Klerus, Adel oder Städter? . . . . . . . . . . . . . 86
3.4. Personenübergaben . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4806 [email protected]
� Wunder
4. Wunderheilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.1. Der Heilschlaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2. Biblische Heilungswunder . . . . . . . . . . . . 97
4.3. Das Gewicht der Tradition . . . . . . . . . . . . 98
4.4. Häufigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.5. Moderne Ätiologien . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.6. Krankheiten ohne Namen . . . . . . . . . . . . 106
4.7. Geburtswunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.8. ›Verrückt‹ oder Besessen? . . . . . . . . . . . . . 114
4.9. Magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.10. Wunderglaube oder Ärztekunst? . . . . . . . . . 125
4.11. Der Beitrag der Seelenheilkunde . . . . . . . . . 131
5. Gewalt und Wunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.1. Weltliche Übergriffe auf Klosterbesitz . . . . . . . 138
5.2. Gefangenenbefreiungen . . . . . . . . . . . . . . 141
5.3. Der Hundertjährige Krieg . . . . . . . . . . . . . 143
5.4. Die Hussiten- und die Türkenkriege . . . . . . . . 146
5.5. Das Galgenwunder . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.6. Wunder, Ritualmord- und Hostienfrevellegenden . . 151
Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Auswahlbibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Abbildungsnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Personen- und Ortsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Vorwort
»Star of wonder«
Münster, Hauptfriedhof. Es regnet. Der Wind peitscht gegen die
Fenster des Glasbaus. Nicht wie die Grabkapelle einer Heiligen
(korrekt: Seligen) sieht das Gebäude aus, sondern eher wie ein
Warteraum für Reisende. Das schlechte Wetter hält niemanden
ab. Es sind stille Besucher, andächtige Besucher, die am Grab von
Schwester Maria Euthymia, ehedem Emma Üffing (1914–1955),
innehalten und beten. An der Glaswand entlang ziehen sich zur
Rechten und zur Linken Holzbänke. Einige Besucher setzen sich,
andere verrichten ihre Gebete im Stehen. Junge Menschen, alte
Menschen, Männer, Frauen, ja selbst Kinder, jeder scheint etwas
zu wollen von Schwester Euthymia. Schwester Euthymia nämlich
wirkt Wunder. Die Homepage der Clemensschwestern weiß von
150.000 Bittbriefen und 45.000 Gebetserhörungen zu berichten.�
Bemerkenswert unspektakulär hingegen war Schwester Euthy-
mias Leben. Die Geschichte ist schnell erzählt. Selig gesprochen
wurde sie am 7. Oktober 2001, weil sie Kriegsgefangene gepflegt
und für ihre Mitschwestern und das von ihnen betreute Kran-
kenhaus fast zehn Jahre lang Wäsche gewaschen hatte.� Ob die
Menschen, die ihr Grab aufsuchen, Schwester Euthymias Lebens-
geschichte kennen? Der Wald aus Teddybären, Plastikblumen
und Gartenschmuck, der das Grab säumt, bleibt – zumal in dieser
� www.euthymia.de/sr_euthymia/index.htm. Das Manuskript wurde im Au-
gust 2004 fertiggestellt. Spätere Erscheinungen konnten nur noch punktuell
in Text und Bibliographie eingearbeitet werden. An dieser Stelle sei gleich-
sam Marc Müntz und Hedwig Röckelein für die gründliche Lektüre des
Manuskriptes gedankt.
� Vgl. u.a. Schwester Maria Euthymia. Ihr Leben, ihre Seligsprechung, ihre Aus-
strahlung, bearb. von Hans-Josef Joest u.a., Münster 2001.
4806 [email protected]
� Wunder
Hinsicht – stumm. Hier geht es nicht um die Heilige. Hier stehen
die Gläubigen im Mittelpunkt.
Im Blumenwald verstreut finden sich verschiedene Votivtafeln
(der Begriff will nicht so recht zum Gegenstand passen), wie jenes
Stück Papier, auf dem in fast zur Unkenntlichkeit verblasster Tinte
geschrieben steht: »Liebe Schwester Euthymia, bitte bei Gott, das
(sic) unsere Kinder zum katholischen Glauben (...) zurückkehren.«
Geschrieben worden ist der Brief irgendwann in den letzten zehn
Jahren. Um der Bitte mehr Gewicht und mehr Würde zu ver-
leihen hat der Bittsteller das Papier in einen Holzrahmen gefasst.
Hinter dem gerahmten Papierbrief sticht ein rotes Holzherz her-
vor. Darauf bittet eine Henriette, Schwester Euthymia möge sich
dafür einsetzen, dass zwei ihr nahestehende Personen endlich Ar-
beit finden. Das Herz ist mit einem Filzstift beschrieben, der dem
westfälischen Klima standhält. Es datiert auf den 8. April 2003.
Weiter rechts, nahe der Glaswand findet sich das entsprechende
Dankesschreiben, wiederum im Herzform. Es datiert auf den
23. Oktober 2003. »Danke für deine Hilfe«, heißt es da, »immer
wenn ich dich brauche, bist du für mich da.« Nicht nur rote Her-
zen, auch blaugrüne Gartenfrösche aus glasiertem Ton werden als
Schriftträger benutzt. Am häufigsten sind jedoch die Laternen.
Kleine, große, rote, graue und schwarze Laternen. Sie scheinen
der Hoffnung plastische Gestalt zu verleihen, von Schwester Eu-
thymia erhört zu werden. Als Schriftträger fungiert das Laternen-
fenster: »Liebe Schwester Euthymia, hilf uns bitte weiter, dass
wir gesund bleiben, egal was auch kommt. Deine Annelies. 14.1.
2003.« Im Blumendickicht verborgen findet sich schließlich auch
ein kleines Nest aus Kieselsteinen mit Tierfigürchen und einem
Holzschild, auf dem, wohl als Dankeschön, geschrieben steht:
»Star of Wonder«.
Einleitung
Verglichen mit den romanischen Sprachen tut sich die deutsche
Sprache schwer, Sachverhalte, die unsere Neugier wecken, weil
sie vom Erwartbaren abweichen, begrifflich zu fassen. Darauf hat
die Forschung verschiedentlich schon hingewiesen. Wir kennen
allein den diffusen Sammelbegriff Wunder, wo andere Sprachen
der lateinischen folgen und ungleich präziser zwischen »pro-
digia«, »mirabilia« und »miraculum« unterscheiden. Den vielen
im Deutschen namenlos gebliebenen Wunderarten gemein ist,
dass sie allesamt Dinge bezeichnen, die sich nicht erklären lassen,
Dinge, die verwundern, die einen aufmerken, staunen lassen oder
neugierig machen.
Auf der Seite der Neugier stehen über die Jahrhunderte hin-
durch die Mirabilien, denen die Reisenden in fremden Ländern,
auf fremden Kontinenten oder am Rande der Welt zu begegnen
glaubten.� Das gilt gleichermaßen für die Prodigien, Naturwun-
der wie Kometen, Sternschnuppen, siamesische Zwillinge oder
Wolfskinder, die im Verlauf der Jahrhunderte vom göttlichen
Zeichen oder Vorboten zur wissenschaftlichen Herausforderung
� Vgl. Jacques Le Goff, L’imaginaire médiéval. Essais, Paris 1985, 17–39; Dale
Kinney, »Mirabilia urbis Romae«, in: The Classics in the Middle Ages, hg. v.
Aldo S. Bernardo/Saul Levin (Medieval & Renaissance Texts & Studies 69),
Binghamton 1990, 207–221; Caroline Walker Bynum, Miracles and Marvels:
the Limits of Alterity, in: Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar
Elm zum 70. Geburtstag, hg. v. Franz J. Felten/Nikolas Jaspert, Berlin 1999,
799–818; Michel Tarayre, Miracula et mirabilia chez Vincent de Beauvais.
Étude de concepts, in: Le Moyen Âge 105 (1999), 367–413; Nine Robijntje
Miedema, Die »Mirabilia Romae«. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung mit
Edition der deutschen und niederländischen Texte (Münchener Texte und Un-
tersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 108), Tübingen 1996.
4806 [email protected]
Description:Die Geschichte des Wunders reicht vom antiken Griechenland bis in die heutige Zeit. Da sie den Stoff für zahllose Erzählungen bilden, sind Wunder ein wichtiges Thema für alle, die sich für die Geschichte abendländischer Frömmigkeitspraktiken und religiöser Vorstellungen interessieren. Das Wun