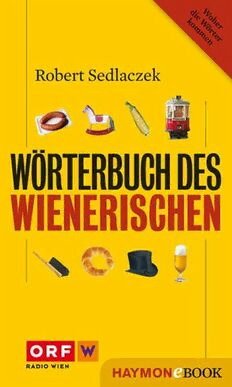Table Of Content©2011
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder
in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag
freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7650-0
Umschlag- und Buchgestaltung, Satz: hoeretzeder grafische gestaltung, Scheffau/Tirol
Autorenfoto: Willy Duschka
Lektorat: Gerhard Zeillinger
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung
oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Robert Sedlaczek
Wörterbuch
des Wienerischen
In Zusammenarbeit mit
Melita Sedlaczek
Dieses Buch ist dem Andenken
an Maria Hornung (1920–2010) gewidmet.
Inhalt
Zurück zu den Wurzeln!
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
Abkürzungen
Fachbegriffe
Quellenverzeichnis
Verwendete Literatur
Musiktipps
DVD-Tipps
Zurück zu den Wurzeln!
Die Autoren des Buches, das Sie gerade in Händen halten, sehen ihre
Zusammenstellung als Arbeit gegen das Vergessen.
Wie geht es dem Wienerischen? Müssen wir uns Sorgen machen?
ROBERT: Wir müssen uns sogar große Sorgen machen. Das Wienerische befindet
sich auf dem Rückzug, auch den meisten anderen Stadtmundarten geht es
nicht gut. Während es eigentlich logisch wäre, dass die Menschen in der
Familie und im Bekanntenkreis Mundart sprechen und im Beruf die
Standardsprache, dringt die Standardsprache immer mehr auch ins Private ein.
Stopp, stopp, stopp! Warum ist es logisch, dass man in der Familie Mundart
spricht?
ROBERT: Die Mundart ist schon vom Vokabular her für die tägliche
Kommunikation besser geeignet als die Standardsprache, sie hat Ausdrücke,
die viele Nuancierungen erlauben. In der Standardsprache heißt es „Ich liebe
dich!“, in der Mundart kann man sagen „I mag di!“, „I steh auf di!“, „I foahr
ab auf di!“ und vieles mehr. Es gibt auch Dutzende verschiedene Ausdrücke
für „weinen“, Christine Nöstlinger sagt, sie ist auf nicht weniger als
dreiundzwanzig gekommen. Oder denken wir nur an die zahlreichen
Ausdrücke für einen Alkoholrausch: ein Spitz, ein Dullihä, ein Dusel, ein
Gitsch, ein Flieger, ein Käfer, ein Mugel, ein Nebel oder ein Schwips, man hat
einen Fetzen, einen Tippel, einen Patzen, einen Pemstl, einen Schwamm,
einen Schwül, einen Schweigel, einen Zapfen, einen Ziegel, man ist in der
Fetten, im Öl oder in der Gluat, und am nächsten Tag muss man dann mit
einem Brand fertig werden.
Sind wir ein Volk der Trankler, der Fassltippler?
MELITA: Nein. Aber Alkohol ist bei uns seit alten Zeiten eine legalisierte Droge,
deshalb gibt es viele Ausdrücke für die erwünschten und nicht erwünschten
Nebenwirkungen. Ein Schwipserl ist beispielsweise ein ganz leichter Rausch,
das lässt sich auch von einem Spitzerl sagen, ein Dusel ist ein stiller Rausch,
der Schwül benebelt. Wer allerdings einen Fetzen oder einen Mugel hat, der
wird am nächsten Tag eine beträchtliche Restfetten aufweisen.
Sterben auch diese Wörter aus? Für sie scheint es ja einen Bedarf zu geben ...
MELITA: Wenn jemand die Hälfte der oben angeführten Wörter kennt, dann
geben wir ihm im Wienerischen die Note „Sehr gut“. Wir haben ganz bewusst
viele Wörter aufgenommen, die vielleicht schon beinahe ausgestorben sind.
Wenn jemand ein Wort verwendet, das in diesem Buch steht, kann es also
sein, dass selbst ein Urwiener ratlos ist. Aber vielleicht gibt es doch den einen
oder anderen, der sagt: Das kenn ich.
ROBERT: Dass Wörter der Mundart aussterben, wird von vielen bedauert. Sie
sagen dann beispielsweise: „Meine Großmutter hat den Ausdruck ‚auf
Lepschi gehen‘ oft verwendet, heute können meine Freundinnen und Freunde
damit nichts mehr anfangen.“ So gesehen ist unser Buch auch ein „Buch
gegen das Vergessen“.
Gehen wir die Sache grundsätzlich an. Was ist denn typisch für das
Wienerische?
ROBERT: In der Wortbildung die vielen Wörter mit der Vorsilbe Ge-: Gwirkst,
Gstätten, Gspusi, auch Gramanzen. Dann die vielen Feminina, die im
Wienerischen schon in der Einzahl ein -n haben: die Hutschen statt die
Hutsche, die Ratschen statt die Ratsche. Im Anlaut wird oft ein f zu pf:
Pfludern statt Fluder, pfuazen statt furzen etc. Ebenfalls im Anlaut mutiert
manchmal ein sch zu einem tsch, ein sk zu einem schk. Auffällig sind auch
die Verkleinerungsendungen mit -l. Ein kleiner Zeitabschnitt ist
beispielsweise „ein Randl“. Aber wie ist das generell einzuschätzen? Oft gibt
es zwei verschiedene Arten von Verkleinerungen. Darüber haben sich
Sprachwissenschafter jahrzehntelang den Kopf zerbrochen. Was ist kleiner:
Ein Glasl oder ein Glaserl? Ein Schnitzel oder ein Schnitzerl?
Wie lautet die Antwort?
ROBERT: In diesen Fällen sind das von der Bedeutung her gar keine
Verkleinerungen. Die Endungen drücken vor allem eine emotionale
Zuwendung und Wertschätzung aus. Ein Weinderl ist nicht ein kleiner,
sondern ein „großer Wein“ – wie die Weinkenner sagen. Wenn wir einen
besonders guten Wein trinken und ein zweites Glas einschenken, wird das
Glas zum Glasl oder zum Glaserl – wegen des Inhalts. „Trink ma noch a
Flascherl Wein“ heißt es in einem Wienerlied. Damit ist nicht ein Stifterl,
nicht eine kleine Flasche gemeint, sondern eine normale
Siebenzehntelflasche.
MELITA: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch sagen: So wie in den
anderen Mundarten gibt es auch im Wienerischen kein Präteritum (ich ging),
sondern nur das Perfekt (i bin gangan). Auch Genitive (des Vaters Hut)
existieren keine, stattdessen wird umschrieben (dem Vatern sei Huat). Wir
haben trotzdem in den meisten Fällen die Endungen der Genitive angeführt,
denn viele Ausdrücke sind auch standardsprachlich mit dem normalen Genitiv
verwendbar.
Wir reden ja über das Sammeln von Wörtern ... Gibt es im Wienerischen neue
Ausdrücke, solche, die man in den früheren Wörterbüchern des Wienerischen
nicht findet?
ROBERT: Ja, das gibt es: Armaturenschlecker, Guckidrucki, Heizschwammerl,
Karottenballett, Proloschlauch, Schachtelwirt, Tuttel-boxer usw. Es fällt auf,