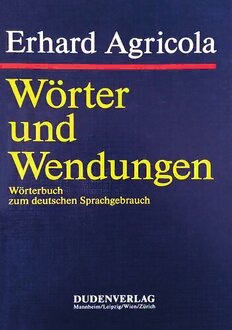Table Of ContentWörter und Wendungen
Wörter
und Wendungen
Wörterbuch
zum deutschen Sprachgebrauch
Überarbeitete Neufassung der 14. Auflage
Herausgegeben von Erhard Agricola
unter Mitwirkung von
Herbert Görner und Ruth Küfner
DUDENVERLAG
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich
Redaktionelle Bearbeitung:
Christiane Agricola, Herbert Görner,
Annemarie Königsdorf,
Ruth Küfner, Charlotte Marckscheffel
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen
Sprachgebrauch/hrsg. von Erhard Agricola unter Mitw. von
Herbert Görner und Ruth Küfner. [Autoren: Christiane Agricola...]. -
Überarb. Neufassung der 14. Aufl., 1. Aufl. der Neufassung. -
Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1992
ISBN 3-411-05281-3
NE: Agricola, Erhard [Hrsg.]
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung
des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm
oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der
Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt
oder verbreitet werden.
© Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG,
Mannheim 1992
Druck und Bindearbeit: Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
ISBN 3-411-05281-3
Vorwort
Es wurde schon vor Jahrzehnten im größeren Rahmen unternom-
men, die Verknüpfungsmöglichkeiten für einen beträchtlichen Teil
des deutschen Wortschatzes in einem speziellen Wörterbuch darzu-
stellen. Unter wesentlich verändertem Aspekt, entsprechend den
erweiterten Kenntnissen der Forschung und der gewandelten Auf-
fassung von den sprachlichen Zusammenhängen, ist das Vorhaben
hier neu verwirklicht worden.
Wir haben diesem Buch den Titel «Wörter und Wendungen» gege-
ben; denn es zeigt, wie die Wörter des allgemeinen deutschen Wort-
schatzes zu sprachlichen Wendungen verknüpft werden können.
Der Begriff der Wendung ist dabei weit gefaßt. Er beginnt mit dem
Bereich der losen und freien, aber häufig auftretenden Wortverbin-
dungen, die als Beispiele für inhaltlich sinnvolle und grammatisch
richtige Verknüpfungsmöglichkeiten dienen; er umfaßt die mehr
oder weniger festen stehenden Redensarten und erstreckt sich bis
zu den gänzlich erstarrten Wortfügungen und fest geprägten Sätzen
mit voller Umdeutung des Gesamtsinnes. Dem Benutzer wird das
jeweils behandelte Stichwort im Zusammenhang eines Teilsatzes,
wenn nötig auch eines vollständigen Satzes, mit den üblichen oder
mit typischen Verbindungen, also im wirklichen Sprachgebrauch
vorgeführt.
Diese Form der Darstellung soll erstens die Lücke schließen, die
zwischen den Fügungsregeln der Grammatik und der Aufzählung
von Einzelwörtern in einem Wörterbuch klafft. Darüber hinaus wird
versucht, grundsätzlich und systematisch den Zusammenhang dar-
zulegen, der zwischen den verschiedenen Bedeutungen eines Wor-
tes (die meisten der aufgenommenen Stichwörter sind mehrdeutig)
und den zu jeder Bedeutung gehörenden Redewendungen besteht.
Umgekehrt kann dadurch aus der Textumgebung eines solchen
Wortes auf die im jeweiligen Zusammenhang gemeinte Bedeutung
geschlossen werden. Ein drittes Anliegen des Buches ist es, Aus-
kunft über den Geltungs- und Verwendungsbereich der aufgeführ-
ten Wendungen zu geben. Alle Beispiele, die nicht als zur Hoch- und
zur Allgemeinsprache gehörig bewertet werden können, sind mit
entsprechenden stilistischen Hinweisen versehen.
Die Redewendungen, die dieses Nachschlagewerk bietet, sind so
ausgewählt, gestaltet und gegebenenfalls erläutert, daß weder zu
ihrem Verständnis noch zu ihrem Gebrauch zusätzlich theoretische
Kenntnisse erforderlich sind. Wer über die praktische sprachliche
Belehrung hinaus Näheres von Wesen, Form und Abgrenzung der
Wörter und Wendungen erfahren möchte, sei auf die «Einführung»
(S. 16 bis 35) verwiesen. Im folgenden werden jedoch noch einige
Hinweise zur ausschöpfenden Benutzung des Buches gegeben.
Hinweise für den Benutzer
1. Anordnung und Auswahl der Stichwörter
1.1. Die Stichwörter sind durch Fettdruck hervorgehoben (siehe aber 3.4.2.,
3.4.4. u. 6.2.7.) und alphabetisch angeordnet.
1.2. Bei gleichlautenden Stichwörtern verschiedener Wortart stehen die mit
kleinen Anfangsbuchstaben vor denen mit großen:
leben:...
Leben, das:...
Umlaute gelten als einfache Laute.
1.3. Zwei oder mehrere gleichlautende Stichwörter, die verschiedene Herkunft
und Bedeutung haben, sind durch kleine voranstehende hochgestellte Ziffern unter-
schieden:
1 Strauß ... ’seln ...
2StrauB ... 2seln ...
1.4. Die rund 8000 Stichwörter des Wörterbuches stellen den wesentlichen Teil
des deutschen Allgemeinwortschatzes dar.
Bei der Auswahl wurden diejenigen Wörter bevorzugt, die häufig in Redewendungen
gebraucht werden, mehrere Bedeutungen aufweisen, verschiedene grammatische
Verknüpfungen eingehen und stilistische Schwierigkeiten bieten.
Wortzusammensetzungen konnten nur in beschränkter Zahl als Stichwörter aufge-
nommen werden. Gegebenenfalls schlage man unter dem Grundwort der Zusammen-
setzung nach.
2. Aufbau der Stichwortartikel
Zu jedem Stichwort sind unter Gesichtspunkten, die in der Einführung (S. 16ff.) aus-
führlich dargestellt sind, eine Reihe von Beispielen dafür gegeben, wie und in welcher
Art von Wendungen das Stichwort gebraucht wird.
2.1. Die Artikel der Stichwörter ohne stärkere Bedeutungsabstufung sind nicht
unterteilt.
2.2. Wenn das Stichwort mehrere deutlich abgrenzbare Bedeutungen (Bedeu-
tungsvarianten) hat, sind folgende Unterteilungen des Stichwortartikels angewandt:
2.2.1. Trennung der Bedeutungen durch Trennungsstriche und Numerierung mit
fettgedruckten arabischen Ziffern:
brauchen: 1. ... - 2. ... - 3. ...
Hinweise für den Benutzer 8
2.2.2. Trennung der Bedeutungen durch Trennungsstriche und Numerierung mit
fettgedruckten römischen Ziffern, wenn sich der Bedeutungsunterschied auch in
einem Wechsel der Betonung ausdrückt. Das Stichwort ist dabei in normaler
Schrift mit Angabe der jeweils zutreffenden Betonung wiederholt:
durchglühen: I. durchglühen: ... - II. durchglühen: ...
2.2.3. Die römisch numerierten Untergruppen können gegebenenfalls ihrerseits
noch durch arabische Ziffern unterteilt sein:
durchziehen: I. durchziehen: 1. ... - 2. ... - II. durchziehen: 1. ... - 2. ...
2.2.4. Ist bei Dingwörtern mit dem Bedeutungsunterschied auch ein Wechsel
des Geschlechtswortes verbunden, so wird das Stichwort nach dem Trennungs-
strich in Fettdruck wiederholt:
Band, das: 1. ... - 2. ... - 3. ... - Band, der: 1. ... — 2. ...
3. Form des Stichwortes innerhalb des Stichwortartikels
3.1. In den als Beispiele aufgeführten Wendungen ist das Stichwort abgekürzt,
d.h., es ist nur sein Anfangsbuchstabe mit dem Abkürzungspunkt wiedergegeben.
Das gilt jedoch nur in den Fällen, in denen die Textform völlig mit der Form des
fettgedruckten Stichwortes übereinstimmt:
Abend, der: ein stiller A.; am A.
abends: [um] 18 Uhr a.; morgens und a.
Aber nicht abgekürzt sind:
des Abends; drei Abende lang
3.2. Eine Ausnahme bilden in den Wendungen die Mehrzah lformen der Ding-
wörter, die mit dem Werfall der Einzahl übereinstimmen. Um Unklarheiten und
Mißverständnisse zu vermeiden, ist hier die Mehrzahlform trotz Formgleichheit mit
dem fettgedruckten Stichwort in den Beispielen ausgeschrieben.
3.3. Ebenfalls ausgeschrieben sind im Text die Stichwörter mit weniger als
drei Buchstaben.
3.4.1. Bei Stichwörtern, die in zwei Formen üblich sind, bedeutet die abge-
kürzte Form, daß beide Formen wahlweise verwendet werden können:
nutzen / nützen: das Werk soll vielen Menschen n.
3.4.2. Soll in einzelnen Wendungen nur eine der beiden Formen gelten, so ist diese
im Textbeispiel ausgeschrieben:
darin (umg-. drin): wirf den Kasten weg, es ist nichts mehr d.; darin hast du dich geirrt;
das ist nicht [mehr] drin (umg)
3.4.3. Das gilt sinngemäß auch bei Zusammenfassung zweier Stichwortformen mit
Hilfe von eckigen Klammern:
Unwille[n], der: sein U. richtet sich nicht gegen dich; jmds. Unwillen hervorrufen