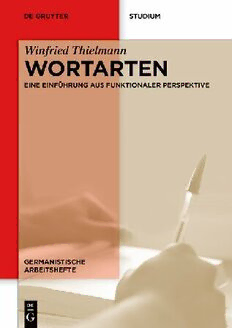Table Of ContentWinfried Thielmann
Wortarten
Germanistische
Arbeitshefte
Herausgegeben von
Thomas Gloning und Jörg Kilian
Band 49
Winfried Thielmann
Wortarten
Eine Einführung aus funktionaler Perspektive
Wissenschaftlicher Beirat zu diesem Band:
Prof. Dr. Ludger Hoffmann (Dortmund)
ISBN 978-3-11-066794-3
e-ISBN (PDF) 978-3-11-066796-7
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-066816-2
ISSN 0344-6697
Library of Congress Control Number: 2021930943
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
www.degruyter.com
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
auf der Beliebtheitsskala schulischer Gegenstände rangieren die Wortarten sicher
noch lange nach den binomischen Formeln in der Mathematik oder dem stöchiomet-
rischen Rechnen in der Chemie. Die Wortarten sind verbunden mit Aufgabenstellun-
gen wie ‚unterstreiche alle Verben im Text‘ etc. – das hat man dann gemacht, richtig
oder falsch, und sich gefragt: Wozu mache ich das eigentlich? Darauf gab es dann
keine Antwort. Und so wurde eine der wichtigsten Fragen überhaupt gleich wieder
beerdigt, nämlich: Wie funktioniert Sprache?
Dieses Buch, liebe Leserin, lieber Leser, könnte für uns beide eine Chance sein:
Für Sie, weil Sie hier vielleicht etwas über Sprache erfahren, was Sie nützlich finden
könnten. Für mich, weil es mir die Möglichkeit gibt, Sie in das wichtigste und aufre-
gendste Artefakt des Menschen einzuführen: Sprache an sich und eine ihrer spezifi-
schen Ausprägungen, das Deutsche.
Über alles Lebendige auf diesem Planeten können wir eines sagen: Wenn es
spricht, ist es menschlich. Wenn es nicht spricht, ist es sicher vieles, aber nicht
menschlich. Sprache stiftet Gemeinschaft. Durch Sprache übermitteln und speichern
wir Wissen. Wir lassen durch Sprache andere an unseren Erfahrungen teilhaben.
Durch Sprache erreichen wir, dass jemand uns verzeiht, sich in Acht nimmt, etwas
versteht oder sich etwas vorstellen kann. Durch Sprache erreichen wir etwas bei un-
serem Hörer (oder Leser). Dies macht Sprache, wie der Sprachwissenschaftler Karl
Bühler gesagt hat, zum Werkzeug (Organon).
Der Blick auf Sprache, zu dem ich Ihnen mit diesem Buch verhelfen möchte, ist,
dass Sprache, als Artefakt des Menschen, dazu da ist, es Sprechern1 (oder Schreibern)
zu ermöglichen, bei Hörern (oder Lesern) etwas zu erreichen. Sprache, als ein hoch-
komplexes Werkzeug (das komplexeste, das es überhaupt gibt), besteht aus vielen,
vielen Einzelwerkzeugen, den sprachlichen Mitteln. Und die kommen in verschiede-
nen Ausführungen. – In einem großen Werkzeugkasten gibt es verschiedene Häm-
mer, Schraubenschlüssel, Zangen, Nägel, Schrauben, Dübel und Haken. Allen Häm-
mern ist es gemein – so unterschiedlich sie auch sein mögen – dass sie zum Hämmern
da sind. Aber sie schlagen mit einem Vorschlaghammer keinen Nagel in die Wand,
der ein Bild halten soll. Allen Zangen ist es gemein, dass man mit ihnen verschiede-
nes greift. Aber Sie werden wahrscheinlich keine Rohrzange nehmen, wenn Sie einen
Nagel aus der Wand ziehen wollen.
||
1 Ich verwende das sogenannte generische Maskulinum grundsätzlich dort, wo es um die allgemeine
Benennung von Handelnden (z.B. Sprecher, Hörer, Leser) oder Personengruppen (z.B. Teilnehmer)
geht. Die Gründe hierfür habe ich in Abschnitt 2.2.2 dargelegt.
https://doi.org/10.1515/9783110667967-202
VI | Vorwort
Mit den sprachlichen Werkzeugen ist das auch so. Allen Nennwörtern (Tisch, es-
sen, schön) ist es gemein, dass man mit ihnen etwas benennt (z.B. Gegenstände,
Handlungen oder Eigenschaften). Aber welches Mittel wir genau wählen, hängt da-
von ab, was genau wir beim Hörer damit erreichen wollen. Wenn ein Autor schreibt
Anna fuhr die Rolltreppe herab, stehen Sie als Leser in Ihrer Vorstellung unten an der
Rolltreppe und sehen Anna auf sich zukommen. Schreibt der Autor dagegen Anna
fuhr die Rolltreppe hinab, stehen Sie in Ihrer Vorstellung oben an der Rolltreppe und
sehen Annas Rücken. Dieser Unterschied wird allein durch hin bzw. her erreicht –
sprachliche Werkzeuge, die nichts benennen, sondern Richtungen zeigen (her auf
den Sprecher zu; hin vom Sprecher weg).
Der Sinn dieses Buches ist es also nicht, dass Sie irgendwann sagen können,
„dies und das ist ein Verb“, als ob damit schon etwas gesagt sei, sondern dass Sie
wissen, was für Verben es gibt und wozu sie gut sind, was also Sprecher bei Hörern
mit Ausdrücken dieser Art erreichen können.
Ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der weiß, wie Sprache funktioniert,
Gesprochenes und Geschriebenes tiefer auffasst und besser sowie differenzierter, d.h.
hörer- und leserbezogener, kommuniziert. Wissen über Sprache ist kein Selbstzweck.
Es hilft Ihnen in Studium und Beruf, besonders, wenn Sie selber Sprache unterrich-
ten.
Ich habe mich bemüht, das Buch so zu gestalten, dass es zwei Arten von Lektüren
ermöglicht: Vom Anfang bis zum Ende (was ich mir sehr wünschen würde) oder nach-
schlagend, wenn Sie sich z.B. über eine bestimmte Wortart informieren möchten (was
natürlich auch sehr schön wäre).
Aber auch wenn Sie das Buch nachschlagend verwenden, möchte ich Ihnen drin-
gend nahelegen, das erste Kapitel (Wortarten – wo ist das Problem?) ganz zu lesen.
Denn in diesem Kapitel spreche ich darüber, woher die Wortartenbestimmungen
kommen, über Wortarten in anderen Sprachen und über die spezifischen Probleme,
die bei einer Bestimmung und Charakterisierung der Wortarten des Deutschen aufge-
treten sind und Sprachwissenschaftler bis heute beschäftigen. Das erste Kapitel ent-
hält sozusagen die ‚Denke‘, die diesem Buch zugrundeliegt, und erklärt seine Syste-
matik. Im Falle einer nachschlagenden Lektüre möchte ich Ihnen außerdem
empfehlen, das Kapitel 2.1 (Das Verhalten von Nennwörtern im Satz) sowie das Kapitel
2.2.5 (Syntax des Substantivs) zur Kenntnis zu nehmen, da ich hier wichtige gramma-
tische Grundbegriffe (Subjekt, Prädikat, Attribut etc.) erläutere, ohne die man nicht
beschreiben kann, wozu Wörter einer bestimmten Wortart gut sind.
Durch das ganze Buch hindurch finden Sie immer Übungsaufgaben in Kästchen,
die am Rand mit einem Fragezeichen bezeichnet sind, zu denen es am Ende des Bu-
ches Lösungen gibt. Im ersten Kapitel befinden sich vier kurze Zusammenfassungen,
die am Rande durch ein Icon ausgewiesen sind, das einen schreibenden Stift dar-
stellt. Beides soll Ihnen helfen, über das Gesagte nachzudenken und es sich zu mer-
ken.
Vorwort | VII
Die Beispiele, an denen ich sprachliche Sachverhalte demonstriere, sind von
zweierlei Art: Viele sind von der typischen Langweiligkeit, deren einziges Verdienst
es ist, grammatische Sachverhalte deutlich zu machen (z.B. Peter repariert einen Com-
puter); dabei sind inakzeptable Beispiele durch einen Stern (*) gekennzeichnet (z.B.
*Er warf die geblühte Rose weg). Etliche Beispiele sind aber auch authentische Belege
aus Gesprächen oder schriftlichen Texten (z.B. Sie ham s doch gemacht!), an denen
sich wichtige Aspekte sprachlichen Handelns zeigen lassen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei der Lektüre dieses Buches nicht nur
den Eindruck hätten, dass es Ihnen etwas bringt, sondern auch einen Teil desjenigen
Vergnügens verspüren würden, das ich beim Schreiben hatte.
Chemnitz, 22.10.2020 Winfried Thielmann
Inhalt
1 Wortarten – wo ist das Problem? | 1
1.1 Wortarten als Problem: Englisch und Inuktitut | 1
1.2 Wortarten als Problemlösung: die antike Grammatikschreibung | 3
1.2.1 Technē grammatikē – eine Grammatik für Altgriechisch als
Fremdsprache | 3
1.2.2 Die Ars minor des Donat – ein Schuh für alle Füße? | 6
1.2.3 Analytische Sedimente – warum der Schuh manchmal drückt | 9
1.3 Den Schuh passend machen – linguistische Ansätze | 13
1.3.1 Sprachwissenschaftliche Kritik und Lösungsversuche | 13
1.3.1.1 Wundersame Artikelvermehrung – Probleme bei der syntaktischen
Einteilung von Wortarten | 14
1.3.1.2 Wundersame Wortartenverminderung – Probleme bei der
kategorialgrammatischen Einteilung von Wortarten | 16
1.3.1.3 BIG in allen Sprachen – Versuch einer semantischen Einteilung | 16
1.3.1.4 Wortarten in Universaler Grammatik | 17
1.4 Funktionale Sprachbetrachtung | 19
1.4.1 Sprachliche Felder | 21
1.4.1.1 Das Symbolfeld | 23
1.4.1.2 Das Zeigfeld | 23
1.4.1.3 Das Operationsfeld | 24
1.4.1.4 Das Lenkfeld (expeditives Feld) | 24
1.4.1.5 Das Malfeld | 25
1.4.2 Anwendungen des Felderkonzepts | 25
1.4.2.1 Prozedurenkombinationen und pure Symbolfeldausdrücke | 25
1.4.2.2 Feldtransposition – die angeschlagene Teekanne als
Blumentopf | 26
1.5 Zusammenfassung | 27
1.6 Aufbau des Arbeitsheftes | 28
2 Nennwörter | 31
2.1 Das Verhalten von Nennwörtern im Satz | 31
2.1.1 Die Satzform beim sprachlichen Handeln | 31
2.1.2 Komplexere Sätze | 33
2.1.3 Kasusflexive und ihre Funktion | 34
2.1.4 Die topologische Satzstruktur | 36
2.1.5 Der Aufbau sprachlicher Handlungen aus sprachlichen
Prozeduren | 39
2.2 Substantive | 41
2.2.1 Substantiv oder Nomen? | 42