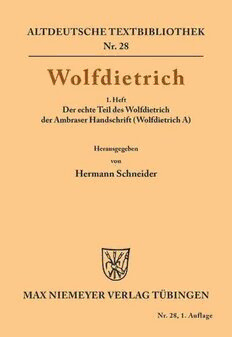Table Of ContentWolfdietrich
1. Heft
Der echte Teil des Wolfdietrich
der Ambraser Handschrift (Wolfdietrich A)
Herausgegeben
von
Hermann Schneider
( \
mJN
Max Niemeyer Verlag
Halle (Saale)
1981
Alle Rechte,
auch das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten
Copyright by Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale), 1931
Printed in Germany
Altdeutsche Textbibliothek, begründet von H. Paul f,
herausgegeben von G. Baesecke
nr. 28
Druck yon Karras, Kröber A Nietschmann Halle (Saale)
Meiner Frau
als Gegengabe zum 14. Oktober
Einleitung.
Die Gedichte von Wolfdietrich bilden eine mächtige
Epensippe, an der fast das ganze 13. Jahrhundert ge-
arbeitet hat. Anspielungen und Bearbeitungen beweisen,
daß ihre Popularität bis nach 1600 ungeschwächt an-
hielt. Die stoffliche Grundlage sucht man in der
fränkischen Geschichte des 6. Jahrhunderts. Theuderich
(Dietrich), zugenannt Wolf, der Verbannte, der Sohn
Chlodwigs (auch Huga geheißen, daher Hug-Dietrich)
wurde um 600 von einem Dichter in den Mittelpunkt
eines Heldenlieds gestellt, das viele historische Züge
der Zeit festhielt: Chlodwigs, des Heiden, Vermählung
mit einer christlichen Fürstin ; Thronstreitigkeiten im
merovingischen Hause, wobei königliche Brüder einander
uneheliche Geburt vorwarfen; den Majordomus oder
Meister als treuen Parteigänger bedrohter junger Erb-
herrn (sogar Namen wie Berhtarius begegnen). Es
scheint, daß das Motiv der Dienstmannentreue samt dem
der Landflucht, das ja schon der Beiname Wolf verbürgt,
das Rückgrat des ganzen Liedes gebildet hat: die Brüder
trieben den vermeintlichen Bastard aus, der Meister mit
seinen Söhnen hielt ihm die Treue, er selbst bewahrte
in der Fremde das Andenken an sie und befreite und
belohnte sie heimkehrend.
Im zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, bald nach
Iwein und Tristan, wurde aus diesem alten Heldenlied
ein Epos. Der Dichter versah es mit einem neuen
Schluß und schöpfte dabei aus dem niederdeutschen
Lied von König Ortnid von Garda (d. h. ursprünglich
von Rußland, später dachte man an den Gardasee).
VI
Yon diesem Ort nid wurde erzählt, er habe sich eine
heidnische Prinzessin über See zur Gattin geholt, sei
aber dann im Kampf gegen einen Drachen gefallen.
Wolfdietrich wird nun zum Rächer und Nachfolger Ortnids
gemacht, und seine Landflucht führt nach Italien. Seine
alte Heimat, Frankreich, hat er schon in Merovinger-
zeiten zugunsten Ostroms aufgegeben, und sein Meister
Berchtung ist nach Meran, d. h. Maronia in Istrien über-
gesiedelt.
Das älteste Wolfdietrichepos besitzen wir nicht mehr,
wohl aber eine Reihe von Bearbeitungen, Nachahmungen,
Fortsetzungen, die alle irgendwie mit ihm zusammen-
hängen. Viele Zwischenglieder sind verloren, so daß
ein ganz sicherer Stammbaum nicht aufgestellt werden
kann. Für uns gliedert sich die Überlieferung in vier
Eauptstränge, die wir als Wolfdietrich A, B, C, D zu
bezeichnen pflegen. A (Wolfdietrich von Konstantinopel)
steht zeitlich an der Spitze und berührt sich trotz großer
Selbständigkeit im einzelnen wohl noch am nächsten
mit dem ältesten Gedicht. Als Vorspiel ist ihm ein
selbständiges Epos von Ortnid vorausgeschickt, das die
gesamte Lebensgeschichte des Königs von Lamparten
aus dem ältesten Woldietrichepos und aus den Ortnid-
liedern herausspinnt. Wolfdietrich Β (von Saloniki) gibt
eine ganz selbständige Kindheitsgeschichte und ist im
übrigen ein Auszug aus einem älteren, verlorenen Ge-
dicht, das das Handlungsschema gewaltig weitete und
die Geschichte Ortnids mithereinbezog. Wolfdietrich C
(von Athen) kennen wir nur ganz lückenhaft. Es ver-
fährt mit dem Stoff sehr selbständig und findet seine
Hauptstärke in der Einfügung von Episoden, die höfische
Tendenzen zeigen. Wolfdietrich D ist eine große
Kompilation aus drei verschiedenen Gedichten, B, C
und einem Verwandten der Vorlage B's. Es ist nächst
dem Nibelungenlied das umfangreichste aller Helden-
epen. 1)
Ich habe s. Zt. den Stammbaum so angenommen wie
das Schema zeigt:
VII
Zwischen 1855 und 1871 sind fast alle Wolfdietrich-
texte herausgegeben worden, die meisten zweimal. Nach-
dem v. d. Hagen bereits 1811 den wertlosesten Text K,
den des Dresdner Heldenbuches, veröffentlicht hatte,
erschienen 1855 im ersten Band seines ,Heldenbuches'
Ortnid, Wolfdietrich Α, Β und C. 1865 folgte der ,große
Wolfdietrich' durch Holtzmann, 1867 der Text des ge-
druckten Heldenbuchs (Ortnid D und Wolfdietrich D)
durch Keller. Die maßgebende Publikation findet sich
im dritten und vierten Band von Müllenhoffs deutschem
Heldenbuch, 1871—73. (Ortnid A, B, C; D nicht voll-
ständig und daher nur mit Beiziehung Holtzmanns zu
benutzen). Da diese Ausgaben nur zum Teil für philo-
logische Arbeit zureichend und allesamt vergriffen sind,
rechtfertigt sich eine neue Edition ohne weiteres; sie
soll vor allem dem Lernenden die Gattung des Helden-
epos näherbringen und ihn vor einseitiger Auffassung
der mhd. Dichtformen bewahren.
Q* (ältestes Epos)
/ \
*Y *X
will aber jetzt schon darauf hinweisen, daß er sich nach
den noch unveröffentlichten Untersuchungen meines Schülers
Brestowsky etwas vereinfachen läßt. Das Nähere findet sich
in meinem Bach: Die Gedichte nnd die Sage von Wolfdietrich,
München 1913. — Seitdem haben speziell über Wolfdietrich A
noch gehandelt W. Haupt, Zur nd. Dietrichsage, 1914, S. 251 ff.:
Mock, Untersuchungen zu Ortnid und Wolfdietrich, Bonner
Diss. 1921 (Auszug); Hempel, Nibelungenstudien I, Heidelberg
1926, S. 155 flf.
vin
Das Gedicht Wolfdietrich A ist unvollendet ge-
blieben. Es bricht nach etwa 500 Strophen ab. Man
hat es fortgesetzt (A), wohl noch in der ersten Hälfte
2
des 13. Jhdts., und nahm das Material dazu vermutlich
aus der Vorlage von B. Die ziemlich stümperhafte
Reimerei ist in unserer Ausgabe nicht mit aufgenommen,
zumal auch sie die Abenteuer des Helden nur ein Stück
weiter bringt und nicht zu Ende führt. Wie der Fort-
setzer fernerhin verfahren ist, das wissen wir nur aus
dem späten Auszug im Dresdner Heldenbuch.
Wir suchen uns mit der Eigenart des Gedichtes
Wolfdietrich A bekanntzumachen.
Zunächst ist zu fragen: was fand der Dichter vor?
Nach unserer Annahme jenes älteste Wolfdietrichepo6,
das ja mehr war als eine bloße epische Streckung des
Wolfdietrichliedes. Es hatte das Schwergewicht des
Stoffes verschoben und Wolfdietrich zum Drachenkämpfer,
Rächer und Nachfolger Ortnids gemacht. Die alte lied-
hafte Wolfdietrichhandlung muß dabei in ihrem zweiten
Teil stark umgebogen oder ganz ersetzt worden sein.
Diese Umformung interessiert uns hier aber nicht. Denn
der Verfasser des ursprünglichen Teils von A hat seinen
Helden nur bis in die Wüste Romanie geleitet und von
dort aus noch nicht einmal einen Ausblick auf das
Reiseziel Italien eröffnet (die Strophen 504/5 gehören
schon dem Portsetzer). So ist hier nur zu untersuchen,
was die Vorlage für die Motivkomplexe: Kindheits-
geschichte und Bruderzwist geboten hat.
Die Jugendgeschichte ist, wie wir schon wissen,
in drei verschiedenen Fassungen überkommen. Sie alle
haben den Zweck, den nicht mehr verstandenen Bei-
namen des Helden „Wolf" zu erklären. Das geschieht
in den Redaktionen Α, Β und C auf so grundverschiedene
Art, daß eine gemeinsame Vorlage nicht zu erschließen
ist. Das älteste Wolfdietrichepos wußte offenbar nichts
von einem Wolfsabenteuer, und drei Dichter haben sich
im Laufe des 13. Jhdts. ganz unabhängig voneinander
die Aufgabe gestellt, es dem jungen Dietrich an-
zuheften.
IX
Die Jugendgeschichte in Β berichtet überdem die
Liebesabenteuer von Wolfdietrichs Eltern, die von C
eine Anzahl früher Kriegstaten des Helden, der sich aus
einer Wolfshöhle glücklich wieder nach Hause gefunden
hat. Das sind alles junge Romanerfindungen. Einzig
A weist im Rahmen der Kindheitsgeschichte Züge auf,
die im Dienst der späteren Handlung stehen und ziel-
bewußt auf den zweiten Programmpunkt des Epos hin-
weisen: den Ausbruch des Sippenzwists. Hier allein
knüpft der Dichter an Altüberkommenes an.
Wir wissen, daß dem fränkischen Dietrich schon früh
ein Saben zur Seite stand (Seafola in dem englischen
Gedicht Vidsith des 8. Jhdts.), und da die Meisterfigur
zu den ältesten geschichtlichen Gestalten des Lieds gehört,
wird wohl auch der Gegensatz: Berchtung der Getreue,
Saben der Ungetreue aus merovingischer Frühzeit stammen.
Saben macht sich zum Träger des alten Bastardvorwurfs,
er verleumdet den kleinen Wolfdietrich bei Hugdietrich,
Berchtung tritt für ihn ein. Das ist sicher ein uraltes
Motiv. Leider aber ist es nicht in alter szenischer
Formung überkommen.
Das entnehmen wir allen Angaben: der Zwist
zwischen Vater und Sohn war dem alten Lied nicht die
Hauptsache, höchstens ein Vorspiel. Der eigentliche
Konflikt trennte Wolfdietrich und seine Brüder. Und
da nahmen Berchtung und seine Söhneschar mit be-
waffneter Hand für Wolfdietrich Partei. Sie unterlagen,
und Wolfdietrich ward landflüchtig. Hier hat das früheste
Buchgedicht (,Ql) noch das Handlungsschema des alten
Lieds geteilt; aber leider wird seine Darstellung nirgends
mehr deutlich. Dachte sich schon der erste Epiker die
Belagerung Lilienports aus und erzählte von Wolfdietrichs
kühnem Ausbruch ? — Mit Sicherheit können wir für
das frühere Werk lediglich zwei Szenen feststellen.
Erstens: Berchtung verliert in der Schlacht gegen die
Brüder eine Anzahl seiner Söhne, Wolfdietrich erfährt
das und sein Leid ist so groß, daß es ihn beinahe zum
Selbstmord treibt. Zweitens: als Wolfdietrich das Land
verläßt, um auswärts Hilfe zn suchen, da waffnet ihn
χ
der Meister mit des Vaters Brünne und Schwert und
gibt ihm des Vaters Roß. Fest steht auch der Abschluß
der Szene, das Treugelöbnis Wolfdietrichs : er will nicht
ruhen noch rasten und nicht Weibesliebe genießen, bis
er seine elf Dienstmannen befreit hat.
Ein Reiseabenteuer führte wohl schon den Wolf-
dietrich des ersten Epos mit einem wilden Weibe zu-
sammen; nur läßt sich nicht sicher sagen, ob diese
Begegnung von jeher die Reihe der Fahrterlebnisse
eröffnet hat. Aber es verlief wohl immer friedlich und
blieb daher pointelos. War sein Zweck ehemals, wie
jetzt in A, Wolfdietrichs Standhaftigkeit den Frauen
gegenüber zu erproben, so haben sich spätere Bearbeiter
wunderlich genug an dem Abenteuer vergriffen.
Gegenüber diesem Gemeingut der Wolfdietrich-
fassungen, das auf die älteste epische Quelle zurück-
weist, erscheint die Reihe der in A neugeschaffenen
Szenen und Episoden sehr beträchtlich. In der Tat hat
unser Dichter als erster und eigentlich auch als einziger
die Aufgabe erkannt und gelöst, der Jugendgeschichte
des Helden wirklich organische epische Form zu ver-
leihen.
Vielerlei Vorlagen halfen ihm zur Weitung und Auf-
füllung des engen Inhaltsschemas, das ihm überkommen
war. Aber es verhält sich mit ihnen so, wie oft bei
mittelalterlichen Dichtungen, namentlich unhöfischen
Schlages: wir vermögen meist nicht eine wirkliche Vor-
lage, ein bestimmtes literarisches Erzähl werk, sondern
nur typische Vorbilder zu nennen, literarisch nicht
greifbare Erzählschemata, in die der mittelalterliche
Poet bei gegebener Gelegenheit immer wieder einlenken
wird.
Zwar, der Dichter wollte ja ein Buchepos für ritter-
liche Kreise schreiben und wurde dadurch zur Verwertung
der benachbarten heldenepischen Literatur angehalten;
unvermeidlich, daß sie da und dort eine Spur hinterließ.
Am deutlichsten wirkte ein Epos von Dietrich von Bern
ein, das damals viel gelesen und benutzt wurde. Der
böse Saben hat manches von seinem berüchtigten Vorbild,