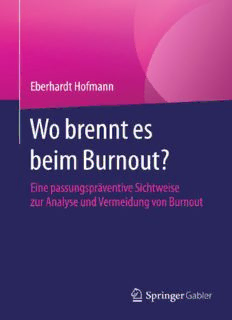Table Of ContentWo brennt es beim Burnout?
Eberhardt Hofmann
Wo brennt es beim Burnout?
Eine passungspräventive Sichtweise zur
Analyse und Vermeidung von Burnout
Eberhardt Hofmann
Friedrichshafen, Deutschland
ISBN 978-3-658-08591-9 ISBN 978-3-658-08592-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-08592-6
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich
vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem
Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder
die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler
oder Äußerungen.
Lektorat: Stefanie A. Winter
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung und Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Burnout: Alter Wein in neuen Schläuchen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Burnout als Krankheit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 W as macht den Begriff Burnout so attraktiv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Eine brauchbare Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Warum gerade jetzt? Änderungen in der Arbeits- und Lebenswelt . . . . . . . 15
3.1 Das Projekt „Humanisierung der Arbeitswelt“ (HdA) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Atypische Beschäftigungsverhältnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3 Leistung und Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4 Einkommen und Arbeitszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5 Meritokratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.6 Multitasking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.7 Inflation der „Kompetenzen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.8 Unendliche Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.9 Hyperidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.10 Die Krankheiten des „Zuviel“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.11 Soziale Beschleunigung – veränderte Raum- und Zeitwahrnehmung . . . . . 27
3.12 Die Bedeutung dieser Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 Beschreibung der Stressreaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1 Wie verändert sich unser Körper bei Bedrohungen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Bedrohungen früher und heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.3 Kurz- und langfristige Konsequenzen der Nichtpassung . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.1 Unmittelbare Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3.2 Langfristige Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4 Welche Ereignisse wirken besonders im beruflichen
Kontext als Stressoren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
V
VI Inhaltsverzeichnis
4.5 Psychische Belastung und psychische Beanspruchung . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.5.1 Eine Analogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.6 A nwendung auf die Arbeitssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.6.1 Quantitative Überlastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.6.2 Qualitative Überlastung durch Nichtpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5 Die Passung zwischen Tätigkeitsstruktur und persönlicher Orientierung . . . 53
5.1 Die Struktur allgemeiner Aufgaben und allgemeiner Orientierungen . . . . . 53
5.1.1 Die RIASEC-Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1.2 Der RIASEC-Code der Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.1.3 Der RIASEC-Code der Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.1.4 V ergleich von persönlicher Orientierung und der
Struktur der Tätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.5 Fehlpassungen der RIASEC-Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.1.6 W as bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Führungstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2.1 Die idealistische und die deskriptiv-triviale
Auffassung von Führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2.2 Dilemmata im Führungsalltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.3 Das Konzept der Karriereanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.4 W as bedeutet das für das Thema „Burnout“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.3 Strukturell unterschiedliche Anforderungen auf
verschiedenen Führungsebenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.3.1 Beschreibung der strukturellen Anforderungen der Ebenen . . . . . . 85
5.3.2 W as bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6 Idealtypische Gruppenmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.1 Grundtypen von Gruppenmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.1.1 Das Modell „Truppe“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.1.2 Das Modell „Gemeinschaft“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.1.3 Das Modell „New Economy“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.1.4 Das Modell „Haufen“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.2 Diagnose: Was ist Ihre Idealvorstellung von einem Team? . . . . . . . . . . . . . 93
6.3 Stärken und Schwächen der jeweiligen Gruppenarten . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.4 W as heißt „teamfähig“? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.5 W as bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.5.1 Das Team hat keine homogenen Vorstellungen
vom idealen Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.5.2 Die (homogene) Vorstellung des Teams passt
nicht zur eigenen Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Inhaltsverzeichnis VII
6.5.3 Die Art des wahrscheinlichsten Konfliktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.5.4 Normale und paradoxe Selektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7 Die Rolle der eigenen Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.1 Die Funktionssysteme der Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.1.1 Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.1.2 A utonomes Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.1.3 A utonome Kognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.1.4 A utonome Emotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.2 W as ist ein Verhaltens- und Kommunikationsstil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.3 Beschreibung der Verhaltens- und Kommunikationsstile . . . . . . . . . . . . . . 120
7.3.1 Der im Zweifelsfall eher zu selbstbezogene
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
7.3.2 Der im Zweifelsfall eher zu dramatisierende
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.3.3 Der im Zweifelsfalle eher zu gewissenhafte
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.3.4 Der im Zweifelsfalle eher zu lässig-kritische
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.3.5 Der im Zweifelsfalle eher zu rational-distanzierte
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7.3.6 Menschen mit einem rational-distanzierte
Verhaltens- und Kommunikationsstil und Burnout . . . . . . . . . . . . . 152
7.3.7 Der im Zweifelsfalle eher zu kooperative
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.3.8 Der im Zweifelsfalle eher zu sensibel-vermeidende
Verhaltens- und Kommunikationsstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.3.9 A bgrenzungen der Stile zueinander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.4 Praktische Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8 Soziale Konstellationen und Geführtwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.1 Das Stresspotenzial von Zweierkonstellationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.1.1 Einschränkung der Verhaltensvariabilität
in Konfliktsituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.1.2 V orhersehbare Sollbruchstellen in sozialen Konstellationen . . . . . . 168
8.1.3 Geführtwerden bedeutet Kontrollverlust für die Geführten . . . . . . . 172
8.1.4 W as bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.2 W as kann man nun tun, um die Qualität einer schwierigen
Konstellation zu entschärfen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
VIII Inhaltsverzeichnis
8.2.1 Möglichkeiten der Einflussnahme in schwierigen
Konstellationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.2.2 Was bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.3 Geführtwerden – die Legitimation von Führung und Macht . . . . . . . . . . . . 182
8.3.1 Die Begründungen des Führungsanspruchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.3.2 Die Rolle der Integrität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3.3 Macht durch Ohnmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.3.4 Erwerb der Legitimationsquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.3.5 Was bedeutet dies für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
9 Die Organisation als Rahmenbedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.1 Die Wesenselemente einer Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.2 Die Kultur einer Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
9.2.1 Machtdistanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.2.2 Individualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
9.2.3 Unsicherheitsvermeidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
9.2.4 Maskulinität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
9.2.5 Was bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
9.2.6 Informationen zur Kultur fremder Organisationen . . . . . . . . . . . . . 199
9.3 Die Rolle der Mikropolitik in der Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
9.3.1 Was ist Mikropolitik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
9.3.2 Warum gibt es Mikropolitik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.3.3 Beschreibung mikropolitischen Handelns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
9.3.4 Was bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
9.4 Die Kontingenz der Rückmeldung der Umwelt an die Organisation . . . . . 205
9.4.1 Was bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.5 Die Stellung der Organisation in ihrem Lebenszyklus . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.5.1 Was bedeutet das für das Thema Burnout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
9.6 Die gesellschaftliche Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
10 Zusammenfassung und Handlungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
10.1 Burnout als Folge von Nichtpassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
10.2 Stress- bzw. Burnout-Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
10.3 Ein lebenslanger Prozess der Optimierung der Passung . . . . . . . . . . . . . . . 217
10.3.1 V orgesetztenwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
10.3.2 Beförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
10.3.3 Neue Tätigkeit durch Aufkauf, Umstrukturierung etc. . . . . . . . . . . 218
10.4 Schwierigkeiten bei der klaren Sicht der Dinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
10.4.1 „Internes“ und „externes“ Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
10.4.2 Bewusste und unbewusste Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Inhaltsverzeichnis IX
10.5 V ersteckte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
10.6 Burnout und Selbstwertberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
10.7 Burnout und Glücksforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
10.7.1 Faktor Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
10.7.2 Faktor Geselligkeit/Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.7.3 Faktor Arbeit/materielle Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.7.4 Das Optimierungsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
10.7.5 Maximum und Optimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.7.6 Menschen ändern sich eher nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
1
Einführung und Überblick
Burnout ist allgegenwärtig, ständig werden neue Meldungen darüber veröffentlicht, wie
verbreitet Burnout ist, wie viele Krankheitstage dadurch verursacht werden und welcher
wirtschaftliche Schaden durch Burnout entsteht. Bei solchen Meldungen ist jedoch unge-
klärt, ob die Burnout-Häufigkeit tatsächlich zunimmt, ob man heute bei einer entsprechen-
den Problematik nur eher zum Arzt geht, ob psychische Probleme heute früher sichtbar
werden oder ob es heute leichter ist, über psychische Probleme zu reden. Bei der Beschäf-
tigung mit dem Thema Burnout nähert man sich in der Regel aus den folgenden Perspekti-
ven: einer individuellen Betrachtung, einer formal-diagnostischen Betrachtung oder einer
gesellschaftlichen Betrachtung.
Individuelle Annäherung
Man kann sich dem Thema Burnout als „Seelenbrand“ über individuelle Aussagen nähern.
Typische Selbstaussagen, die mit Burnout in Verbindung stehen, sind z. B.: „Ich habe an
nichts mehr Spaß“, „Alles ist sinnlos“, „Ich kann kaum schlafen“, „Ich bin am Ende“, „Ich
fühle mich wie gerädert“, „Mir ist alles zu viel“, „Mein Akku ist leer“, „Der alte Schwung
ist weg“, „Ich bin müde und verdrossen“, „Ich möchte nicht enden wie …“, „Die aktuelle
Situation geht an die Gesundheit“ etc. Der Grund für all diese Aussagen kann dabei natür-
lich auch ganz woanders liegen, es sind jedoch typische Aussagen von Menschen, die von
Burnout betroffen sind.
Formal-diagnostische Annäherung
Der inflationäre Gebrauch der (Selbst-)Diagnose Burnout steht in einem gewissen Ge-
gensatz zur Eindeutigkeit der Beantwortung der Frage, was Burnout eigentlich ist. Der
Begriff Burnout wird oftmals als Sammelbegriff für alle Widrigkeiten, besonders in der
Arbeitswelt, verwendet. Was Burnout jedoch genau ist, weiß niemand, denn es gibt keine
einheitliche Definition und keine allgemeinverbindlich anerkannte Diagnose. Über die
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 1
E. Hofmann, Wo brennt es beim Burnout?, DOI 10.1007/978-3-658-08592-6_1