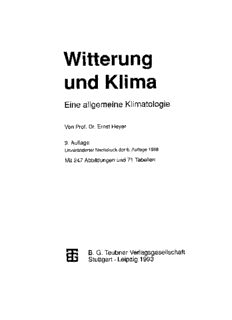Table Of ContentWitterung
und Klima
Eine allgemeine Klimatologie
Von Prof. Dr. Ernst Heyer
9. Auflage
Unveranderter Nachdruck der 8. Auflage 1988
Mit 247 Abbildungen und 71 Tabellen
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft
Stuttgart. Leipzig 1993
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Heyer, Ernst:
Witterung und Klima: eine allgemeine Klimatologie ; mit 71 Tabellen I
von Ernst Heyer. -9. Aufl., unverand. Nachdr. der 8. Aufl. -
Stuttgart; Leipzig: Teubner, 1993
ISBN-13: 978-3-8154-3016-3 e-ISBN-13: 978-3-322-83746-2
DOl: 10.1007/978-3-322-83746-2
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschOtzt. Jede Verwertung auBerhalb
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulassig und
strafbar. Das gilt besonders fOr Vervielfaltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Ein
speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© B. G. Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1993
Satz: Druckerei "G. W. Leibniz" GmbH, Grafenhainichen
Umschlaggestaltung: E. Kretschmer, Leipzig
Vorwort zur achten Auflage
Ais vor mehr als 20 Jahren die erste Auflage wenigstens hinzuweisen. Der Umfang der
von ..W itterung und Klima" erschien, wurde Klimatologie als Teil der Geowissenschaften
damit eine Reihe von Darstellungen aus dem hatte zur Folge, daB die vorliegende Dar
Bereich der Geowissenschaften fortgesetzt, stellung im wesentlichen auf das Makro
die mit "Die Oberflachenformen des festen klima beschrankt blieb, andere Teilgebiete der
Landes" begann und uber "Gewasser und Klimatologie dagegen nur mehr oder weniger
Wasserhaushalt des Festlandes" fiihrte. Nach angedeutet wurden, wobei allerdings Fragen
dem bei den bisher erschienenen weiteren der Geliindeklimatologie eine starkere Her
Auflagen nur geringfugige Veranderungen vorhebung erfuhren.
und Erganzungen vorgenommen wurden, er Die Zielstellung von "Witterung und Klima"
gab die in neuer Form erscheinende sechste wurde auch in der vorliegenden achten Auf
Auflage die Moglichkeit, groBere Verande lage beibehalten. Infolge der Neugestaltung
rungen vorzunehmen. Das betrifft insbeson des Buches konnten die neueren Ergebnisse
dere die erweiterte Darstellung der Klimate, der Klimatologie weitgehend dargestellt wer
wobei an anderen Stellen Kurzungen eintraten. den. Auch der Tabellenteil - Klimadaten fur
"Witterung und Klima" entstand als 'Ober die Periode 1931 bis 1960 - konnte erganzt
sicht uber die allgemeine Klimatologie aus werden.
Vorlesungen vor Studierenden der Geogra Bei der Auswahl der Literatur wurde - wie
phie. Es will insbesondere diesen Studieren bisher - auf Vollstandigkeit verzichtet, da
den eine Zusammenfassung dessen geben, was eine vollstandige Zusammenstellung der kli
sie auf dem Gebiet der Klimatologie benotigen. matologischen Literatur eine besondere Be
Diese Zielstellung bestimmte Auswahl und arbeitung erfordert hatte. Nach Moglichkeit
Zusammenstellung des gebotenen Stoffes. wurden solche Werke in das Literaturver
Aus den genannten Grunden wird im vorlie zeichnis aufgenommen, die ihrerseits um
genden Buch einerseits eine Darstellung der fangreiche Literaturzusammenstellungen ent
klimatologischen Elemente und Erscheinun halten.
gen in ihrer Verteilung, zum anderen aber Der Verfasser spricht allen, die durch Anregun
auch eine 'Obersicht uber eine Reihe von Kli gen und Hinweise an der Gestaltung des
maklassifikationen gegeben. Gleichzeitig war Buches mitwirkten, seinen Dank aus; dieser
eine Einfuhrung in die synoptische Meteoro Dank gebuhrt insbesondere dem Meteorolo
logie erforderlich, deren Grundtatsachen an gischen Dienst der Deutschen Demokrati
Hand der Wetterkarte dargestellt werden. schen Republik fur die 'Oberlassung von Bild
Die Tatsache, daB die Klimatologie, die Wis und Zahlenmaterial. Ein ganz besonderer
senschaft yom Klima, eng mit Fragen der Dank des Verfassers gilt dem Verlag und
Praxis verbunden ist, fuhrte dazu, auf An seinen Mitarbeitern fur die stets verstandnis
wendungen der Klimatologie in der Praxis volle Zusammenarbeit.
Potsdam, am 29. April 1987 Ernst Heyer
Inhalt
1. Einfiihrung, Klimadefinition ................................................. 7
2. Zusammensetzung und Aufbau der Atmosphare ............................... 12
2.1. ~estandteile der Atmosphare ................................................. 12
2.2. Erkundung der Atmosphare .................................................. 14
2.3. Stockwerke der Atmosphare .................................................. 15
3. Einfiihrung in die synoptische Meteorologie ................................. " 19
3.1. Wetterkarte ................................................................. 19
3.1.1. Bodenwetterkarte ................................................... " 20
3.1.2. Hohenwetterkarte .................................................... 23
3.2. Hochdruckgebietc ........................................................... 24
3.3. Luftmassen ................................................................. 25
3.4. Tiefdruckgebiete (Zyklonen) .................................................. 28
3.4.1. Lebenslauf einer Zyklone ............................................. " 28
3.4.2. Fronten ............................................................. 30
3.4.2.1. Warmfront ......................................................... 30
3.4.2.2. Kaltfront .......................................................... ·32
3.4.2.3. Okklusion ......................................................... 32
3.4.2.4. Wetterablauf beim Durchzug einer Zyklone ............................ 33
3.5. Grofiwetterlagen ............................................................ 36
3.6. Wettervorhersage .......................................................... " 44
3.6.1. Kurzfristvorhersagc ................................................. " 45
3.6.2. Mittel- und Langfristvorhersage ........................................ 46
4. Klimatologische Anwendungen der Synoptik ................................ " 48
4.1. Grofiwetterlagen, Luftmasscn und Luftkorper in Europa ........................ " 48
4.2. Grofiraumige Dbersichten .................................................... 50
4.3. Grundschicht der Troposphare ........ ,....................................... 52
5. Klimatologische Elemente und Erscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56
5.1. Strahlung .................................................................. 57
5.2. Temperatur ............................................................... " 67
5.2.1. Definition und Messung der Tempcratur .............................. '" 67
5.2.2. Temperaturwerte zur Kennzeichnung klimatischer Verhaltnisse ............. 70
5.2.3. Taglicher Gang der Temperatur ........................................ 72
5.2.4. Jahresgang der Temperatur ........................................... ..75
5.2.5. Abnahme der Lufttemperatur mit zunehmender Hohe (vertikale Temperatur-
verteilung) ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
5.2.6. Horizontale Temperaturverteilung ...................................... 84
5.3. Luftdruck und Wind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89
5.3.1. Definitionen und Messung ............................................. 89
5.3.2. Abhangigkeit des Windes yom Luftdruck .............................. " 91
5.3.3. Hohenabhangigkeit von Luftdruck und Wind ............................ 95
Inhalt 5
5.3.4. Tagesgang von Luftdruck und Wind " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97
5.3.5. Jahresgang von Luftdruck und Wind........ . .. .... .. ..... .. ............ 99
5.3.6. Verteilung von Luftdruck und Wind .................................... 101
5.3.7. Lokale Windsysteme .................................................. 106
5.3.8. Tropische Zyklonen .................................................. 109
5.4. Wasser in der Atmosphare ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
5.4.1. Wasserdampf ........................................................ 112
5.4.2. Bildung der Wolken .................................................. 115
5.4.3. Fohn ............................................................... 121
5.4.4. Klassifikation der Wolken ............................................. 123
5.4.5. Niederschlage ........................................................ 130
5.4.6. Taglicher und jlihrlicher Gang von Bewolkung und Niederschlag ........... 135
5.4.7. Verteilung der Bewolkung und der Niederschlage auf der Erde ............. 140
6. Allgemeine Zirkulation der Atmosphare 147
7. Einteilung und Verbreitung der Klimate 162
7.1. Einige Grundfragen der Klimaeinteilung ....................................... 162
7.2. Einteilungsmoglichkeiten der Klimate .......................................... 165
7.2.1. Gesamtklassifikationen ................................................ 165
7.2.2. Teilklassifikationen ................................................... 167
7.3. Einige Klimaeinteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169
7.3.1. Klimaeinteilung von W. Koppen ........................................ 169
7.3.2. Klimaeinteilung von C. E. Koeppe ...................................... 194
7.3.3. Klimaeinteilung von A. Penck ......................................... 199
7.3.4. Klimaeinteilung von N. Cre1ltzb1lrg ...................................... 201
7.3.5. Klimaeinteilung von C. Troll und K. H. Paffen ........................... 203
7.3.6. Klimaeinteilung von B. P. Alissow ...................................... 204
7.3.7. Klimaeinteilung von H. Flohn .......................................... 207
7.3.8. Klimaeinteilungen von E. K1Ipfer und E. Neef ............................ 208
7.3.9. Weitere Klimaeinteilungen ............................................. 210
7.4. Vergleich der Klimaeinteilungen .............................................. 211
7.5. Klimate der Kontinente und OZeane ........................................... 215
7.5.1. Afrika ............................................................... 215
7.5.2. Australien ........................................................... 216
7.5.3. Sudamerika .......................................................... 217
7.5.4. Nord- und Mittelamerika .............................................. 218
7.5.5. Europa .............................................................. 219
7.5.6. Asien ............................................................... 220
7.5.7. Antarktika .......................................................... 222
7.5.8. Ozeane ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222
7.5.9. Zusammenfassung .................................................... 223
8. Klimaanderungen und Klimaschwankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224
8.1. Rezente Klimaveranderungen ................................................. 225
8.2. Klimate in historischer und erdgeschichtlicher Zeit ............................ : .. 232
8.2.1. Klimazeugen ......................................................... 233
8.2.2. Ablauf des Klimas .................................................... 238
8.2.3. Ursachen fur Klimaveranderungen wahrend der Erdgeschichte ............. 246
6 Inhalt
9. Meso- und Mikroklima 251
9.1. Besonderheiten von Meso- und Mikroklima im Vergleich zum Makroklima ......... 251
9.2. Klima in der Nahe der Bodenoberflache ........................................ 252
9.2.1. Warmeumsatz in der bodennahen Luftschicht ............................ 252
9.2.2. Temperaturverhaltnisse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 256
9.2.3. Feuchtigkeit und Wind ................................................ 257
9.3. Einflufi der Unterlage auf das Mikroklima ...................................... 258
9.3.1. Einflufi des Bodens .................................................. 258
9.3.2. Einflufi von Wasserflachen ........................................... 260
9.3.3. Einflufi der Schneedecke .............................................. 261
9.3.4. Einflufi einer Rasendecke .............................................. 261
9.4. Mikroklimatischer Einflufi des Gelandes ........................................ 262
9.4.1. Bildung von Kaltluftseen .............................................. 262
9.4.2. Hangklima .......................................................... 263
9.5. Einflufi der Pflanzendecke auf das Mikroklima ................................... 265
9.5.1. Niedere Pflanzendecke ........................................... : .... 266
9.5.2. Einwirkung des Waldes ............................................... 267
9.5.3. Veranderung der Windverteilung durch die Vegetation .................... 269
9.6. Stadtklima als Beispiel eines Mesoklimas ........................................ 270
9.6.1. Stadtluft und ihre Verunreinigungen .................................... 271
9.6.2. Strahlung und Temperatur ............................................. 273
9.6.3. Windverhaltnisse ..................................................... 274
9.6.4. Bewolkung und Niederschlag .......................................... 275
9.7. Gelandeklimatologische Aufnahmc ............................................. 277
10. Einige Fragen der Phanologie ......................... , ..................... 278
10.1. Wirkung klimatischer Faktoren auf das Pflanzenwachstum· ., ..................... 278
10.1.1. Strahlung ........................................................... 278
10.1.2. Temperatur ......................................................... 279
10.1.3. Wind und Niederschlag .............................................. 281
10.2. Anwendung phanologischer Ergebnisse in der Klimatologie ...................... 281
10.2.1. Phanologie und Makroklima .......................................... 281
10.2.2. Phanologie und Mikro- bzw. Mcsoklima ................................ 283
10.2.3. Fragen der phanologischen Klimatologic ............................... 284
11. Anwendung klimatologischer Forschungsergebnisse .......................... 285
11.1. Agrarklimatologie .......................................................... 285
11.2. Bioklimatologie ............................................................ 288
11.3. Klima und Stadtebau ....................................................... 291
11.4. Klima und Technik .............................................. . . . . . . . . . .. 293
11.5. Veranderung des Klimas durch den Menschen .................................. 295
12. Aus der Geschichte der Klimatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 297
Literatur ...................................................................... 300
Klimadaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 304
Sachregister 338
Bildanhang
1. Einfiihrung, Klimadefinition
Das Wort Klima tritt bereits bei HIPPO J. F. SCHOUW gegeben: "Die Meteorologie ist
KRATES (460-375 v. u. Z.) auf. Es steht mit die Lehre von den Beschaffenheiten der Atmo
=
dem Wort "M'IIel'll neigen in Verbindung sphare im allgemeinen. Die Klimatologie ist
und weist somit darauf hin, daB die Erschei die geographische Meteorologie oder die
nungen, die im Begriff Klima zusammenge Lehre von den Beschaffenheiten der Atmo
faBt werden, auf die Neigung der Sonnen sphare in den verschiedenen Erdteilen. Die
strahlen, also auf deren Einfallswinkel zuriick letztere ist auch ein Teil der physischen Geo
zufiihren sind. graphie." (Zitiert nach K. SCHNEIDER-CARIUS,
Eine erste genauere Definition fand der Kli 1961).
mabegriff durch A. VON HUMBOLDT im Jahre An dieser Definition ist interessant, daB das
1831: "Das Wort Klima umfaBt in seiner all Zusammenwirken von Meteorologie und Geo
gemeinen Bedeutung aIle Veranderungen in graphie in der Klimatologie dargestellt wird,
der Atmosphare, von denen unsere Organe wobei gewissermaBen eine Abgrenzung der
merklich affiziert werden; solche sind: die Aufgaben beider Wissenschaften gegeben wird.
Temperatur, die Feuchtigkeit, die Verande Die Stellung der Klimatologie in Meteorologie
rungen des barometrischen Druckes, der und Geographie wird spaterhin noch Gegen
ruhige Luftzustand oder die Wirkungen un stand einer besonderen Betrachtung sein
gleichnamiger Winde, die Ladung oder die miissen.
GroBe der elektrischen Spannung, die Rein Eine Klimadefinition, die weite Verbreitung
heit der Atmosphare oder ihre Vermengung gefunden hat, wurde 1883 durch J. HANN ge
mit mehr oder minder ungesunden Gasaus geben und in spateren Jahren mehrfach wieder
haU'chungen, endlich der Grad eigentiimlicher holt: "Unter Klima verstehen wir die Gesamt
Durchsichtigkeit oder die Heiterkeit des he it der meteorologischen Erscheinungen, die
Himmels, welche durch den EinfluB, den sie den mittleren Zustand der Atmosphare an
nicht aIle in auf die Ausstrahlung des Bodens, irgendeiner Stelle der Erdoberflache kenn
auf die Entwicklung des pflanzlichen Organis zeichnen. Was wir Witterung nennen, ist nur
mus und die Zeitigung der Friichte, sondern eine Phase, ein einzelner Akt aus der Aufein
auch auf samtliche Eindriicke ausiibt, die die anderfolge der Erscheinungen, deren voller,
Seele vermittels der Sinne in den verschieden Jahr fiir Jahr mehr oder minder gleichartiger
sten Zonen aufnimmt, so wichtig ist." (Zitiert Ablauf das Klima eines Ortes bildet. Das
nach K. SCHNEIDER-CARIUS, 1961). Klima ist die Gesamtheit der Witterungen
In dieser Definition sind aIle Elemente und eines langeren oder kiirzeren Zeitabschnittes,
Erscheinungen zusammengesteUt, die das Kli wie sie durchschnittlich zu dieser Zeit des
ma kennzeichnen, und es wird eine zahlen Jahres einzutreten pflegen." (Zitiert nach
mafiige Beschreibung und Feststellung von K. SCHNEIDER-CARIUS, 1961.)
GroBen gefordert, die physikalisch definiert Auch W. KOPPEN wiederholt seine 1906 ge
sind. Wenn dabei der Mensch sehr stark in den gebene Klimadefinition mehrfach: "U nter
Vordergrund der Betrachtung geriickt wird, Klima verstehen wir den mittleren Zustand
so ergibt sich in der Definition die Blickrich und gewohnlichen Verlauf der Witterung an
tung der Bioklimatologie, eines Zweiges der einem gegebenen Orte. Die Witterung andert
Klimatologie. Es sei berperkt, daB die Herein sich, wahrend das Klima bleibt." (Zitiert nach
nahme der Luftverunreinigungen, also des K. SCHNEIDER-CARIUS, 1961).
Aerosols, in die Klimadefinition durchaus mo SchlieBlich sei eine Klimadefinition aus neuerer
dern anmutet. Zeit angefiihrt, die - in Erweiterung der De
Eine andere Klimadefinition, die etwa aus der finition W. KOPPENS - auch den Zeitfaktor,
gleichen Zeit stammt, wurde 1827 von also das Auftreten von Klimaanderungen und
8 1. Einfiihrung. Klimadefinition
Klimaschwankungen, beriicksichtigt. V. CoN Das Klima stel1t entsprechend den vorher an
RAD (1936) definiert: "Unter Klima verstehen gefiihrten Definitionen eine weitere Veral1ge
wir den mittleren Zustand der Atmosphare meinerung dar. Durch das Klima wird ein
iiber einem bestimmten Erdort, bezogen auf mittlerer Witterungsablauf gekennzeichnet und
eine bestimmte Zeitepoche, mit Riicksicht auf beschrieben.
die mittleren und extremen Veranderungen, Die Begriffe Wetter, Witterung und Klima
denen die zeitlich und ortlich definierten atmo enthalten zunachst keine raumliche Beschran
spharischen Zustande unterworfen sind." kung. Al1erdings wird man beim Wetter zuerst
In den bisher genannten Klimadefinitionen nur an einen Ort, in zweiter Linie an ein gro
trat neben dem Begriff Klima mehrfach der Geres Gebiet denken. Man kann also die er
BegriffWitterung auf, mit dem seinerseits wie wahnten Begriffe im allgemeinen sowohl auf
der der Begriff Wetter in enger Verbindung einzelne Orte wie auf groGere Gebiete, schlieG
steht. Es wird somit notwendig, diese drei Be lich auf Erdteile oder noch groGere Gebiete der
griffe gegeneinander abzugrenzen bzw. die Erdober£lache anwenden. Dabei hat die GroGe
zwischen ihnen bestehenden Verbindungen des betracht;ten Gebietes insofern einen Ein
festzustellen. £luG auf die Genauigkeit der Angaben, als die
Ais Wetter bezeichnet man den augenblick Darstellungen' 'urn so eingehender sein wer
lichen Zustand der Atmosphace, wie er durch den, je kleiner das betrachtete Gebiet ist. wah
die GroGe der meteorologischen Elemente - rend groGe Gebiete zu Verallgemeinerungen
wie Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewol AniaG geben.
kung, Niederschlag - und ihr Zusammen Der in der Klimadefinition genannte mittlere
wirken gekennzeichnet ist. Damit verstehen Zustand der Atmosphare wird durch Mittel
wir unter dem Wetter ein Augenblicksbild werte der meteorologischen Elemente und Er
aus einem Vorgang, dem Wettergeschehen. scheinungen gekennzeichnet. Dabei ist zu be
Wenn dabei haufig das Wort Wetter auch fUr achten. daG ein mittlerer Wert nicht auch zu
das Wettergeschehen oder den Wetterverlauf gleich der haufigste Wert zu sein braucht, so
gebraucht wird, so ergibt das eine Mehrdeutig daG man bei Verwendung des Mittelwertes
keit des Wortes Wetter, die im einzelnen be gewisse Fehler begeht. Diese Fehler werden
achtet werden muG. urn so groGer sein, je weiter der Mittelwert yom
Der Begriff Witterung bringt gegeniiber dem haufigsten Wert entfernt ist; in den meisten
Wetter eine Verallgemeinerung, die darin be Fiil1en bleibt jedoch der entstehende Fehler
steht, daG die Witterung als allgemeiner Cha verhaltnismaBig gering. Weiter ist zu beriick
rakter des Wetterablaufes zu verstehen ist. Da sichtigen, dan das Klima letzten Endes im
mit wird durch die Witterung der mittlere Zusammenspiel aller meteorologischen bzw.
oder aber auch der vorherrschende - falsch klimatologischen Elemente und Erscheinun
lich manchmal auch der auffallendste - Cha gen besteht, wenn auch vielfach ein Element
rakter des Wetterablaufs eines bestimmten oder 'eine Gruppe von Elementen starker her
Zeitraumes gekennzeichnet. Die GroGe des vortritt. Daraus ergibt sich die Forderung, daG
betrachteten Zeitraumes hangt von der Frage man nach Moglichkeit zur Kennzeichnung des
stellung ab und kann sich von wenigen Tagen Klimas die Mittelwerte aller klimatologischen
bis zu Jahreszeiten, in einzelnen Fallen auch Elemente und Erscheinungen gemeinsam be
noch dariiber hinaus erstrecken. Als Beispiel trachten muG. Hier tritt erschwerend in Er
fiir die Verwendung des Begriffes Witterung scheinung, daG man das Klima nicht durch
sei folgendes erwahnt: Ein milder Winter eine einzige Zahl kennzeichnen kann; das hat
wird dadurch gekennzeichnet, daG seine Tem zur Folge, daG man doch von Fall zu Fall unter
peraturen im Mittel verhaltnismamg hoch den klimatologischen Elementen eine Auswahl
liegen; der Charakter des milden Winters treffen muG, wobei selbstverstandlich charak
wird aber nicht durch kurze Frostperioden, teristische Elemente zu wahlen sind.
selbst wenn diese sehr tiefe Temperaturen Bei der Bildung der Mittelwerte, also bei den
aufweisen, beein£luGt. Somit kennzeichnet man fur die Mittelwerte zu verwendenden Zeit
durch die Witterung den Gesamtcharakter raumen, ist darauf zu achten, daG diese nicht
einer bestimmten Zeit beziiglich des Wetter zu kurz, aber auch nicht zu lang gewahlt wer
ablaufes. den. Es ist dabei zu beriicksichtigen, daG dec
1. Einflihrung. Klimadefinition 9
"mittlere Zustand" der Atmosphare keinDauer Die angedeuteten Unterschiede in der Be
zustand ist, sondern Veranderungen unterliegt. trachtungsweise haben dazu gefiihrt, daB man
Man darf daher das Klima nicht als konstant, eine Dreiteilung des Klimas in Makro-, Meso
sondern hochstens als quasikonstant auffassen. und Mikroklima durchfuhrt bzw. yom makro-,
In der alteren Klimatologie stand - ent meso- und mikroklimatischen Bereich spricht.
sprechend dem ersten Teil der Klimadefinition Es muB allerdings bemerkt werden, daB diese
nach J. HANN - der Mittelwert im Vorder Einteilung noch keine allgemeine Anerken
grund der Betrachtung. Man spricht daher nung gefunden hat, was darauf beruht, daB
auch manchmal von der Mittelwertsklimatolo eine exakte Abgrenzung nicht in allen Fallen
gie, der man die auf dem zweiten Teil der moglich ist.
Klimadefinition beruhende Witterungsklima Ein auBerliches Kennzeichen des Makroklimas,
tologie gegenuberstellt. Diese Gegenuber auch als GroBklima oder schlechthin Klima be
stellung ist insofern nicht sehr glucklich, als zeichnet, ist, daB die Temperaturmessungen in
man bei der zusammenfassenden Betrachtung etwa 2 m Hohe uber dem Erdboden durchge
des Witterungsablaufes - und das ist letzten fuhrt werden. Damit werden die in Bodennahe
Endes die Witterungsklimatologie - auch oft sehr betrachtlichen Unterschiede und
nicht ohne das Hilfsmittel des Mittelwertes Schwankungen der klimatologischen Elemente,
auskommen kann. Ein Unterschied in der Be z. B. der Temperatur-und Feuchteverhaltnisse,
trachtungsweise besteht darin, daB bei der die auf der verschiedenen Beschaffenheit der
Mittelwertsklimatologie einzelne Elemente und Bodenoberflache beruhen, bewuBt auBerhalb
Erscheinungen den Ausgangspunkt bilden, der Betrachtung gelassen. Nur wenn man die be
wahrend bei der Witterungsklimatologie im sonderen Verhaltnisse der bodennahen Luft
"Wetter" und in der "Witterung" bereits das schicht zunachst nicht berucksichtigt, ist es
Zusammenwirken der klimatologischen Ele moglich, einen 'Oberblick uber das Klima
mente und Erscheinungen berucksichtigt wird. groBerer Gebiete zu geben.
In der Witterungsklimatologie werden also die Das Gegenstuck zum Makroklima bildet das
Mittelwerte bereits von bestimmten Komple Mikroklima, das "Klima der bodennahen
xen klimatologischer Elemente und Erschei Luftschicht" (R. GEIGER, 1950). Denn das
nungen gebildet. Es zeigt sich - und das ent Mikroklima bezieht sich auf die Verhaltnisse
spricht auch der Klimadefinition -, daB Mittel in der Schicht, die im Makroklima bewuBt
wertsklimatologie und Witterungsklimatolo vernachlassigt wird. Fur viele Fragen des
gie zwei sich erganzende Betrachtungsweisen Mikroklimas mussen vollig andere MeBme
derselben Sache darstellen. Das besagt aber thoden verwendet werden als im Makroklima.
gleichzeitig, daB die Konstruktion eines Gegen (Man denke nur an die Temperaturmessung un
satzes zwischen Mittelwertsklimatologie und mittelbar an der Erdoberflache, die einen be
Witterungsklimatologie, die in diesem Zu sonders kleinen MeBkorper erfordert.) Da die
sammenhang als "klassische" und ..m oderne" Mikroklimate sehr stark von der Beschaffen
Klimatologie bezeichnet werden, am Kern der heit der Bodenoberflache abhangig sind, bleibt
Sache vorbeigeht und daher verfehlt ist. ihre rliumliche Ausdehnung sehr gering. Da
1m Verlaufe der Geschichte klimatologischer her halt auch R. GEIGER (1950) fur die beste
Untersuchungen hat es sich gezeigt, daB es Definition des Begriffes Mikroklima die 'Ober
nicht moglich ist, alle auftretenden Fragen setzung "Klima auf kleinstem Raum".
nach einheitlichen Methoden zu bearbeiten. Zwischen dem Makro- und Mikroklima steht
Das gilt sowohl fur die instrumentelle Beob das Mesoklima, oft auch als Lokalklima be
achtung als auch fur die Bearbeitung der Be zeichnet. Die beim Mesoklima betrachteten
obachtungsergebnisse, also beispielsweise fur Raume sind in sich geschlossen und unter
die Mittelwertbildung. Es kommt hinzu, daB scheiden sich deutlich von ihrer Umgebung
man in manchen Fallen die Untersuchungs (z. B. Stadt, Talkessel), beschranken sich aber
methoden auch nach der GroBe der zu unter nicht mehr nur auf die bodennahe Luftschicht.
suchenden Gebiete einrichten muB. Dabei ist Das hat zur Folge, daB man sich zur Betrach
selbstverstandlich, daB die 'Obersicht urn so tung des Mesoklimas sowohl der im Makro
weniger Einzelheiten bringen kann, je ausge klima als auch der im Mikroklima angewandten
dehnter das betrachtete Gebiet ist. Methoden bedient.
10 1. Einfiihrung, Klimadefinition
Es mag auffallen, daB die Abgrenzungen zwi logie, als deren Teilgebiet sich die Kurort
schen Makro-, Meso- und Mikroklima zahlen klimatologie erweist, befaBt sich mit der Wir
mlillig nieht genau zu definieren sind. Das kung des Klimas auf den Menschen; sie stellt
hangt damit zusammen, daB das Klima des so mit ein Gebiet der Klimatologie dar, in dem
jeweils kleineren Raumes in das des groBeren sich eine Zusammenarbeit mit der Medizin
eingefiigt ist, so daB das Mikroklima in ein ergibt. In entsprechender Weise befaBt sich die
Mesoklima und mit diesem wieder in ein Agrarklimatologie mit den Fragen, die Land
Makroklima eingebettet ist. Dabei ist eine und Forstwirtschaft betreffen, wobei die
scharfe Abgrenzung schon deshalb zweifel wechselseitigen Beziehungen zwischen Klima
haft, weil die einzelnen Klimate nicht unab und Vegetation einen wesentlichen Bestand
hlingig voneinander bestehen, sondeen gegen teil der Untersuchungen bilden. DaB Fragen
seitig aufeinander einwirken. Trotzdem bleibt der Klimatologie auch noch in weiteren Ge
den einzelnen Klimaten eine gewisse Selbstlin bieten eine Rolle spielen, sei hier nur erwlihnt;
digkeit, so daB man also nicht etwa das Meso iiber Einzelheiten wird bei der Anwendung
klima als Summe von Mikroklimaten auffassen klimatologischer Ergebnisse zu sprechen sein.
kann. Die bisher genannten Klimadefinitionen legten
Die Unterteilung in Makro-, Meso-und Mikro das Schwergewicht der Betrachtung meist auf
klima hat Sinn, so lange der Einteilung nicht die meteorologische Fragestellung. Es darf
nur die GroBe des betrachteten Gebietes, son aber nicht verkannt und iibersehen werden,
deen auch die spezifische Verteilung der das daB die Klimatologie auch der Geographie
Klima beeinflussenden Faktoren, die letzten angehort, und zwar nicht nur als "Hilfswissen
Endes die unterschiedlichen MeBmethoden schaft". Dazu bemerkt W. KOPPEN (1931):
bedingt, zugrunde gelegt wird. Eine Unter "Die Klimakunde oder Klimatologie ist ein
teilung aber, die ausschlieBlich nach der GroBe Zweig der Meteorologie im weiteren Sinne,
der betrachteten Gebiete erfolgt, kann den an der zwar ebenso, wie diese iiberhaupt, sich auf
sie gestellten Forderungen nicht gerecht wer der Experimentalphysik und der Geographie
den, da das Klima in seinen Grundzugen nicht aufbaut, in dem aber das geographische Mo
von der GroBe des betrachteten Gebietes ab ment iiber das physikalische iiberwiegt."
hlingt. Es ist wohl unwesentlich, zu untersuchen,
1m Makroklima werden in der Hauptsache welche Betrachtungsweise, die physikalische
allgemeine Faktoren wirksam, die durch ort oder die geographische, in der Klimatologie
liche Gegebenheiten modifiziert werden. DeI"Il vorherrscht. 1m einzelnen diirfte die stlirkere
gegeniiber treten die ortlichen Faktoren beim Betonung der einen oder der anderen Betrach
Mikroklima ausschlaggebend in den V order tungsweise von der gegebenen Fragestellung
grund. Auch unter diesem Gesichtspunkt abhlingen. Die geographische Fragestellung
nimmt das Mesoklima eine Zwischenstellung wird im allgemeinen auf die geographische
ein. Da das Zusammenwirken der verschie Verbreitung der wesentlichen atmosphlirischen
denen Faktoren, die das Klima bedingen, sehr Erscheinungen ausgerichtet sein. Da aber eine
mannigfaltig sein kann, ergibt sich, daB die solche geographische Verbreitung kaum dar
Grenzen zwischen Makro-, Meso- und Mikro zustellen ist, ohne auf die Ursachen einzu
klima nicht scharf ausgeprligt, sonde en durch gehen, ergibt sich die Frage nach der "Physik
verschiedenartige Uberglinge gegeben sind. der Atmosphlire".
Besonders vielfliltig erscheinen diese Uber Mag im Einzelfall bei der Betrachtung der
glinge zwischen Mikro- und Mesoklima, was Klimate die geographische Fragestellung nach
zur Folge hat, daB diese gewohnlich in der der Verbreitung etwas mehr im Vordergrund
Betrachtung nicht getrennt werden. stehen, so bedarf doch eine eingehende Dar
Weitere Unterteilungen innerhalb der Klima stellung auch der Aufdeckung der physikali
tologie rich ten sich nach der Fragestellung, die schen Zusammenhlinge und Ursachen der
im Einzelfall zu untersuchen ist und aus der Klimate. Daraus ergibt sich, daB die Klima
sich auch mehr oder weniger differenzierte tologie in Geographie und Meteorologie
Untersuchungsmethoden ergeben. Hier sind Heimatrecht hat, daB in ihr die Geographie und
Bioklimatologie, Kurortklimatologie und die Meteorologie in enge Beziehungen zuein
Agrarklimatologie zu nennen. Die Bioklimato- ander treten. Es folgt weiterhin, daB sich der