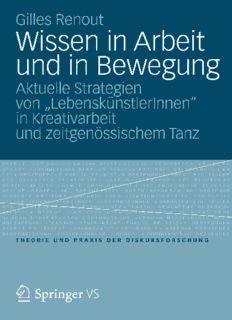Table Of ContentTheorie und Praxis
der Diskursforschung
Herausgegeben von
R. Keller, Augsburg, Deutschland
Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich im deutschsprachigen Raum quer durch die
verschiedenen sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen eine lebendige
Szene der diskurstheoretisch begründeten empirischen Diskurs- und Dispositiv-
forschung entwickelt. Vor diesem Hintergrund zielt die interdisziplinär angelegte
Reihe durch die Veröffentlichung von Studien und Diskussionsbeiträgen auf eine
weitere Profilschärfung der Diskursforschung. Die aufgenommenen und aufzuneh-
menden Veröffentlichungen sind im gesamten Spektrum sozialwissenschaftlicher
Diskursforschung und angrenzenden Disziplinen verortet. Die einzelnen Bände
beschäftigen sich mit theoretischen und methodologischen Grundlagen, metho-
dischen Umsetzungen und empirischen Ergebnissen der Diskurs- und Dispositiv-
forschung. Zudem kommt deren Verhältnis zu anderen Theorieprogrammen und
Vorgehensweisen in den Blick. Veröffentlicht werden sowohl empirische Studien
wie theoretisch oder methodologisch ausgerichtete Monographien wie auch Dis-
kussionsbände zu spezifischen Themen.
Herausgegeben von
Reiner Keller,
Universität Augsburg
Gilles Renout
Wissen in Arbeit
und in Bewegung
Aktuelle Strategien von „Lebens-
künstlerInnen“ in Kreativarbeit und
zeitgenössischem Tanz
Gilles Renout
Dörverden, Deutschland
Dissertation Universität Bremen, 2012
Gutachterin: Prof. Dr. Monika Fikus
Gutachter: Prof. Dr. Rolf Oberliesen
Das Kolloquium fand am 5. März 2012 statt
Gefördert durch das Evangelische Studienwerk e.V. Villigst
ISBN 978-3-531-19571-1 ISBN 978-3-531-19572-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-531-19572-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2012
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe
Springer Science+Business Media
www.springer-vs.de
Inhalt
Inhalt. ............................................................................................................. 5
Abbildungsverzeichnis ............................................................................ 9
1. Einleitung ............................................................................................... 11
1.1 Themenspektrum und Problemstellung. ............................. 12
1.2 Wissenscbaftlicher Bezugsrahmen & gesellschaftliche
Relevanz der Studie .................................................................... 12
1.3 Fragestellungen & Erkenntnisinteresse .............................. 19
1.4 Zum interdisziplinären Charakter der Studie .................... 21
1.5 Aufbau der Studie: Vorstellung der Kapitel ........................ 23
2. Zugrundegelegte Methodologie & angewandte Methoden ... 25
2.1 Anknüpfungspunkte innerhalb der Wissenssoziologie .. 25
2.1.1 Reflexiv-kritische Analyse konkreten, verortbaren
und gelebten Wissens .................................................................... 26
2.1.2 Der Wandel von Wissen in der "Weltrisikogesell-
schaft" (Makroperspektive) ........................................................ 27
2.1.3 Die soziale Produktion von Wissen im Labor
(Mikroperspektive) ........................................................................ 30
2.1.4 Ergänzende Bemerkungen zur Wissen(-sproduktion)
als kultureller Praxis ...................................................................... 33
2.1.5 Die Frage nach dem Umgang mit Nichtwissen:
"Reflexive Wissenspolitik". .......................................................... 34
2.1.6 Die Pragmatische Wissenssoziologie als öffnende
und befreiende Perspektive ........................................................ 37
2.1.7 Der "Mode 2" der Wissensproduktion als Möglich-
keit zur Weiterentwicklung ........................................................ 39
2.1.8 Zusammenfassung und Fragen .................................................. 42
6 Inhalt
2.2 Anknüpfungspunkte an die Diskursanalyse (nach
Foucault) ......................................................................................... 43
2.2.1 Foucaults (selbst-)kritische Philosophie ............................... 44
2.2.2 Der epistemologische Bruch ....................................................... 45
2.2.3 Der diskursanalytische Blick ...................................................... 47
2.2.4 Diskursives Wissen ......................................................................... 48
2.2.5 Die zentrale Stellung der Wirkungen der Diskurse .......... 49
2.2.6 Strategien der Diskursanalyse nach Foucault ..................... 51
2.2.7 Archäologie und Genealogie ....................................................... 52
2.2.8 Diskursive Un-Ordnung ................................................................ 54
2.2.9 Die Rolle der Macht in den Diskursen .................................... 55
2.2.10 Die Dispositive ............................................................................... 57
2.2.11 Die Diskurse und Dispositive als analytische
Konstruktionen ............................................................................. 59
2.2.12 Diskursive und nicht-diskursive Praktiken ....................... 61
2.2.13 Resume und Fragen ..................................................................... 63
2.3 Das Forschungsprogramm der Wissenssoziologischen
Diskursanalyse ............................................................................. 63
2.3.1 Synthese der Methodologie ......................................................... 64
2.3.2 Zusammenfassung und sich anschließende Fragen ......... 70
2.4 Methodik ......................................................................................... 72
2.4.1 Grundzüge qualitativer Sozialforschung ............................... 73
2.4.2 Orientierung am Vorgehen der Grounded Theory ............ 75
2.4.3 Ausblick auf das konkrete methodische Vorgehen ........... 77
3. Umdeutungen von 'Erwerbsarbeit' im Diskurs der
.Digitalen Boheme" ........................................................................... 85
3.1 Verortung im arbeitssoziologischen Forschungs-und
Diskussionsstand ......................................................................... 86
3.2 Die heuristische Konstruktion des zu untersuchenden
Diskurses ........................................................................................ 88
3.3 Sampling und Korpuserstellung ............................................. 89
3.4 Systematisierende Darstellung ............................................... 90
3.4.1 Achsenkategorie 1: .Digitale Medien als Schlüssel zur
'economy ofknowledge'" ............................................................. 91
Inhalt 7
3.4.2 Achsenkategorie 2: "Kreativitätsimperativ &
KünstlerInnenidealbild" ............................................................. 105
3.4.3 Achsenkategorie 3: "Das Selbst als das
Gravitationszentrum" .................................................................. 116
3.4.4 Achsenkategorie 4: "Unschärfe als Strategie" ................... 127
3.4.5 Kernkategorie & Story ................................................................. 134
4. Umdeutungen des Bewegungsverständnisses im
zeitgenössischen Tanz ................................................................... 143
4.1 Orientierung innerhalb der Bezugswissenschaften ..... 143
4.1.1 Bewegungswissenschaft. ............................................................ 143
4.1.2 Die Soziologie des Körpers und des Sports ........................ 145
4.1.3 Tanzwissenschaft .......................................................................... 147
4.2 Die heuristische Konstruktion des zu unter-
suchenden Diskurses ............................................................... 150
4.3 Datenkorpus und -sampling. ................................................. 151
4.4 Systematisierende Darstellung ............................................ 152
4.4.1 Achsenkategorie 1: "Klassisch-wissenschaftliche
Forschungspraktiken des Tanzes" ......................................... 156
4.4.2 Achsenkategorie 2: "Künstlerisch-expressive
Forschungspraktiken" ................................................................. 160
4.4.3 Achsenkategorie 3: "Themenfelder der
wissenschaftsorientierten Strömung". ................................. 165
4.4.4 Achsenkategorie 4: "Themenfelder der künstlerisch-
expressiven Strömung" ............................................................... 175
4.4.5 Achsenkategorie 5: "Besondere Charakteristika des
forschenden Tanzes" .................................................................... 190
4.4.6 Achsenkategorie 6: "Nebeneffekte & -folgen" ................... 197
4.4.7 Kernkategorie & Story ......................................................... 208
5. Zusammenführung: "Via attrattiva" oder vom stetigen
Streben ................................................................................................ 215
5.1 Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, Parallelen ................. 216
5.2 Unterschiede: Ästhetisierung der Arbeit -
Ökonomisierung des Tanzes ................................................. 218
5.3 Ergänzungen, Schlussfolgerungen, Zuspitzungen. ......... 222
8 Inhalt
6. Schluss & Ausblick ........................................................................... 231
6.1 Möglichkeiten und Grenzen kritischer Wissenschaft. .. 234
6.2 Hybride Maschinen als .aufregende" Derivate des
kreativen Kapitalismus. .......................................................... 237
7. Literatur .............................................................................................. 241
8. Anhänge ............................................................................................... 259
8.1 Quellen zum Diskurs .Digitale Boheme" ........................... 259
8.1.1 Problemzentrierte Interviews ................................................. 259
8.1.2 Medienbeiträge ............................................................................... 261
8.1.3 Ratgeberliteratur ........................................................................... 263
8.2 Quellen der Stückbeschreibungen zeitgenössischer
Tanzstücke .................................................................................. 264
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: „Das Kategoriensystem“ ....................................................................... 81(cid:1)
Abb. 2: „Hermeneutic Unit 1 – Die ‚digitale Bohème’ als Vision der
Erwerbsarbeit“ ..................................................................................... 91(cid:1)
Abb. 3: „Achsenkategorie 1: Digitale Medien als Schlüssel zur ‚Economy(cid:1)
of knowledge’“ ..................................................................................... 92(cid:1)
Abb. 4: „Achsenkategorie 2: Kreativitätsimperativ und KünstlerInnen-(cid:1)
Idealbilder“ ........................................................................................ 106(cid:1)
Abb. 5: „Achsenkategorie 3: Das Selbst als das Gravitationszentrum“ ........... 116(cid:1)
Abb. 6: „Achsenkategorie 4: Unschärfe als Strategie“ .................................... 127(cid:1)
Abb. 7: „Hermeneutic Unit 2: Zeitgenössischer Tanz als ‚Wissenskultur’“ ... 155(cid:1)
Abb. 8: „Achsenkategorie 1: Klassisch-wissenschaftliche Forschungs-
praktiken des Tanzes“ ........................................................................ 156(cid:1)
Abb. 9: „Achsenkategorie 2: Künstlerisch-expressive Forschungspraktiken(cid:1)
des Tanzes“ ........................................................................................ 161(cid:1)
Abb. 10: „Achsenkategorie 3: Themenfelder der wissenschafts-orientierten
Strömung“ ....................................................................................... 166(cid:1)
Abb. 11: „Achsenkategorie 4: Themenfelder der künstlerisch-expressiven(cid:1)
Strömung“ ....................................................................................... 176(cid:1)
Abb. 12: „Achsenkategorie 5: Besondere Charakteristika des forschenden(cid:1)
Tanzes“ ............................................................................................ 191(cid:1)
Abb. 13: „Achsenkategorie 6: Nebeneffekte und –folgen“ ............................. 198(cid:1)
Description:Diese wissenssoziologische Diskursanalyse unterschiedlicher Formen moderner Kleinselbstständigkeit von Gilles Renout zeigt, wie sich zeitgenössische TänzerInnen und kreative WissensarbeiterInnen an aktuellen Anforderungen an das „unternehmerische Selbst“ (Bröckling 2007) orientieren: Die