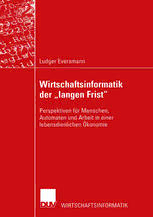Table Of ContentLudger Eversmann
Wirtschaftsinformatik der "Iangen Frist"
WI RTS CH AFTS INFO RMATI K
Ludger Eversmann
Wirtschaftsinformatik
der "I-angen Frist
ll
Perspektiven fUr Menschen,
Automaten und Arbeit in einer
lebensdienlichen Okonomie
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Arno Rolf
Deutscher UniversiHits-Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Ober <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Dissertation Universitat Hamburg, 2002
1. Auflage Januar 2003
Aile Rechte vorbehalten
© Deutscher Universitats-Verlag GmbH, Wiesbaden, 2003
Lektorat: Ute Wrasmann / Britta Giihrisch-Radmacher
Der Deutsche Universitats-Verlag ist ein Unternehmen der
Fachve rl ag sgruppe Bertelsma nnSpri ng er.
www.duv.de
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschOtzt.
Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verla.os unzulassig und strafbar. Das gilt insbe
sondere fOr Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dOrften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN-13:978-3-8244-2165-7 e-ISBN-13:978-3-322-81224-7
001: 10.1007/978-3-322-81224-7
Geleitwort
Was sind die wissenschaftlichen Herausforderungen fur die Wirtschaftsinfonna
tik? 1m abgelaufenen lahrzehnt hat sie vor all em versucht, Metaphem wie ,,In
fonnationsgesellschaft", "Datenhighway" oder "New Economy" zu operationa
lisieren, d.h. Konzepte, Methoden und Produkte zur Umsetzung in Untemehmen
zu entwickeln. Die Herausforderungen fur die Wirtschaftsinfonnatik, wie ich sie
sehe und 1998 in meinem Buch "Grundlagen der Organisations- und Wirt
schaftsinfonnatik" in konstruktiver Absicht fonnuliert habe, bestehen immer
noch. Es ist die Frage nach dem Gegenstandsbereich der Wirtschaftsinfonnatik,
in den auch relevante gesamtwirtschaftliche Tatbestande einbezogen werden
sollten. Es geht nach meiner Auffassung aber auch darum, eine zu enge Anbin
dung an aktuelle Trends zu venneiden und Moden und Mythen friihzeitig zu i
dentifizieren, urn so Zeit und Kraft nicht zu verschwenden. Letztendlich ist die
Wirtschaftsinfonnatik aufgerufen, neben der Bereitstellung von Verfugungswis
sen auch tragfahiges Orientierungswissen zu erarbeiten und die eigenen hand
lungsleitenden Motive und Leitbilder explizit zu machen.
Ludger Eversmann hat mit seiner hier vorliegenden Arbeit ebenfalls den Ver
such untemommen, sich einigen dieser Herausforderungen zu stellen. Aus
gangspunkt seiner Argumentation ist die Infragestellung eines Selbstverstand
nisses der deutschsprachigen Wirtschaftsinfonnatik, deren Erkenntnisinteresse
als das mit sich im Konsens lebende, private GroBuntemehmen beschrieben
werden kann. Dabei geht es der Wirtschaftsinfonnatik primar urn die Suche
nach Rationalisierungs- und Produktivitatspotenzialen. Peter Mertens hat ent
sprechend das Wissenschaftsziel der Wirtschaftsinfonnatik mit der Metapher der
"sinnhaften Vollautomatisierung" beschrieben. Ein Leitbild, das mehr oder min
der unhinterfragt eingebettet ist in die markthannonische, neoklassische Sicht
yom stetigem Gleichgewichtswachstum. Es lasst sich so interpretieren, dass die
durch die Wirtschaftsinfonnatik gestalteten Untemehmen standig Produktivitat
generieren, die auf dauerhaft aufnahmefahige, weil nie gesattigte Markte trifft.
Etwaige Probleme des Arbeitsmarktes werden immer wieder durch neues
Wachstum ausgeglichen.
Geht man jedoch von der Option aus, dass es (1) Grenzen volkswirtschaftlichen
Wachstums gibt, und dass (2) die luK-Technologien einen Produktivitatsiiber
schuss generieren, der das erreichbare Wachstum einer Volkswirtschaft dauer
haft iibersteigt, dann sind, so die Argumentation von Ludger Eversmann, die ak
tuell geltenden Wissenschaftsziele der Wirtschaftsinfonnatik zu reflektieren. Es
sind umfassende wissenschaftstheoretische Begriindungen, also ein nachhaltige
res Bemiihen urn die Erarbeitung von Orientierungswissen, erforderlich.
VI
Eine erste Reaktion auf den Vorschlag von Peter Mertens war 1995 ein Leser
brief von D. Hoch in der "Wirtschaftsinformatik". In diesem Leserbriefwar u.a.
die Rede von einer Implikation des Zielvorschlages von Prof. Mertens: "die
sinnhafte Vollautomatisierung des Untemehmens wird auch weiterhin mindes
tens physische Arbeitskraft und -zeit freisetzen." Und weiter: "Vielleicht ist das
ja auch ein fur den Menschen in seiner Weiterentwicklung vorgezeichneter
Weg .. ( ... ) .. die Entwicklung weg von der physischen Arbeit hin zur st1ITkeren
Befriedigung geistiger und sozialer Bedlirfnisse .... ". Ludger Eversmann hat die
se hier angesprochenen und mit dem Wirken der Wirtschaftsinformatik ja in Zu
sammenhang stehenden Fragen nach der "We iterentwicklung des Menschen" als
vertiefte philosophische und gesellschaftliche Werte-Diskussion aufgefasst und
die vorliegende Arbeit in diesen Kontext gestellt.
Der Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen vertritt ein methodologisches Prin
zip, nach welchem es besser ist, eine vage Vorstellung vom Richtigen zu entwi
ckeln, als eine prazise Vorstellung vom Falschen. Die von Ludger Eversmann
vorgetragenen Gedanken sind in diesem Sinne keine prazise und fertig ausgear
beitete L6sung. Es bleibt aber dennoch zu hoffen, dass sie eine noch immer
notwendige Debatte urn die "Zukunft der Arbeit" und die langfristigen Gestal
tungsziele der Wirtschaftsinformatik ein wenig befordem k6nnen und somit ei
nen Beitrag leisten, urn schlie!3lich auch eine prazisere Vorstellung vom Richti
gen zu gewinnen.
AmoRolf
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist das Resultat eines sich Uber viele - genau genornmen
rund 25 - Jahre hinziehenden, zeitweilig unstet und fast irnmer ganz privat ver
folgten Erkenntnisinteresses, in dessen Mittelpunkt immer die Frage nach prin
zipiellen Moglichkeiten kultureller Evolution stand, sowie die Frage nach deren
Beschaffenheit, Wahrend diesbezUgliche Hoffnungen und fachbezogene Interes
sen sich zunachst - wie seit Ende der 1960er Jahre dem Trend entsprechend -
auf humanwissenschaftliche Disziplinen und deren Erkenntnisse richteten, be
gann die Informatik und deren Erkenntnisgegenstand ab Mitte der 1980er Jahre
eine zunachst kaum erklarliche Faszination auszuUben. SchlieBlich konzentrier
ten sich die Fragestellungen auf die anzunehmenden bzw. zu beobachtenden
Wechselwirkungen zwischen Informations- und Automationstechniken und de
ren Wirkungsentfaltung im Rahmen der global en Wirtschaftsentwicklung.
Schlaglichtartig beleuchtet waren diese Zusammenhange sowie der in diesem
Fragekontext neu entstehende Reflexionsbedarf mit Vorstellung des vieldisku
tierten Vorschlages einer langfristigen Zielorientierung der Wissenschaft Wirt
schaftsinformatik durch Peter Mertens im Jahre 1995.
Der Titel der Arbeit ist stark angelehnt an eine volkswirtschaftstheoretische Be
trachtung okonomischer Langfristtheorien von N. Reuter: die "Okonomik der
,langen Frist'''. Eine "Wirtschaftsinformatik der ,langen Frist'" soli einer Ges
taltungswissenschaft Wirtschaftsinformatik normative Grundlagen einer lang
fristigen Programmatik zuliefem. Urn diese zu gewinnen, ist der Orientierungs
horizont einer "Okonomik der langen Frist" ebenso unverzichtbar wie das Auf
spannen eines Wertehorizonts mit Hilfe der Erkenntnismittel der modemen Ver
nunftphilosophie.
Zu ganz besonderem Dank bin ich dem wissenschaftlichen Betreuer dieser Ar
beit, Prof. Peter Schefe, verpflichtet, der trotz einiger bestehender Unwagbarkei
ten einer extemen Promotion die Betreuung Ubemommen hat, mir immer wieder
Hilfestellung bei der Uberwindung auf dem Realisierungsfortschritt auftauchen
der HUrden leistete und alles in all em dafUr Sorge getragen hat, dass ein univer
sitatsextem durchgefUhrtes Projekt auf den Pfaden der Wissenschaftlichkeit sei
nen Fortschritt nehmen konnte. Prof. Amo Rolf danke ich fUr wertvolle Anre
gungen und auch fUr die ErOffnung einer Debatte im Feld der Wirtschaftsinfor
matik, an die die vorliegende Arbeit nun Anschluss suchen bzw. herstellen kann.
Ganz aufrichtigen Dank sage ich auch dem V orsitzenden des Promotionsaus
schusses des Fachbereichs Informatik der Universitat Hamburg, Prof. Christo
pher Habel, dessen wohlwollender Behandlung meines Anliegens ich den bisher
erreichten Stand des Projekts verdanke.
VIII
Ich danke auch lieben Menschen meines privaten Umfeldes fur z. T. auJ3eror
dentlich wichtige Hinweise und Anregungen, und fur groJ3e und unendliche Ge
duld und Gesprachsbereitschaft, auch wenn die bevorzugten Themen und Frage
stellungen zeitweilig keine sehr groJ3e Variationsbreite erkennen JieJ3en.
Die Arbeit widme ich meinen Kindem Niko und Heidi, deren Zukunft in einer
hoffentlich zunehmend menschenwiirdigen und auch farbenfrohen Welt mir be
sonders am Herzen liegt.
Ludger Eversmann
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort VII
Inhaltsverzeichnis IX
Abbildungsverzeichnis XIII
Einleitung 1
1 Wirtschaftsinformatik und Wissenschaftstheorie ................................... 15
1.1 Wissenschaftlichkeit: Ziele, Methoden und WissensbegrifJ. ................... 21
1.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Wissenschaftstheorie ......................... 21
1.1.2 Klassische Wissenschaftstheorien .................................................... 22
1.1.2.1 Die aristotelische Wissenschaftstheorie ...................................... 22
1.1.2.2 Die Wissenschaftstheorie Francis Bacons .................................. 24
1.1.3 Zwischenbetrachtung: Reines Wissen, Lebenserleichterung und
Automation ...................................................................................... 25
1.104· Wirtschaftsinformatik zwischen Pragmatismus, Positivismus und
Konstruktivismus ............................................................................. 34
1.1.5 "Regionale Ontologie" der Wirtschaftsinformatik, Logik der Wirt-
schaftsinformatikforschung oder Rekonstruktion als Konstitution? .50
1.2 Der Orientierungsbedarf der Wissenschaften ........................................ 63
1.3 Die ,Konstruktivitat' der Wirtschaftsinformatik .................................... 65
1.4 Vernunft und Rationalitat, konstruktive Wissenschaftstheorie und
Radikaler Konstruktivismus .................................................................... 71
Die Keminhalte des Methodischen Konstruktivismus ........................... 82
Die Keminhalte des Radikalen Konstruktivismus ................................. 84
1.5 Methodische Kritik der These zur ,sinnhaften Vollautomation ' ............. 97
2 Menschenwiirde, Vernunft und Autonomie .......................................... l07
2.1 Menschenwiirde, Freiheit und Notwendigkeit ...................................... 113
x
2.2 Entwicklungslinien der Vernunftethik .................................................. 120
Die Goldene Regel oder das Christliche Gebot der Nachstenliebe ....... 123
Der unparteiische Zuschauer nach Adam Smith .................................. 124
Der Kategorische Imperativ Kants ...................................................... 125
Das regelutilitaristische Verallgemeinerungskriterium ........................ 129
Die Diskursethik ................................................................................. 132
2.3 Verantwortung, Intention und Funktion. .............................................. 141
2.4 Faktizitiit und Geltung, Macht und die Ohnmacht des Sol/ens ............. 151
2.5 Die Idealisierung des Realen und die Realisierung des Idealen. .......... 156
2.6 VernunJt, Handlung, Arbeit und Okonomie ......................................... 168
3 Berechenbare Automaten ....................................................................... 185
3.1 Grundbegriffe der theoretischen Informatik ........................................ 188
3.2 Grammatiken undformale Sprachen ................................................... 192
3.3 Turing-Maschinen ............................................................................... 194
3.4 Berechenbarkeit ................................................................................... 198
3.5 Komplexitiit ......................................................................................... 201
3.6 Geist im Computer? Anmerkungen zur " Teleologie" des Automaten .. 207
3.7 Automat, Berechnung und Leistung ..................................................... 219
4 Menschen, Automaten und Arbeit ......................................................... 223
4.1 Zur Entwicklungslogik wirtschaJtlicher " Ordnungen" oder "Systeme" ....
............................................................................................................ 229
4.1.1 Wirtschaftssysteme als Gegenstand der Erkenntnis ........................ 230
4.1.2 Vergleich der Wirtschaftssysteme .................................................. 231
4.1.3 Theorie der Wirtschaftssysteme ..................................................... 231
4.1.4 Evolution von Wirtschaftssystemen ............................................... 233
4.1.4.1 Lange-Wellen-Theorien ........................................................... 237
4.1.4.2 Die Deutsche Historische Schule ............................................. 239
4.1.4.3 Die marxistische Interpretation gesellschaftlicher Evolution .... 239
4.1.4.4 Die Stadientheorie J. M. Keynes' ............................................. 246
4.1.4.5 Die Pluralitatstheorie Waldemar Mitscherlichs ........................ 249
4.1.5 Wertideen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Evolution .......... 252