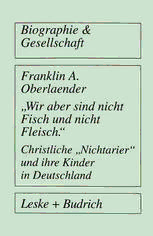Table Of ContentFranklin A. Oberlaender
"Wir aber sind nicht Fisch und nicht Fleisch"
Biographie und Gesellschaft
Herausgegeben von
Werner Fuchs-Heinritz, Martin Kohli, Fritz Schütze
Band 24
Franklin A. Oberlaender
"Wir aber sind nicht Fisch
und nicht Fleisch"
Christliche "Nichtarier" und
ihre Kinder in Deutschland
Leske + Budrich, Opladen 1996
Der Autor:
Dr. Franklin A. Oberlaender, Dr. phil., Studium der Volkswirtschaft, Sozio
logie und Psychologie in Frankfurt a.M. und Berlin. Klinischer Psychologe
der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin-Wittenau; Lehrbeauftragter der
Technischen Universität Berlin, der Freien Universität Berlin und der Fach
hochschule für Rechtspflege und Verwaltung Berlin.
Veröffentlichungen zu den Themen: Biographieforschung, Epidemiologie
der Abhängigkeitserkrankung, Recht und Psychiatrie, Devianz und Stigmati
sierung.
Gedruckt auf säure-und chlorfreiem, alterbeständigem Papier
ISBN 978-3-8100-1466-5 ISBN 978-3-322-91397-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-91397-5
© 1996 Leske + Budrich, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfaltigungen, Übersetzungen, Mi
kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorwort
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Interviewpartnern für ihr Ver
trauen bedanken. Ohne ihre Kooperationsbereitschaft wäre diese Arbeit
nicht möglich gewesen. Für die wissenschaftliche Betreuung und Beratung
danke ich besonders Martin Kohli und seinen wissenschaftlichen Mitarbei
tern Jürgen Wolf und Günter Burkhart. Meinen herzlichen Dank richte ich
an Bruno Hildenbrand, er hat - wie kein anderer - meinen Entwicklungspro
zeß auf dem Gebiet der Sozialpsychologie etwa zehn Jahre konstruktiv
begleitet und durch vielfältige Unterstützung diese Arbeit vorangetragen.
Monika Wagner gilt mein besonderer Dank, keiner hat mich in den letzten
fünf Jahren mit mehr Zeit und Energie bei der Fertigstellung dieser Arbeit
unterstützt. Sei es in der inhaltlichen Diskussion, bei der sprachlichen Über
arbeitung oder bei der Gestaltung des Layout: sie war immer ansprechbar
und hilfreich. Bei folgenden Personen möchte ich mich ebenfalls für ihre
Unterstützung bedanken (in alphabetischer Reihenfolge): Gabriele Althaus,
Micha Brumlik, Werner Goldberg, Fred Mengering, Susanne Miller, Ernest
Oberlaender s.A., Reinhard Rürup, Julius H. Schoeps, Irmingard Staeuble,
Walter Sylten, Erhard Stölting, Klaus Wanner, Hedwig Wischner und Karin
Zirkelbach. Für die finanzielle Unterstützung im Rahmen eines Disser
tationsstipendiums danke ich der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Franklin A. Oberlaender, Sommer 1995
5
Inhalt
1. Einleitung.......................................................................... ..... 11
2. Zur Definition und Demographie einer Stigmagruppe
'ohne Eigenschaften' ........................................................ 14
2.1. Wer ist Jude und wer ein christlicher 'Nichtarier'? .............. ...... 14
2.2. Demographie und soziale Strukturmerkmale der Gruppe .... ...... 23
2.3. Christliche Deutsche jüdischer Herkunft als marginalisierte
Gruppe: Stigmaträger und Fremde in ihrer eigenen
Lebenswelt ....... ......................................................................... 31
2.4. Forschungsstand .................................................................. ..... 36
3. Methodologische Überlegungen und methodisches
Vorgehen...................................................................... .... 39
3.1. Zur Rekonstruktion vergangener Wirklichkeit...................... ..... 39
3.2. Biographische Forschung und textinterpretative
Auswertungsverfahren. ............ .................................... ......... ..... 40
3.3. Sequenzanalyse und Komponentenanalyse............................ ..... 41
3.4. Die dem 'narrativen Interview' von Fritz Schütze
angenäherten 'Alltagsgespräche'........................................... ..... 42
3.5. Die kombinierte Einzelfall-Familienstudie............................ ..... 43
3.6. Quellenstudium: Sekundärliteratur und biographische
Berichte...................................................................... .......... ..... 44
3.7. Die Erhebung............................................................................. 45
3.8. Auswertung der biographischen Materialien......................... ..... 53
4. Historischer Teil............................................................... 56
4.1. Die Verfolgung christlicher 'Nichtarier' ...... .......................... ..... 56
4.2. Die Situation der christlichen 'Nichtarier' in ihrer jeweiligen
Glaubensgemeinschaft.......................................................... ..... 69
7
4.3. Vergleich der katholischen mit der pr.otestantischen Kirche
im Verhältnis zum Nationalsozialismus und zu ihren
'nichtarischen' Mitgliedern......................................................... 109
4.4. Zur Situation der Nichtj uden in der Reichsvereinigung der
Juden......................................................................................... 112
5. Biographischer Teil.................................................... ...... 114
5.1. Einführung.......................................................................... ...... 114
5.2. Fallstudie: Heinz Frei (*1910) ............................................. ..... 117
5.3. Fallstudie: Marion Frei (*1966)............................................ ..... 167
5.4. Fallstudie: Hans Herzberg (* 1908)........................................ ..... 194
5.5. Fallstudie: Harry Herzberg (*1953)............................................ 228
5.6. Fallstudie: Pfarrer Friedrich Fuchs (*1912) ............................... 257
5.7. Ergänzende Fälle aus den Fallstudien................................. ....... 286
5.8. Weitere Fälle nichtj üdischer 'Nichtarier'............................. ....... 290
5.9. Weitere Fälle von Nachkommen nichtj üdischer 'Nichtarier' ....... 305
6. Die Problematik der älteren Verfolgten: Substantielle
Hinterfragung der Identität im Erwachsenenalter. .......... 313
6.1. Mittel der Täuschung als Überlebensstrategie, psychische
Folgen, geringe Informationstransparenz in der
Post-Stigma-Phase ..................................................................... 314
6.2. Zur Dynamik in Familien mit Mitgliedern unterschiedlicher
'Rassegrade': Zwischen Abgrenzung und Selbstentwertung,
Emigration und Widerstand. ...................................................... 318
6.3. Einstellungen zu Deutschland und zur eigenen Religion ............ 320
6.4. Einstellungen zum Judentum, zu Juden, zum Zionismus und
zum Rassenmodell..................................................................... 325
6.5. Ein Leben zwischen den Stühlen -Zur Realitätskonstruktion
von 1933 bereits erwachsenen christlichen Deutschen
jüdischer Herkunft ..................................................................... 329
7. Die Problematik der jüngeren Verfolgten:
Sozialisation in unklaren Identitätsentwürfen .................. 332
7.1. Sozialisation in existientieller Unsicherheit................................ 332
8
7.2. Leben als Kampf um Akzeptanz ................................................ 334
7.3. Die jüngeren Verfolgten als Interim-Generation mit hoher
psychischer Belastung... ....... ........ ..................... ....... ......... ......... 335
8. Die Problematik der nachgeborenen Generation:
Fortführung einer Stigma-Identität ohne Stigma-
Erfahrung ......................................................................... 338
8.1. Zur Familiendynamik in den Herkunftsfamilien der
Nachgeborenen ................................................. ......................... 339
8.2. Jüdische Identität durch Übernahme einer
Verfolgtenidentität ................................................. .................... 342
8.3. 'Verweigerung von Lebenspraxis' und ideologische Abkehr
vom deutsch-christlichen Umfeld............................................... 343
8.4. Partnerwahl als Protest gegen die Mehrheitskultur..................... 346
8.5. Vielschichtige Identitätsangebote - zerrissene
Lebensentwürfe: Zum Identitätsmanagement der nach 1945
geborenen Kinder von christlichen Deutschen jüdischer
Herkunft............ .............................. ...... ................. ................... 349
9. Anhang: Übersicht aller Personen der Studie .................. 351
10. Bibliographie ...................... ....... .... ..... ... ......... ...... ............ 358
9
1. Einleitung
Die christlichen Deutschen jüdischer Herkunft verdanken ihre historische
Existenz als soziologische Gruppe einerseits der deutschen Emanzipations
bewegung des 19. Jahrhunderts, mit der die kasten artige wechselseitige
Abschottung der jüdischen und nichtj üdischen Welten endete. Sie verdanken
sie anderseits der sich gleichzeitig herausbildenden biologistischen Denk
form und ihrer politischen Instrumentalisierung.
Die 'Nürnberger Gesetze' und das ihnen zugrundeliegende Gedankengut
beeinflußten nicht nur die Vorstellungen breiter Massen von den Juden, die
nun weniger als religiöse oder ethno-religiöse Gruppe denn als 'Rasse' ver
standen wurden; durch die rassistische Neudefinition des Begriffes 'Jude'
wurden nun auch die christlichen Deutschen jüdischer Herkunft mit einer
veränderten sozialen Konnotation belegt, eingereiht in die Gruppe der Ver
folgten jüdischen Bekenntnisses. Sie wurden aus ihrer eigenen, von ihnen
mitstrukturierten Lebenswelt ausgegrenzt, von der ihnen bekannten und
vertrauten Gesellschaft und Kirche partiell marginalisiert und in ihrem
Selbstverständnis hinterfragt. Sie wurden 'Fremde', nicht durch Emigration,
sondern gerade weil sie ihr gewohntes Land nicht verließen. Damit wurde
ein <Denken wie üblich> -im Sinne von Alfred Schütz (1971) -, das auf der
Annahme der Kontinuität des gewohnten Lebens basiert sowie auf dem
Vertrauen in die durch die Kulturträger übermittelten Deutungsmuster,
substantiell brüchig. Es handelte sich hierbei um Menschen, die im Geiste
des Protestantismus, Katholizismus, als Agnostiker oder Atheisten aufge
wachsen waren. Sie entstammten allen Schichten und allen politischen
Strömungen der deutschen Bevölkerung und unterschieden sich nur durch
eine mitunter Generationen zurückliegende Konversionsproblematik (vgl.
Berger, 1973) oder/und interreligiöse Ehe vom Gros der christlichen Deut
schen ihrer Generation.
In dieser fallrekonstrukti v angelegten biographischen Forschungsarbeit
wird die Frage gestellt, wie christliche Deutsche jüdischer Herkunft die
objektive Verfolgungs situation und Brandmarkung subjektiv erlebten und
verarbeiteten und wie sie im weiteren Verlauf ihr Verhältnis zu identitäts
stiftenden Gruppen wie den Deutschen, den Christen und den Juden korri
gierten. Es wird untersucht, wie die Betroffenen die Zuordnung zum Juden
tum erlebten, in einer Zeit, als mit dieser kein positiver kultureller oder
religiöser Gehalt verbunden war, als sie nichts anderes bedeuten konnte als
11
Ausgrenzung, Verfolgung und sogar Vernichtung. Wie reflektierten die
christlichen 'Nichtarier' die Haltung ihrer jeweiligen Kirche zum National
sozialismus, wie schätzten sie die Äußerungen und Handlungen kirchlicher
und gesellschaftlicher Institutionen zu Faschismus, Rassenpolitik und Krieg
ein? Wie war die Familiendynamik beeinflußt, gab es Unterschiede zur
Dynamik jüdischer Familien? Es wird zudem der Frage nachgegangen, wie
die christlichen 'Nichtarier' die 'Vergangenheits bewältigung' nach dem
Zusammenbruch 1945 erlebten und wie dies wiederum ihre Haltung zum
Glauben, zur Institution Kirche und zur Nation beeinflußte.
Mehrheitlich waren diese Menschen dem Verfolgungsgrad nach soge
nannte 'Mischlinge I. Grades', d.h. Personen, die selbst christlich waren und
zwei jüdische Großeltern hatten. Ihre Verfolgung endete meist nicht in
einem Vernichtungslager, zu einer Emigration waren sie - anders als die
jüdischen Verfolgten - nicht existentiell gezwungen. Häufig jedoch mußten
die Betroffenen die Deportation und Emigration naher Familienangehöriger
verarbeiten, waren sozialen Deklassierungen und Heiratsbeschränkungen
sowie Zwangsarbeitseinsätzen unterworfen. Dem religiösen Bekenntnis nach
war die überwältigende Mehrheit aller nichtj üdischen 'Nichtarier' protestan
tisch, nur eine relativ kleine Gruppe von Betroffenen war dagegen römisch
katholischen Glaubens oder konfessionslos (vgl. Oberlaender, 1990). Die
'Nichtarier' erscheinen trotz ihres geringen historisch-politischen Gewichts
als Paradigma interessant, weil sich an ihnen Prozesse des Identitätsma
nagements exemplarisch untersuchen lassen. Aufgrund der Besonderheit der
künstlich geschaffenen ahistorischen Gruppe der christlichen 'Nichtarier',
verweist die Identitätsproblematik dieser Gruppe - so die Hypothese - als
Symptom auf den Zustand deutscher Identität während der Stigmaphase und
womöglich bis in die Gegenwart hinein (vgl. Oberlaender, 1992b, 1994a).
Die 'zweite Generation' verdankt ihre physische Existenz in Deutschland
der Tatsache, daß die christlichen 'Nichtarier' mehrheitlich in Deutschland -
weitgehend ohne Lager- und Emigrationserfahrung - überleben konnten.
Ihre soziologische Existenz leitet sich einerseits von der psychologisch
therapeutischen Aufarbeitung des survivor-syndrome (Niederland, 1961) der
jüdischen Holocaust-Überlebenden her, die ab den 70er Jahren sich verstärkt
einer second generation, also Kindern der Lagerüberlebenden, zuwandte
und den Begriff sukzessiv auf Kinder entwurzelter jüdischer Emigranten
ausweitete (vgl. Epstein, 1979; FogelmanlSavran, 1979; Grünberg, 1987).
Anderseits ist die 'zweite Generation 'Nichtarier" von der weltweiten ro
mantisch-biologistischen back to the roots - Bewegung (vgl. Cowan, 1990;
Haley, 1993) sowie von der für die ersten Nachkriegsjahrzehnte spezifisch
bundesrepublikanischen Suche nach Fremdidentifikation beeinflußt.
12