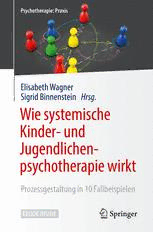Table Of ContentPsychotherapie: Praxis
Elisabeth Wagner
Sigrid Binnenstein Hrsg.
Wie systemische
Kinder- und
Jugendlichen-
psychotherapie wirkt
Prozessgestaltung in 10 Fallbeispielen
Psychotherapie: Praxis
Die Reihe Psychotherapie: Praxis unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit – praxisorientiert, gut
lesbar, mit klarem Konzept und auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.
Weitere Bände in der Reihe: http://www.springer.com/series/13540
Elisabeth Wagner
Sigrid Binnenstein
Hrsg.
Wie systemische
Kinder- und
Jugendlichen-
psychotherapie
wirkt
Prozessgestaltung in 10 Fallbeispielen
Mit einem Geleitwort von Dr. Wilhelm Rotthaus
Mit 7 Abbildungen
Herausgeber
Elisabeth Wagner Sigrid Binnenstein
Baden, Österreich Wien, Österreich
Psychotherapie: Praxis
ISBN 978-3-662-55546-0 ISBN 978-3-662-55547-7 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-55547-7
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 7 http://
dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer
© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2018
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen
Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektro-
nischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als
frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und kor-
rekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, aus-
drücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder
Äußerungen. Der Verlagbleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebiets-
bezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Verantwortlich im Verlag: Monika Radecki
Fotos: Peter Manfredini
Umschlaggestaltung: deblik Berlin
Fotonachweis Umschlag: © djama/Adobe Stock, ID-Nr. 57952028
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Deutschland
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
V
Geleitwort
Nichts ist so spannend und so lehrreich, als Einblick zu bekommen in die kon-
krete Arbeit erfahrener Therapeutinnen. Die Herausgeberinnen, die in diesem
Buch zusammen mit sieben weiteren Kolleginnen zehn Behandlungsverläufe
schildern und kommentieren, sprechen denn auch von einem Lernbuch. Sie
wollen das fachliche Denken fördern und zugleich aufzeigen, wie systemische
Kinder- und Jugendlichentherapie ihre hohe Wirksamkeit entfaltet.
Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie wäre grundlegend missver-
standen, wenn man sie als systemtherapeutisch geprägte Einzeltherapie ansähe.
Natürlich ist sie das auch. Doch vor allem zeichnet sie sich dadurch aus, dass
die Therapeutin zu jedem Zeitpunkt des Therapieprozesses wohlüberlegt den
oder die Adressaten auswählt, mit denen der nächste therapeutische Schritt am
ehesten zu gehen ist. Das konkretisiert sich in der Wahl des jeweils am geeig-
netsten erscheinenden Settings; man könnte fast sagen: Systemische Kinder-
und Jugendlichentherapie „lebt“ unter anderem von den gut begründeten
Settingentscheidungen. In diesem Buch machen das die Falldarstellungen
Jakob, Michelle, Lukas und Bahira sehr deutlich. Sie zeigen, welche Chancen
sich eröffnen, wenn die Vielzahl der Setting-Möglichkeiten – Familientherapie,
Einzeltherapie, Elternberatung, Paargespräche/Paartherapie, Einzeltherapie
mit dem Kind oder Jugendlichen vor den Augen und Ohren der Eltern (um nur
einige der Settingvarianten zu nennen) – genutzt werden.
Mir hat beispielsweise die Anregung gut gefallen, vor der ersten Begegnung mit
dem Klientensystem Informationen aus dem Anmeldegespräch – eventuell
ergänzt durch die Klärung einiger Fragen in einem Telefonat – zu bedenken und
zu entscheiden, in welchem Setting das Erstgespräch durchgeführt werden soll.
So ist es eine gute Idee, Eltern, die ihr Kind „zur Reparatur abliefern“ möchten
(was man ihnen prinzipiell nicht verübeln kann, ist ihnen dieses Vorgehen doch
aus der somatischen Medizin vertraut), zunächst ohne das „Problemkind“ zu
Elterngesprächen einzuladen. Die vielfältigen Belastungen der Eltern über lange
Zeit können dann hinreichend gewürdigt und die Themen und Ziele der Eltern
für das Kind sowie – ein ganz entscheidender Faktor gleich am Anfang der The-
rapie – die Ziele für sich selber können in aller wünschenswerten Genauigkeit
erarbeitet werden, wobei dann häufig schon erste Hinweise auf die Wechselwir-
kung zwischen beidem aufscheinen. Die nach ggf. mehreren Elterngesprächen
folgende Erstsitzung mit Eltern und Kind oder Jugendlichen verläuft dann
zumeist weniger konflikthaft und damit therapeutisch fruchtbarer. Aber auch
nach jeder Therapiesitzung sollte im Sinne eines möglichst wirkungsvollen The-
rapieverlaufs die Frage neu gestellt werden, wen die Therapeutin zur nächsten
Therapiestunde einladen sollte.
V I Geleitwort
Ähnlich wie bezüglich des Settings muss die Therapeutin bei der Methoden-
wahl ihre Prozessverantwortung wahrnehmen. Jeder neue Therapieschritt wird
abgewogen, um aus dem großen systemischen Methodenpool immer das aus-
zuwählen, was den Klienten am ehesten den nächsten Entwicklungsschritt
ermöglichen könnte. Dabei werden weniger die Inhalte als entscheidendes Kri-
terium herangezogen, sondern vielmehr die aktuelle Motivationslage und
Affektdynamik. Welcher Entwicklungs- und Veränderungsschritt scheint zur
Zeit emotional noch nicht möglich zu sein, welche Stärken und Ressourcen
müssen zunächst noch im Erleben der Klienten gefestigt werden, wie kann ein
Blick in die gelingende Zukunft die Zuversicht und Arbeitsmotivation bekräf-
tigen? – dies nur einige wenige Überlegungen, die ein planvolles Vorgehen
ermöglichen.
Natürlich entscheiden die Klienten darüber, welche Anregungen der Therapeu-
tin für sie passend sind, so dass sie sie aufgreifen können. Das entbindet die
Therapeutin aber nicht von der Notwendigkeit, ihr Vorgehen überlegt zu kon-
zipieren, nämlich ein professionelles Fallverständnis zu entwickeln, daraus eine
therapeutische Absicht abzuleiten und so den jeweils nächsten methodischen
Schritt zu wählen. Letztlich geht es darum, das Nicht-Planbare in jedem Augen-
blick des therapeutischen Prozesses neu zu planen.
Eine sehr bemerkenswerte Besonderheit dieses „Lernbuches“ liegt darin, dass
die Herausgeberinnen jeder Fallverlaufsdarstellung eine Reflexion des jeweili-
gen Fall- und Wirkverständnisses folgen lassen, um deutlich werden zu lassen,
welche Überlegungen den Prozess bestimmt haben, welche therapeutischen
Vorgehensweisen mit welcher Absicht, aber auch mit welchen Zweifeln gewählt
wurden. Sie veranschaulichen damit „die Architektur“ des jeweiligen Therapie-
verlaufs, ohne ihn als den einzig richtigen charakterisieren zu wollen. Diese
von den Herausgeberinnen gewählte Metapher der Architektur trifft das
Gesagte, als – nach Wikipedia – die zentralen Inhalte von Architektur das
„planvolle Entwerfen, Gestalten und Konstruieren“ sind. Diese Analogie lässt
sich noch vertiefen, wenn man heranzieht, dass – nach derselben Quelle –
Architektur im klassischen Verständnis nach Vitruvs Werk „de architectura“
(entstanden 22 bis 14 v. Chr.) auf den Prinzipien Stabilität (firmitas), Nützlich-
keit (utilitas) und Anmut/Schönheit (venustas) beruht. Stabilität, d. h. in der
Analogie: die Sicherheit in einer guten Therapiebeziehung, ist ohne Zweifel die
Basis des Therapieerfolgs und Nützlichkeit das entscheidende Merkmal im
Hinblick auf das Therapieziel des Klienten, das letztlich dieser selbst nur beur-
teilen kann. Das Kriterium der Anmut bzw. Schönheit erinnert an eine der drei
Grundkategorien von Kurt Ludewig für die Evaluation von Therapie, zu dem er
formuliert: „Wir betrachten einzelne Interventionen, ganze Sitzungen bzw.
Therapieverläufe dann als schön, wenn die Beteiligten im Zusammenpassen
der Aktivitäten des Therapeuten mit den Möglichkeiten seiner Kunden eine
derartige Korrespondenz gemessen an ihren Vorstellungen und Erwartungen
VII
Geleitwort
erkennen, dass sie sich veranlasst sehen, es als schön zu bewerten. Im Hinblick
auf das Therapieergebnis bezieht sich diese Bewertung auf das Passen zwischen
Mittel und Ergebnis“ (Ludewig K [1988] Nutzen, Schönheit, Respekt. Drei
Grundkategorien für die Evaluation von Therapien. System Familie 1:111).
Fallverlaufsdarstellungen müssen einen hochkomplexen, über die Zeit sich
ständig wandelnden Prozess notwendigerweise auf wenige Seiten komprimie-
ren. Das hat in diesem Buch dazu geführt, dass zu einigen Darstellungen von
Einzeltherapien meine Neugierde auf die Arbeit mit dem erweiterten Kontext
nur bedingt befriedigt wurde. Das gilt beispielsweise für die eindrucksvolle
Darstellung der Einzeltherapie der vierjährigen Julia, wo ich gerne noch erfah-
ren hätte, wie die teilstationäre Aufnahme des Mädchens konzipiert und die
Arbeit mit den Eltern trotz des Sorgerechtsentzugs sowie die Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt gestaltet worden ist. Entsprechend hätte ich auch gerne
mehr darüber erfahren, wie in der zu einem Kollegen ausgelagerten Paarthera-
pie der Eltern von Ellie die notwendigen Entwicklungsschritte der Eltern selbst
thematisiert und bearbeitet wurden und wie in der Therapie mit Catrin die
Stieffamiliensituation Berücksichtigung gefunden hat.
Aber auch in einem so anregenden Buch wie diesem können nicht alle Wün-
sche in Erfüllung gehen. Ich habe beim Lesen viel gelernt und danke allen
beteiligten Autorinnen für dieses schöne Buch. Ich hoffe, dass zahlreiche The-
rapeutinnen – nicht nur Vertreterinnen der systemischen Therapie, sondern
auch solche anderer Verfahren – das Buch in die Hand nehmen und ihr fachli-
ches Handeln in vielfältiger Weise bereichern lassen.
Wilhelm Rotthaus
Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Bergheim bei Köln im August 2017
Vorwort
Im vorliegenden Buch wird die Vielfalt der systemischen Zugänge zur Kinder-
und Jugendlichen-Therapie anhand von zehn vollständigen Fallverläufen ver-
schiedener Therapeutinnen dargestellt. Die Fälle wurden so gewählt, dass eine
möglichst große Bandbreite an Altersgruppen, Störungsbildern und Interven-
tionsschwerpunkten exemplarisch abgebildet wird. Durch die Darstellung des
jeweils gesamten Fallverlaufs sollen die Lesenden einen Einblick in die thera-
peutische Praxis und Anregungen für die eigene therapeutische Arbeit gewin-
nen. Während üblicherweise einzelne Interventionen und deren Wirksamkeit
beschrieben werden, wollen wir zeigen, wie mögliche Architekturen von
gesamten Therapieprozessen aussehen können. Welche Überlegungen steuern
den Prozess? Welche Interventionen werden mit welcher Absicht aber auch mit
welchen Zweifeln eingesetzt? Den Autorinnen ist bewusst, dass dies jeweils nur
mögliche, aber nicht einzigrichtige Architekturen sind. Jeder Fall benötigt eine
individuelle Herangehensweise und ist auch von der Person, dem Methoden-
repertoire und der Herangehensweise der Therapeutin, sowie von den Struktu-
ren, in denen psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen wird
(Praxis, Beratungsstelle, im stationären Kontext) und den sich daraus ergeben-
den Möglichkeiten beeinflusst.
Besonders wichtig war den Herausgeberinnen bei der Auswahl der Fälle, dass
das Familiensetting nicht zugunsten der einzeltherapeutischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen marginalisiert wird. Die Bearbeitung von Problemen
von Kindern und Jugendlichen im Familiensetting entspricht nicht nur deren
Lebenssituation (Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendli-
chen werden ganz maßgeblich durch ihre familiäre Lebenswelt bestimmt), son-
dern ermöglicht auch „mehrpersonale Veränderungsimpulse im System“ (vgl.
Rotthaus 2001, S. 9). Da Eltern in der Regel in hohem Maße für die Erfüllung
zentraler Bedürfnisse verantwortlich sind, können sie auch zur Überwindung/
Besserung kindlicher Leidenszustände beitragen, die sie nicht selbst verursacht
haben. Darüber hinaus war das interaktionelle Verständnis psychischer Pro-
bleme im Unterschied zur individualisierten Betrachtungsweise identitätsstif-
tendes Element früherer systemischer Psychotherapie. Warum also überhaupt
eine Fokussierung systemischer Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapie
(KiJu-Therapie)? Warum reicht das bewährte familientherapeutische Vorgehen
nicht aus? In der einschlägigen Fachliteratur werden folgende Argumente
gebracht: Da Kinder ihrem Alter entsprechend anders als Erwachsene denken
und fühlen, braucht es neben entwicklungspsycho(patho)logischen Kenntnis-
sen oft auch spezielle therapeutische Techniken und Vorgehensweisen, um
Kinder und Jugendliche gut in den therapeutischen Prozess miteinzubeziehen.
Kinder (ca. bis zum 12. Lebensjahr) sind weniger sprachorientiert, ihr Denken
ist weniger komplex und abstrakt, weniger realitätsbezogen und rational, wes-
halb Kinder in diesem Alter nur selten auf Anhieb ein konkretes Therapieziel
IX
Vorwort
formulieren können. Dies kann dazu führen, dass die Therapiegespräche von
den Eltern dominiert werden und die Kinder auf die Rolle von Zuhörern redu-
ziert werden, die wenig Möglichkeiten haben, ihre Anliegen, Sichtweisen und
Probleme einzubringen (vgl. Wilson 2003, Schmitt u. Weckenmann 2009).
Kinder sind in der Psychotherapie durch Sprache allein oft schwer zu errei-
chen. Dafür sind sie in der Regel phantasievoll, verfügen über eine hohe Imagi-
nationsfähigkeit und können sich gut nonverbal ausdrücken, sei es über
Zeichnungen, Handpuppen oder (Rollen-)Spiele. Je nach Entwicklungsstand
kann das magische Denken, die Suggestibilität, die Phantasietätigkeit oder das
symbolisierende Spiel therapeutisch genutzt werden. Aufgrund der kürzeren
Aufmerksamkeitsspannen ist darüber hinaus mehr an Abwechslung nötig, als
wir es aus Therapien mit Jugendlichen und Erwachsenen gewöhnt sind.
Unabhängig vom Setting, also sowohl in Einzel-, wie auch in Familienthera-
pien mit jüngeren Kindern bedarf es daher gewisser Modifikationen der thera-
peutischen Vorgehensweise, um Kinder zu erreichen. All diese Modifikationen
können mühelos in ein systemisches Verständnis von Therapieprozessen inte-
griert werden, erfordern aber zusätzliche Schulung und auch eine entspre-
chende Ausstattung der Therapieräume. Therapeutinnen, die mit Kindern
arbeiten wollen, sollten eine Vielzahl von Objekten und Materialien zur Verfü-
gung stellen, um die Ausdrucksmöglichkeit der Kinder zu ermöglichen und sie
sollten bereit sein, durch entsprechende spielerische Angebote den Kontakt zu
Kindern zu fördern. Dementsprechend haben sich neben dem klassischen
familientherapeutischen Vorgehen unterschiedliche Ansätze der systemischen
KiJu-Therapie entwickelt: neben den spezialisierten Therapieangeboten für
Kinder wurde auch eine Vielzahl an Methoden publiziert, mit denen Kinder
besser in Familientherapieprozesse einbezogen werden können. Um den
Lesenden die theoretische Zuordnung der einzelnen Fallbeispiele zu erleich-
tern, werden diese Ansätze im Einführungskapitel kurz vorgestellt, für eine
vertiefende Auseinandersetzung werden Hinweise auf die weiterführende
Fachliteratur gegeben.
Die hohe „Binnendifferenzierung“ systemischer KiJu-Therapie stellt gleicher-
maßen ein großes Potenzial wie auch eine große Herausforderung dar: Syste-
mische Therapeutinnen können nicht nur – sie müssen sich zwischen einer
Vielzahl von therapeutischen Herangehensweisen entscheiden. Dabei stellt die
Wahl des Settings – Familientherapie, Einzeltherapie mit dem Kind oder (Paar)
Arbeit mit den Eltern, bzw. eine Kombination dieser Settings – eine der zentra-
len Entscheidungen dar, in die viele Überlegungen einfließen müssen: Wo ist
der größte Bedarf? Welches Setting bietet die meisten Chancen auf Verände-
rung, verhindert Loyalitätskonflikte und fördert „bezogene Individuation“?
Was muss in diesem Zusammenhang in den verschiedenen Altersstufen und
familiären Konstellationen beachtet werden?