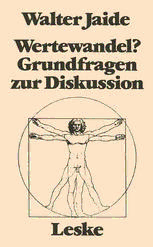Table Of ContentWalter Jaide
Wertewandel?
Walter Jaide
Wertewandel?
Grundfragen
zu einer Diskussion
+
Leske Budrich
Opladen 1983
CIP-Kurztitelaufnahrne der Deutschen Bibliothek
Jaide, Walter
Wertewandel ? Grundfragen zu e. Diskussion / Waiter
Jaide. - Opladen : Leske und Budrich, 1983. -
ISBN 978-3-8100-0421-5 ISBN 978-3-322-95459-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-95459-6
(c) 1983 by Leske Verlag + Budrich GmbH, Leverkusen
Gesamtherstellung: Hain Druck GmbH, Meisenheim/Glan
InhaIt
1. Einleitung................................ 7
2. Was hei~t Freiheit? ......................... 13
Definitionen von Werten
3. Werte im Gedankenspiel oder in der Anwendung? 18
4. Wie steht es heute urn soziale Sicherheit? ....... 24
Kenntnis der Wertverwirklichungen bis zur
Gegenwart
5. Kein Wert kann allein filr sich verwirklicht
werden .................................. 28
Kombination von Werten
6. Wie reagieren die Anderen auf die Anwendung von
Werten? ................................. 35
Gegenseitigkeit der Wertumsetzungen
7. Absolute Oberzeugungen oder allHigliche Wertan-
spriiche? ................................ 39
Stu/en der Werteinstellungen
8. Was steht obenan? ......................... 42
Rangordnungen von Werten
9. Wie weit gilt noch Leistungsorientierung und wie
wird Leistung aufgefa~t? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
10. Was ist geblieben - was hat sich verandert? ..... 57
Bestiindigkeit oder Wandel in den Werteinstellungen
11. Industrielle oder postindustrielle Werte ......... 66
12. Die "schweigende Mehrheit" ................. 73
l3. Wie bringt man Werte in eine Rangfolge? ....... 82
14. Systematische Abgrenzung von Werten - Zielen -
Normen ................................. 85
15. Perfekte Methoden - verworrene Ziele? ........ 96
Di//erenzen zwischen Mitteln und Zwecken,
Wirkungen und Gegenwirkungen
5
16. Werte und Gegenwerte .................... 103
17. Zur Psycho1ogie und Sozio1ogie der Werte ...... III
18. Langhin gilltige Werte ................... " 11 5
19. Historische Regenerationen. . . . . . . . . . . .. 124
20. Bio-psychische Konstanten und Normalitaten. " 131
21. Anthropo1ogische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . .. l36
22. Sch1uf.\wort ............................. 142
23. Literaturhinweise ........................ 144
6
1. Einleitung
Seit Jahrzehnten sprechen viele Autoren und Zeitge
nossen von Werteschwund, Wertezerfall oder Substanzver
lust. Sie meinen damit, da~ Werte wie z. B. Freiheit, Lei
stung oder Bildung unwichtig oder unverbindlich oder gar
unbekannt werden. Fast jeder wird damit angesprochen.
Und die meisten von uns stehen, wenn sie es ehrlich
zugeben, mehr oder minder unsicher vor dieser Problema
tik. Die davon ausgehende Beunruhigung bleibt ertraglich
und fruchtbar, solange man miteinander dartiber verhandelt,
das hei~t redet oder schreibt. Damit k6nnen - fUr den Leser
wie fUr seine Kinder, Zuh6rer, SchUler oder Lehrlinge -
zumindest Voreiligkeiten, Vorurteile oder einseitige
Standpunkte abgebaut werden. Und es k6nnen auf diesem
neuen Gebiet allmahlich zuverlassige Informationen erar
beitet werden. 1m Zuge so1cher Dialoge und Besinnungen
sollte man allerdings nicht verkennen, da~ es innerhalb der
Wertediskussion auch Krafte gibt, die Verwirrung oder
Umsturz bewirken oder fOrdern.
Gerade deshalb sollte man sich die Prozesse vor Augen
stellen, die Entstehung, Bestand, Veranderung oder Zerfall
von Wert en mit sich fUhren und tiber Heil oder Elend der
Menschen, tiber Erhalt oder Zerst6rung unserer Erde ent
scheiden k6nnen. Dabei sind zunachst Kliirungen wichtiger
als Bekehrungen, Argumente wichtiger als Standpunkte,
- wobei auch bisher ungewohnte Aspekte in Betracht zu
ziehen sind.
Fraglos gibt es viele Anzeichen fUr einen Wertewandel.
Aber es ist sehr schwierig, dergleichen Veranderungen
zu beweisen. Es mti~ten historische, soziologische, psycho
logische Nachweise geliefert werden, da~ gegentiber ver-
7
gangenen Zeiten (welchen?) bei bestimmten Bevolkerungs
gruppen (wiederum: welchen?) einzelne Werte (nochmals:
welche?) ihre Bedeutung verloren haben oder zu verlieren
drohen. Woher soll man solche Beweise nehmen: aus zeit
genossischen Romanen, aus Tagebiichern und Autobio
graphien, aus ideengeschichtlichen oder systemanalytischen
Betrachtungen oder aus erfahrungswissenschaftlichen (oder
auch amtlichen) Daten iiber Entwicklungen und Verande
rungen im Bewu~tsein und Verhalten bzw. in den Lebens
zielen und Lebensformen? Oder aus der taglichen, per
sonlichen Erfahrung oder der blo&n Erinnerung?
Trotz dieser schwierigen Beweisiage soll Wertewartdel
nieht einfach in Abrede gestellt werden. Urn die Sattelzeit
(1789) und wiederum ein lahrhundert spater in den "Griin
derjahren" und in den Nachschatten des Ersten und Zweiten
Weltkrieges sind - analog zu Veranderungen, Noten, ja
Katastrophen im Leben weiter Bevolkerungsteile - Be
wu~tseinsveranderungen wahrscheinlich, auch und gerade
im Wertbewu~tsein. Aber woher solI man ein konkretes,
beweisfahiges Wissen dariiber gewinnen? Man steht dabei
bereits in historischen Kombinationen aus Entwieklungen
der Lebensverhaltnisse einerseits und daraus resultierenden
Veranderungen der Einstellungen andererseits. Aber Kon
zepte iiber soIche Zusammenhange sind durchaus fragwiir
dig. Bevolkerungsdruck bzw. Oberbevolkerung z. B. mag
Konkurrenzstreben, Leistungsorientierung und Normen
strenge - aber eben so auch Solidaritat, Subsidiaritat und To
leranz fordern. Bevolkerungsverminderungen mogen bei den
"schwachen" Geburtsjahrgangen mehr Spielraum fiir ein
erfolgreiches oder einfaches Leben lassen, jedoch nur so fern
die Gesamtgesellschaft ihnen geniigend Arbeitsplatze an
bieten kann und will. Wirtschaftliche Mangelzeiten mogen
andere Werte heraufbeschworen als Zeit en des Wohlstandes,
obwohl die Menschen auch darauf alternativ oder ambi
valent reagieren konnen. Diejenigen, die den Wohlstand
genie~en, mogen andere Werte bevorzugen als diejenigen,
die daran einen geringeren Anteil haben und erst recht
tiichtig sein oder resignieren miissen; denn Wohlstand war
und ist in den Gesellschaften stets ungleich verteilt. Das
8
gilt analog fUr Bildung, Arbeit und Freizeit. Und damit
steht man vor der Au/spaltung der Bewu~tseinsentwicklung
wahrend derselben Zeitlaufe nach Klassen, Schichten,
Gruppen, Teilen der BevOikerung, die ungleich an den
objektiven Veranderungen bzw. Errungenschaften oder
Verlusten teilhaben und - falls die entwicklungstheore
tische Annahme stimmt - auch ungleich darauf reagieren
- auch mit ihren Werteinstellungen.
Erst recht miissen die objektiven Veranderungen in ihren
zeitlichen Verschiebungen und Reibungen, ihren Zusam
menhiingen und Kontrasten analysiert werden. Was bringen
z. B. Veranderungen der Bevolkerungsentwicklung fUr
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildungswesen denn wirk
lich mit sich - zu den verschiedenen Zeit en und in bezug
auf die verschiedenen Bevolkerungsschichten? Und was
bringt eine Entwicklung zu Wohlstandsgesellschaft oder
Wohlfahrtsstaat wirklich mit sich? Ein einfacher Sozial
determinismus tragt wenig zur KHirung beL
Wenn die Auswirkungen der "objektiven" sozialen
Wandlungen schon sehr vielschichtig und fragwiirdig er
scheinen, so muB man weiterfragen, was vorausgeht: die
Veranderungen der sozio-okonomischen und politischen
Gegebenheiten oder die Veranderungen der Mentalitaten?
Was bedeutet hierbei Huhn oder Ei? Vermutlich wirken sie
wechselseitig und schubhaft je nach den Machtverhaltnissen
aufeiminder ein.
Oder fachlich gesprochen: es ist zwar wissenschaftlich
richtig, daB man die Erorterung von Werteinstellungen und
deren Veranderungen nur im Rahmen der zeitgeschichtli
chen, gesellschaftlichen Gegebenheiten und deren Fortent
wicklungen leisten konne. Aber einerseits ist es schwierig,
diese Gegebenheiten in ihren Zusammenhangen und Ten
denzen hinreichend und zutreffend zu analysieren. Und
andererseits muB man herausbekommen, wie solche
"objektiven" Tatsachen denn nun konkret und verschie
denartig von der Bevolkerung bzw. der Jugend erlebt, ver
arbeitet und beantwortet werden.
Der Leser mag diese verwirrende Vielfalt der kritischen
Aspekte verzeihen. Viel verwirrender und praktisch unheil-
9
voller jedoch ist die Aufstellung voreiliger Verallgemeine
rungen oder Typisierungen und angeblicher Zeittrends. Die
bisher vorliegenden empirischen Befunde erfassen noch zu
wenig von der Wirklichkeit, - ihre Deutungen oder die
freien Spekulationen zum Thema greifen bereits zu weit
dariiber hin. Viele Meinungen sind zu schon, urn nicht ganz
unwahr zu sein, aber der Zweifel bleibt und fordert genaue
res Zusehen. Deshalb solI hier eine Besinnung iiber Vermu
tungen, Wahrscheinlichkeiten, Moglichkeiten, Daten und
Bedingungen des Wertewandels angestellt werden.
Dahinter erhebt sich die weitere Frage: haben Werte
wirklich eine so grof.)e Bedeutung fiir eine Gesellschaft bzw.
fiir welche Gruppen und Individuen in ihr? Haben sie nur
eine positive Bedeutung oder auch die Funktion von Schein
und Vorwand-Idealen, von Ubertreibungen und Verfiih
rungen? Oder haben sie gar negative Wirkungen, nlimlich
die Fesselung innerer individueller Selbstbestimmung durch
offentlich festgelegte Ideale? Je unstrittiger solche Werte
in einer Gesellschaft bestehen, urn so eher sind sie auch
dem Mif.)brauch ausgeliefert. Und sie sind weidlich mif.)
braucht worden; das lehrt die Geschichte. Pharisliertum
und Bigotterie haben sich nicht nur der "alten", sondern
llingst auch der "neuen" Werte bemachtigt. Deshalb sei
eine Entideologisierung und damit eine sehr kritische "Be
wertung" von Werten und stattdessen ein Umstieg auf
Ziele uhd Normen eine gute Sache oder zumindest ein
industriegesellschaftliches Fatum, so kann man argumen
tieren.
Vielfach wird behauptet, daf.) gerade junge Menschen ei
nen engeren Bezug zu Wert en haben als Altere, daf.) sie
weniger pragmatisch und alltaglich als vielmehr grundsatz
lich und idealistisch denken und empfinden, daf.) sie ver
kiimmerte oder vergessene Werte (wie z. B. Selbstbestim
mung, innere Harmonie, soziale Gerechtigkeit) wieder ernst
nehmen und damit in Gegensatz zur ErwachsenengeselI
schaft geraten. Andererseits wird behauptet, daf.) junge
Menschen die von Erwachsenen noch proklamierten oder
befolgten Werte geringschatzen und entmachten und sich
dem blof.)en "Lustgewinn" hingeben.
10
Auch dies sind plausible Unterstellungen, fUr die sich
manches anfUhren laflt. Aber wie will man das eine oder
das andere beweisen? An welchen Daten oder Fakten will
man dergleichen prazise ablesen? Welche Teile der Jugend
bevolkerung meint man damit - welche Jahrgange in
welchem Alter? Vermutlich entwickeln sich innerhalb der
selben Jugendjahrgange sehr gegenlaufige Werteinste11un
gen. Welche Werte sind geschwunden oder wieder heraufge
kommen? Geht es iiberhaupt urn "andere" Werte oder nur
urn veranderte Ausmiinzungen? Geht es urn eine Abschwa
chung der Geltung von Werten oder urn eine ehrlichere An
wen dung? Auch miiflte man Zeitreihen aufstellen und Ge
nerationen bzw. Jugendgenerationen voneinander trennen
und un terse heiden, urn eine zeitgeschichtliche bzw. sozio
logische Analyse anzustellen. Man miiflte sich auf eine Be
zugs- oder. Vergleiehsbasis einigen: etwa die Zeit der Wei
marer Republik (soweit wir sie kennen), von der ausgehend
man Veranderungen im Wertbewufltsein aufzeichnet.
Eine Fiille von Fragen gewifl und doch nur eine erste
Prasentation aus viel mehr Fragen, die man nicht mit
Anspielungen oder Redensarten bewiiltigen kann und darf.
1m folgenden, wird ein sonst weniger iiblicher Gedankengang
beschritten:
Zunachst wird gefragt, was Einzelne oder gesellschaft
liche Gruppen eigentlich meinen, wenn sie bestimmte
Werte nennen und erortern (Kapitel 2.).
Sodann wird gefragt, wie man Werte - gemafl ihrer ge
naueren Interpretation - praktisch anwendet oder verwirk
licht (Kapitel 3.). Danach mufl man sich Uber die Ausgangs
situation klar werden, in der man steht und eine - besse
re - Wertverwirklichung anstrebt (Kapitel 4.).
Eine realistische Wertumsetzung ist nur durch Kombi
nation oder Kontrastierung mehrerer Werte moglich (Kapi
tel 5.). Schliefllich solI man einkalkulieren, wie die davon
betroffenen Menschen daraufreagieren werden (Kapitel 6.).
Die weitere Gedankenfiihrung folgt eher vertrauten
Uberschriften.
In den folgenden Kapiteln so11 versucht werden, die
Fragen zu prazisieren und Antworten darauf zu finden.
11