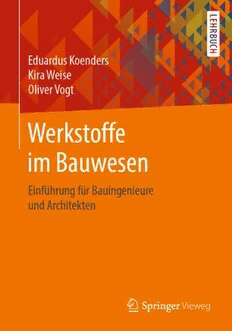Table Of ContentEduardus Koenders
Kira Weise
Oliver Vogt
Werkstoffe
im Bauwesen
Einführung für Bauingenieure
und Architekten
Werkstoffe im Bauwesen
Eduardus Koenders · Kira Weise · Oliver Vogt
Werkstoffe im Bauwesen
Einführung für Bauingenieure
und A rchitekten
Eduardus Koenders Kira Weise
Institut für Werkstoffe im Bauwesen Institut für Werkstoffe im Bauwesen
Technische Universität Darmstadt Technische Universität Darmstadt
Darmstadt, Deutschland Darmstadt, Deutschland
Oliver Vogt
Institut für Werkstoffe im Bauwesen
Technische Universität Darmstadt
Darmstadt, Deutschland
ISBN 978-3-658-32215-1 ISBN 978-3-658-32216-8 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32216-8
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,
ein Teil von Springer Nature 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem
Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung
unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen
Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch
die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des
Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und
Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Lektorat: Ralf Harms
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist
ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Das Werk wurde als vorlesungsbegleitendes Skript für den Teil
Baustoffkunde des Moduls „Werkstoffe im Bauwesen“ an der Technischen
Universität Darmstadt verfasst. Die Veranstaltung ist als Pflichtmodul
Bestandteil der Bachelorstudiengänge Bauingenieurwesen und Geodäsie,
Umweltingenieurwissenschaften sowie Wirtschaftsingenieurwesen mit der
technischen Fachrichtung Bauingenieurwesen.
Das Buch richtet sich insbesondere an Studierende des Bau- und
Umweltingenieurwesens, der Architektur sowie verwandten
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Es kann als vorlesungsbegleitendes
Lernmedium sowie im Selbststudium verwendet werden und dient
Baupraktikern als nützliches Nachschlagewerk.
Die Mitautoren Koenders und Vogt danken Frau Weise für die Organisation
und das enorme Engagement zur Realisierung dieses Werkes.
Darmstadt Eduardus Koenders
im Oktober 2020 Kira Weise
Oliver Vogt
Inhaltsverzeichnis
1 Beton 1
1.1 Mineralische Bindemittel 2
1.1.1 Klassifizierung von Bindemitteln 3
1.1.2 Gips 6
1.1.3 Kalk 15
1.1.3.1 Luftkalk 17
1.1.3.2 Hydraulischer Kalk 21
1.1.4 Zement 23
1.2 Gesteinskörnung 50
1.2.1 Einteilung 51
1.2.2 Korngruppe und Kornzusammensetzung 52
1.2.3 Wasseranspruch 60
1.2.4 Packungsdichte 61
1.2.5 Dichte und Porosität 62
1.2.6 Anforderungen 66
1.2.7 Konformitätsnachweis 77
1.3 Betonzusätze 77
1.3.1 Betonzusatzstoffe 78
1.3.2 Fasern 91
1.3.3 Betonzusatzmittel 92
1.3.4 Betonverflüssiger (BV) 94
1.3.5 Fließmittel (FM) 95
1.3.6 Luftporenbildner (LP) 99
1.3.7 Beschleuniger (BE) 101
1.3.8 Verzögerer (VZ) 102
1.3.9 Dichtungsmittel (DM) 103
1.4 Frischbeton 103
1.4.1 Abgrenzung zu Festbeton 104
1.4.2 Eigenschaften und Frischbetonprüfungen 105
1.4.3 Verarbeitbarkeit und Konsistenzklassen 106
1.4.4 Frischbetonrohdichte 116
1.4.5 Luftgehalt 117
1.4.6 Frischbetontemperatur 118
1.4.7 Zusätzliche Eigenschaften von SVB 120
1.4.8 Einbau und Verdichten des Betons 125
VIII Inhaltsverzeichnis
1.4.9 Nachbehandlung 129
1.5 Festbeton 132
1.5.1 Eigenschaften und Festbetonprüfungen 132
1.5.2 Festigkeit 133
1.5.3 Dichte und Wassereindringtiefe 149
1.5.4 Lastabhängige Formänderungen 151
1.5.5 Lastunabhängige Formänderungen 154
1.6 Expositionsklassen 157
1.7 Mischungsentwurf 172
1.7.1 Vorgehen zur Erstellung eines Mischungsentwurfes 173
1.7.2 Beispiel eines Mischungsentwurfs 188
1.8 Literatur (Kapitel 1) 196
2 Betonstahl und Korrosion 199
2.1 Herstellung von Stahl 201
2.2 Eigenschaften 205
2.3 Formgebung 208
2.4 Betonstahl 209
2.5 Korrosion von Stahl in Beton 211
2.6 Literatur (Kapitel 2) 216
3 Holz 217
3.1 Aufbau und Zusammensetzung 218
3.2 Eigenschaften 221
3.2.1 Festigkeit und Versagensmechanismus 222
3.2.2 Holzfeuchte, Schwinden und Quellen 225
3.2.3 Verformungsverhalten 231
3.2.4 Schädlingsresistenz und Holzschutz 233
3.2.5 Brandverhalten 237
3.3 Holzwerkstoffe 238
3.3.1 Brettschichtholz 238
3.3.2 Steg- und Fachwerkträger 239
3.3.3 Sperrholz 240
3.3.4 Strang- und Flachpressplatten 242
3.3.5 Holzfaserplatten 242
3.4 Literatur (Kapitel 3) 243
Inh altsverzeichnis IX
4 Kunststoffe 245
4.1 Herstellung von Kunststoffen 246
4.1.1 Polymerisation 247
4.1.2 Polykondensation 248
4.1.3 Polyaddition 248
4.1.4 Molekulare Kräfte 249
4.2 Kunststoffarten 253
4.2.1 Thermoplaste 253
4.2.2 Duroplaste 255
4.2.3 Elastomere 256
4.3 Eigenschaften von Kunststoffen 257
4.4 Fertigungsverfahren 258
4.5 Literatur (Kapitel 4) 260
1 Beton
Bereits vor 7000 Jahren wurden erste betonähnliche Kompositbaustoffe
(Verbundwerkstoffe) eingesetzt, wobei das vorteilhafte Zusammenfügen von
Gesteinskörnung und Bindemittel vermutlich zufällig entdeckt wurde. An der
Grenze zwischen dem heutigen Rumänien und Serbien wurden Überreste
einer Zivilisation aufgefunden, die schon um ca. 5000 v. Chr. die Fußböden
ihrer Hütten mit einer Art Mörtel ausstatteten. Der Weg bis zum heutigen
Beton nahm seinen Ursprung um etwa 300 v.Chr. bei den Griechen in
Süditalien. Sie bauten zwei Wände aus Natursteinen, zwischen die sie kleine
und große Bruchsteine füllten und verdichteten. Darüber wurde ein
Kalkmörtel gegossen, der die Materialien fest miteinander verband. Bernard
Forest de Bèlidor, ein Bauingenieur aus Frankreich, beschrieb im 18.
Jahrhundert eine Art Grobmörtel, aus Gesteinskörnung und hydraulischem
Kalk, als „bèton“ und prägte somit den Namen dieses Baustoffes. [1]
Beton ist ein Baustoff, der durch Mischen von Zement, grober und feiner
Gesteinskörnung und Wasser, mit oder ohne Zugabe von Zusatzmitteln und
Zusatzstoffen oder Fasern, hergestellt wird und seine Eigenschaften durch
Hydratation des Zements erhält. (DIN EN 206)
Mörtel ist als Beton mit einem Größtkorn (D ) von 4 mm definiert.
max
(DIN EN 206)
Beton und Mörtel sind bis heute die meist verwendeten Stoffe im Bauwesen
und folglich für den Bauingenieur von besonderer Bedeutung.
Das erste Kapitel dieses Vorlesungsskriptes dient der ausführlichen
Beschreibung des Verbundwerkstoffs Beton. Hierzu werden in den
nachfolgenden Kapiteln zunächst die Ausgangsstoffe erklärt. Sie umfassen
neben dem Zugabewasser insbesondere das Bindemittel, die
Gesteinskörnung und optional Zusatzstoffe und Zusatzmittel. Anschließend
werden die Eigenschaften und Prüfverfahren von Frisch- und Festbeton
erläutert. Das darauf folgende Kapitel dient der Beschreibung und
Kategorisierung von Umwelteinflüssen, denen Betonbauteile ausgesetzt sein
können und die bei der Rezepturentwicklung des Betons anhand von
Expositionsklassen berücksichtigt werden müssen. Das Vorgehen bei der
Entwicklung der Betonzusammensetzung und die Berechnung der jeweiligen
Anteile der Ausgangsstoffe, zum Erreichen von bestimmten
Betoneigenschaften, werden im Kapitel Mischungsentwurf beschrieben.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
E. Koenders et al., Werkstoffe im Bauwesen,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32216-8_1
2 1 Beton
1.1 Mineralische Bindemittel
Die ältesten Bindemittel, die zum Bauen verwendet wurden, waren
vermutlich Ton und Lehm. Menschen errichteten Behausungen, wie
beispielsweise Hütten, aus Ästen und füllten die entstandenen
Zwischenräume mit nasser Erde. Dieses natürliche Bindemittel „erhärtet“
durch Austrocknung und ist im luftgetrockneten Zustand relativ robust. Im
Unterschied zu Bindemitteln die ihre Festigkeit durch Trocknungsprozesse
erlangen, läuft bei der Erhärtung von mineralischen Bindemitteln, die
heutzutage im Bauwesen eingesetzt werden, meist ein chemischer Prozess
ab. [1]
Unter dem Begriff Bindemittel sind Stoffe zu verstehen, die primär dazu
dienen, eine Vielzahl separater Partikel oder Fasern miteinander zu
verbinden und auf diese Weise einen Teilchen- oder Faserverbundwerkstoff
zu erzeugen. Dabei werden die Vorteile der jeweiligen Komponenten
hinsichtlich eines spezifischen Anwendungszwecks miteinander kombiniert.
Ein Beispiel für einen Verbundwerkstoff ist Beton. Das Bindemittel Zement
reagiert mit dem Zugabewasser zu einer festen Bindemittelmatrix, dem
sogenannten Zementstein. Dieser dient primär dazu, die Gesteinskörnung
miteinander zu verbinden. Somit liegt ein Verbundwerkstoff, bestehend aus
den Komponenten Gesteinskörnung und Zementstein vor. Dabei werden die
Vorteile beider Komponenten in betontechnologischer und ökonomischer
Hinsicht genutzt. Gesteinskörnung ist deutlich kostengünstiger als Zement
und hat in der Regel einen höheren E-Modul, sodass Kräfte in einem
Normalbeton hauptsächlich über das Gesteinsgerüst abgetragen werden. Der
Zementstein wiederum dient nicht nur dem Zusammenhalt der
Gesteinskörnung, sondern auch dazu, dem Beton einen erhöhten pH-Wert
(>13) zu verleihen. Durch das alkalische Milieu wird die Stahlbewehrung im
Beton vor Korrosion geschützt. Dieses Beispiel zeigt, dass die jeweiligen
Vorteile unterschiedlicher Komponenten in einem Verbundwerkstoff durch
den Einsatz von Bindemittel miteinander kombiniert und auf einen
spezifischen Anwendungszweck hin abgestimmt werden können. Dieses
Erfolgsrezept hat dazu geführt, dass Verbundwerkstoffe – gemessen an ihrer
Baumasse und an ihren Bauvolumina – die heute weltweit meistverwendeten
Baustoffe darstellen.
Die Abgrenzung des Bindemittels vom klassischen Kleber erfolgt anhand von
zwei wesentlichen Unterschieden: