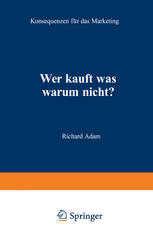Table Of ContentAdam· Wer kauft was warurn nicht?
Richard Adam
Wer kauft was
warum nicht?
Konsequenzen filr das Marketing
GABLER
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Adam, Richard:
Wer kauft was warum nicht? : Konsequenzen fUr das Marketing
/ Richard Adam. - Wiesbaden : Gabler, 1993
ISBN-J3: 978-3-322-82728-9
DerGabler Verlag istein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1993
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1993
Lektorat: Ulrike M. Vetter
Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge
schUtz!. Jede Verwertung auBerhalb derengen Grenzen des Urheber
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulassig und
strafbar. Das gilt insbesondere fUr Vervieif<iltigungen, Ubersetzun
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
Htichste inhaltliche und technische Qualitat unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produk
tion und Verbreitung unserer BUcher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf
saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Buchverpackung besteht aus
Polyathylen und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch
bei der Verbrennung Schadstoffe freisetzen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daB sol
che Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be
trachten waren und daher von jederrnann benutzt werden dUrften.
Umschlaggestaltung: Schrimpf und Partner, Wiesbaden
Satz: Satztechnik, Taunusstein
ISBN-13 978-3-322-82728-9 e-ISBN-13: 978-3-322-82727-2
DOl 10.1007/978-3-322-82727-2
Meinen Eltern
und meiner Frau Harumi
Inhaltsverzeichnis
1. Wertewandel in der Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
1.1 Wertewandel als ErkHirungsprinzip .................. 11
1.2 Begriffsbestimmung des Wertewandels ............... 11
1.3 Ursachen und Indikatoren des Wertewandels . . . . . . . . . .. 14
1.4 GesellschaftIicher Konflikt durch den Wertewandel ..... 18
1.5 Richtungen des Wertewandels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
1.6 Vom Wertewandel zum Paradigmenwechsel ........... 21
1. 7 Der Zeitgeist in der Wirtschaft ...................... 22
1.8 Zusammenfassung................................ 23
2. Urn was geht es? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
2.1 System und Verlinderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
2.2 Marketing im Wandel ............................. 25
2.3 Quantitative und qualitative Anslitze der Marketing-
Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
3. Gesellschaftliche EinfluBgroBen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
3.1 Makrobetrachtung der Konsumentenumwelt ........... 30
3.2 Wie erfaBt man "Wandel"? ......................... 34
3.3 Interpretation der Ergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
4. Individuelle EinfluBgroBen .............................. 40
4.1 Mikrobetrachtung der Konsumentenumwelt . . . . . . . . . . .. 40
4.2 Das Lebensstil-Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42
4.3 Lebensphasen als Lebenszyklusdeterminanten
der Lebensstile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
4.4 Anforderungen des Marketing an Lebensphasen-und
Lebensstilkonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77
7
5. Gegentiberstellung ausgewahlter Typologien . . . . . . . . . . . . . . .. 81
5.1 Das Identifikationsproblem bei der Typologiewahl ...... 81
5.2 Untersuchungssteckbriefe ausgewahlter Querschnitts-
Typologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83
5.3 Untersuchungssteckbriefe ausgewahlter Langsschnitt-
Typologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
5.4 Beurteilungskriterien von Typologien . . . . . . . . . . . . . . . .. 88
6. Beschreibung herrschender Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
6.1 Begriindung der vorliegenden Trendgliederung und
Trenddifferenzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
6.2 Die exogenen Megatrends ........................ " 93
6.3 Die endogenen Folgetrends ......................... 118
7. Die graphischen Strukturmodelle ......................... 149
7.1 Das Strukturmodell der Trendvariablen ............... 149
7.2 Das Strukturmodell der Instrumentalvariablen .......... 149
8. Lebensstile als Konsumstile ............................. 153
8.1 Lebensstile als Determinanten der Konsum-
entscheidung .................................... 153
8.2 Lebensstile als Beitrag zum Wandel .................. 156
8.3 Lebensstile als Determinanten der Praferenzbildung ..... 162
8.4 Ein Lebensstilmodell zum Konsumentscheidungspro-
zeB ............................................ 167
9. Gibt es einen "Neuen Konsumenten"? ..................... 171
9.1 Das ,neue' Verbraucherparadigma ................... 171
9.2 Veranderte Charakteristik des Verbraucherverhaltens .... 172
9.3 Kritische Wtirdigung der Diskussion tiber den ,neu-
en' Konsumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176
10. Konsum und Sinnstiftung ............................... 179
10.1 Exkurs: Wissenschaft, Autoritat, Deutung ............. 179
10.2 Konsum und Distinktion ........................... 181
10.3 Konsum und Lustgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185
8
11. Konsequenzen flir das Marketing ......................... 189
11.1 Identifikation der Markte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
11.2 Der Faktor Zeit als bestimmender Wettbewerbsfaktor . . .. 191
11.3 Die Bedeutung des Oko-Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195
11.4 Die Bedeutung des Sozio-Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . .. 199
11.5 Die Integration des Konsumenten in die Produktpoliik ... 204
11.6 Die Integration der Informationstechnologie ........... 209
11.7 Von der Segmentierung zur Fragmentierung ........... 215
11.8 Das Konzept der situativen Ganzheitlichkeit ........... 217
12. SchluBbetrachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224
Literatur ................................................ 227
9
1. Wertewandel in der Gesellschaft
1.1 Wertewandel als ErkHirungsprinzip
Der Begriff des Wertewandels ist seit lahren in aller Munde. Er wird als
Erklfuungsprinzip fUr eine betrachtliche Anzahl gesellschaftlicher Veran
derungen in Anspruch genommen. Dabei kann es sich beispielsweise urn
zeitweilige Unruheerscheinungen unter lugendlichen, urn die emanzipa
torischen Bestrebungen der Frauen, urn Irritationen in der politischen
Landschaft, urn den Wandel der Einstellung zur Arbeit sowie urn die
scheinbar abnehmende Durchschaubarkeit des Konsumentenverhaltens
handeln. Die Bezugnahme auf den Wertewandel scheint die Moglichkeit
zu eroffnen, verschiedene und auf den ersten Blick isolierte Faktoren auf
einen gemeinsamen Herkunfts- und Bedeutungsnenner zu bringen. Diese
Motivation kommt in Anlehnung an Klages (1988, 11) dem Orientierungs
bediirfnis nach Ubersichtlichkeit und Einfachheit von Erklfuungen entge
gen.
Wird iiber Wertewandel und seine Folgeerscheinungen geschrieben, gibt
es hinsichtlich Bewertung und Interpretation in der Tendenz zwei Lager:
einige Autoren sehen hierin ein "begriiBenswertes Zeichen einer notwen
digen Besinnung und Urnkehr", wahrend andere daraus eine ,,Bedrohung
unserer Wirtschaft und Gesellschaft und ein Zeichen fUr den Verfall der
,biirgerlichen Tugenden'" folgem (von Rosenstiel et al., 1989,7). Kastner
(1990, 33) sieht in diesem Zusammenhang "nicht nur eine traurige Be
gleiterscheinung einer ansonsten positiven technischen und sozialen Ent
wicklung, sondem auch eine Notwendigkeit".
1.2 Begriffsbestimmung des Wertewandels
Gerade weil der Begriff "Wert" im wirtschaftlichen Kontext spontan mit
materieller Assoziation einhergeht, ist die fiir den Leser gelegentlich lei
dige Begriffsbestimmung kaum entbehrlich.
11
Kluckhom (1951) spricht bei Werten von "Auffassungen yom Wtinschens
werten, die explizit oder implizit flir einen einzelnen oder ein soziales
Aggregat kennzeichnend sind und die die Auswahl der zuganglichen Wei
sen, Mittel und Ziele des Handelns beeinflussen" (zit. n. von Rosenstiel,
1990, 132).
In einer gegenwfu1:ig vielfach zitierten Definition werden "Werte" allge
mein umrissen als "innere FtihrungsgroBen des menschlichen Tuns und
Lassens, die tiberall dort wirksam werden, wo nicht biologische Triebe,
Zwange oder rationale Nutzenerwagungen den Ausschlag geben" (Klages,
1985,9).
Die Gleichsetzung der Begriffe "Werte, Werthaltungen, Wertorientierun
gen, Werteinstellungen ... und anderer Wertbegriffe" geschieht in Anleh
nung an Silberer (1991, 3), der "Werte" als "elementare, individuelle
Vorstellungen yom Wiinschenswerten" im Verstandnis von "grundlegen
den Ziel- oder Normvorstellungen" definiert (ebd.).
Raffee und Wiedmann (1987a, 15) charakterisieren Werte sehr ahnlich als
"grundlegende, explizite und/oder implizite Konzeption des Wtinschens
werten". Dabei dtirfen einzelne Werte gesellschaftlicher oder individueller
Natur nicht isoliert, sondem nur in ihrer Einbindung in Wertsysteme be
trachtet werden: "Verhaltenssteuemd ist letztlich immer das gesamte Wert
system und dabei insbesondere die Stellung einzelner Werte in der Wert
hierarchie" (Raffee/Wiedmann, 1987a, 15). Ein "Wandel" muB demnach
als eine "Veranderung im Wertsystem" (ebd., 22) begriffen werden.
Werte werden meist als "nicht gegenstandsbezogene Orientierungspunkte
auf hohem Abstraktionsniveau verstanden, die allerdings flir den einzelnen
in einer konkreten Situation zu handlungsleitenden gegenstandsbezogenen
Einstellungen werden konnen" (von Rosenstiel, 1990, 132). Dies betont
auch Silberer (1991, 3): "Auf Objekte oder Handlungen fokussierte Wer
tungen oder Wtinsche" werden davon ausdrticklich nicht erfaBt (vgl. ebd.),
obwohl demgegentiber die Schwierigkeit eingeraumt wird, "zwischen per
sonalen Grundwerten einerseits und objektspezifischen Praferenzen ande
rerseits" generell und eindeutig zu trennen (ebd.). Ftir Silberer stehen
Werte hinter "Strebensinhalten und damit flir Dispositionen von Men-
12
schen, nicht fUr Attribute von Objekten", was vor allem in den Begriffen
"Werthaltungen" und "Werteinstellungen" zum Ausdruck kommt und die
Unterscheidung yom "Wert wirtschaftlicher Giiter" im Sinne der Betriebs
wirtschaft ermoglicht (vgl. ebd.).
Zusammenfassend grenzen Raffee und Wiedmann (1987b, 222) Werte von
Einstellungen, Lebensstilen, Bediirfnissen, Motiven und Normen wie folgt
ab:
,,- Werte stellen fUr eine einzelne Person einen wiinschenswerten Zustand
dar.
- Werte besitzen eine zeitlich relativ stabile Struktur und sind situations
unabhiingig.
- Werte beeinflussen das menschliche Verhalten, allerdings in einer sehr
generellen Form."
Ein tatsachlicher "Wandel" kann sich dergestalt auBem, daB die Aufgabe,
Schwachung, Verzerrung oder Neuorientierung gegebener Werthaltungen
verstlirkt feststellbar ist (vgl. Etzioni, 1975, 270), in Abhiingigkeit yom
Grad der Bindung an betreffende Werte im Verstlindnis dynamischer Qua
litaten (vgl. ebd., 406). Somit macht der Charakter eines intensiveren,
schnelleren Wandels der Werte den eigentlichen Wandel aus.
Dieses Credo ist keine Modethese, sondem die Konsequenz daraus, daB
der Mensch "seine eigene, die Veriinderung der AuBenwelt bewirkende
Tatigkeit im ganzen weder intellektuell steuem noch emotional bewlilti
gen" kann, wenn er sich "mehr mit Bestatigungen und VerifIkationen von
bereits Bekanntem als mit Entdeckung des Unbekannten" beschliftigt, was
von Hacker bereits 1969 (193ff.) behauptet wird. Die in den 70er Iahren
bestehende wachstumspolitische Konzeption kann aus ihrer Wertimplika
tion "Wohlstand/Freiheit" nicht mehr zwingend motiviert werden. Dariiber
hinaus werden eben diese Wertvorstellungen geradezu in Frage gestellt
(vgl. Glastetter, 1974,274).
13