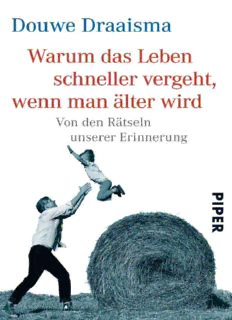Table Of ContentZu diesem Buch
Kaum ein Phänomen ist faszinierender als das menschliche Gedächtnis -
grandios, was wir uns merken können, staunenswert, an was wir uns alles
erinnern, erschütternd aber auch, was wir vergessen. Aber vergessen wir es
wirklich? Schließlich werden manchmal längst vergessene Ereignisse wieder
nach oben gespült, die irgendwo im Verborgenen gespeichert waren ...
Gedächtnis und Erinnerung sind rätselhafte Phänomene, und längst sind noch
nicht alle Geheimnisse um sie gelöst. Warum erinnert man sich so gut an
Demütigungen und Niederlagen? Warum haben manche Menschen das absolute
Gedächtnis? Warum ist die Grenze zwischen Erinnerung und Erfindung oft so
unklar? Und: wie sieht es mit so geheimnisvollen Phänomenen wie Dejä-vu-
Erlebnissen und dem berühmten Vorbeiziehen des Lebensfilms kurz vor dem
Tod aus? Der niederländische Psychologe Douwe Draaisma nimmt in seinem
glänzend geschriebenen Buch den staunenden Leser bei der Hand und führt ihn
kundig und anregend durch die dunklen Wälder der Erinnerung.
Douwe Draaisma, geboren 1953, ist Dozent für Psychologiegeschichte an der
Universität Groningen in den Niederlanden. Für »Warum das Leben schneller
vergeht, wenn man älter wird« erhielt er zahlreiche literarische und
wissenschaftliche Preise. Von ihm liegt auf deutsch außerdem vor: »Die
Metaphernmaschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses.«
Douwe Draaisma
Warum das Leben schneller
vergeht, wenn man älter wird
Von den Rätseln unserer Erinnerung
Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer
Piper München Zürich
Inhaltsverzeichnis
Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will
Blitzlichter im Dunkeln: erste Erinnerungen
Geruch und Erinnerung
Bedauern
Als ob es gestern war
Das innere Blitzlicht
Warum erinnern wir uns vorwärts und nicht rückwärts?
Die absoluten Gedächtnisse von Funes und Schereschewski
Der Profit eines Defekts: das Savantsyndrom
Das Gedächtnis des Großmeisters: Gespräch mit Ton Sijbrands
Trauma und Erinnerung: der Fall Demjanjuk
45 Jahre verheiratet: Richard und Anna Wagner
Wir fahren in ovalen Spiegeln herum: über Deja-vu-Erlebnisse
Reminiszenzen
Warum das Leben schneller vergeht, wenn man älter wird
Horror vacui: über das Vergessen
Ich sah mein Leben wie einem Film an mir vorüberziehen
Aus der Erinnerung - Portrait mit Stilleben
Die Arbeit an dieser Übersetzung wurde gefördert vom Nederlands Literair
Productie-en Vertalingenfonds.
Dieses Taschenbuch wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.
FSC (Forest Stewardship Council) ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige
Organisation, die sich für eine ökologische und sozialverantwortliche Nutzung
der Wälder unserer Erde einsetzt (vgl. Logo auf der Umschlagrückseite).
Ungekürzte Taschenbuchausgabe Piper Verlag GmbH, München Juli 2006
© 2001 Historische Uitgeverij, Groningen Titel der niederländischen
Originalausgabe: »Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt«
© der deutschsprachigen Ausgabe:
2004 Eichhorn AG, Frankfurt am Main Umschlag/Bildredaktion: Büro Hamburg
Heike Dehning, Charlotte Wippermann, Alke Bücking, Daniel Barthmann Foto
Umschlagvorderseite: Rodney Smith Foto Umschlagrückseite: Sake Elzinga
Satz: Fuldaer Verlagsanstalt, Fulda Papier: Munken Print von Arctic Paper
Munkedals AB, Schweden Druck und Bindung: Clausen & Bosse, Leck Printed
in Germany
ISBN-13: 978-3-492-24492-3
ISBN-10: 3-492-24492-0
www.piper.de
Die Erinnerung ist wie ein Hund, der
sich hinlegt, wo er will
Unser Gedächtnis hat einen eigenen Willen. Wir sagen uns: Das muß ich
behalten, diesen Moment will ich festhalten, jenen Blick, dieses Gefühl, jene
zärtliche Berührung - und nach einigen Monaten oder sogar schon nach ein paar
Tagen merken wir, daß die Erinnerung bereits nicht mehr in der Farbe, dem
Geruch, dem Geschmack aufzurufen ist, auf den wir gehofft hatten. »Die
Erinnerung«, schreibt Cees Nooteboom in Rituale, »ist wie ein Hund, der sich
hinlegt, wo er will.«
Das Gedächtnis macht sich auch nichts daraus, wenn wir ihm auftragen, etwas
nicht aufzubewahren: Hätte ich das bloß nie gesehen, erlebt, zu hören
bekommen, hätte ich es bloß vergessen, es hilft nichts, es bleibt weiterhin
gespeichert und kommt nachts, wenn wir wach liegen, ganz spontan und ohne
Aufforderung zu uns zurück. Auch dann ist das Gedächtnis ein Hund, es kommt
schwanzwedelnd herbei und apportiert, was wir mit der Absicht weggeworfen
haben, es loszuwerden.
Den Teil unseres Gedächtnisses, in dem wir unsere persönlichen Schicksale
speichern, bezeichnet man in der Psychologie seit etwa zwanzig Jahren als
autobiographisches Gedächtnis«. Es ist die Chronik unseres Lebens, ein langes
Register, das wir zu Rate ziehen, wenn uns jemand nach unserer ersten
Erinnerung fragt, wie das Haus aussah, in dem wir als Kind gewohnt haben, oder
welches Buch wir als letztes gelesen haben. Das autobiographische Gedächtnis
ist gleichzeitig Tagebuch und ein Buch der Vergessenheit. Es ist, als ließe man
seine Lebensaufzeichnungen von einem unfolgsamen Schriftführer anfertigen,
der seinen eigenen Interessen nachgeht, der minutiös festhält, was man lieber
vergessen würde, und der während glorreicher Momente so tut, als würde er
eifrig mitschreiben - dabei hat er schon längst heimlich die Kappe auf den Füller
geschraubt.
Das autobiographische Gedächtnis hat seine eigenen rätselhaften Gesetze.
Warum wird vor unserem dritten oder vierten Lebensjahr fast nichts notiert?
Weshalb werden Kränkungen immer mit wischfester Tinte aufgeschrieben?
Warum sind Demütigungen über Jahre hinweg mit der Präzision eines Protokolls
festgehalten? Warum schlägt es in düsteren Momenten, auch immer bei düsteren
Erlebnissen nach ? Bei Depressionen oder Schlaflosigkeit verändert sich das
autobiographische Gedächtnis in ein trauriges Register: jede schlimme
Erinnerung wird von einem deprimierenden Netzwerk aus Querverweisen zu
anderen schlimmen Erinnerungen geleitet. Ab und zu überrascht uns das eigene
Gedächtnis. Ein Geruch bringt einem auf einmal etwas in Erinnerung, woran
man seit dreißig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Eine Straße, in der man mit
sieben zum letzten Mal gewesen ist, wirkt bis zur Unkenntlichkeit geschrumpft.
Jugenderinnerungen können einem im Alter deutlicher vor Augen stehen als zu
der Zeit, als man vierzig war. Und das sind bloß die alltäglichen Erlebnisse mit
dem Gedächtnis. Man würde auch zu gern verstehen wollen, weshalb man noch
so genau weiß, wo man gerade war, als man hörte, daß Prinzessin Diana
verunglückt war, wie die Erfahrung eines Dejä-vu-Erlebnisses entsteht und wie
es möglich ist, daß das Leben scheinbar immer schneller vergeht, je älter man
wird.
Daß man in der Psychologie erst seit kurzem so etwas wie ein
>autobiographisches Gedächtnis* unterscheidet, ist seltsam. Denn die Fähigkeit,
persönliche Erfahrungen zu speichern und sich später wieder daran zu erinnern,
ist ja genau das, was im täglichen Sprachgebrauch immer schon die Bedeutung
von >Gedächtnis< gehabt hat. Und was sollte ein Gedächtnis anderes enthalten
als persönliche Erfahrungen«? Diese Frage beruht auf einem Mißverständnis. In
jedem psychologischen Handbuch werden Dutzende Arten von Gedächtnis
unterschieden. Manche verweisen auf die Dauer der Speicherung, wie etwa das
Kurzzeit-und das Langzeitgedächtnis, andere wiederum auf das Sinnesorgan, mit
dem sie verbunden sind, wie das auditive oder ikonische Gedächtnis, wieder
andere auf die Art von Information, die darin gespeichert wird, wie das
semantische, motorische oder visuelle Gedächtnis. All diese Arten von
Gedächtnis haben ihre eigenen Gesetze und Eigenschaften: an die Bedeutung
eines Worts erinnert man sich auf eine andere Weise als an die Bewegungen der
Füße beim Autofahren, an den Satz des Pythagoras wieder anders als an den
ersten Schultag. Daß inmitten all dieser unterschiedlichen Arten von Gedächtnis
erst zu Beginn der achtziger Jahre ein gesonderter Fachbegriff für die
Speicherung von Erinnerungen an persönliche Erlebnisse eingeführt wurde, ist
bei näherer Betrachtung also gar nicht so seltsam. Die Frage ist vielmehr,
weshalb die Erforschung des autobiographischen Gedächtnisses erst dann in
Gang kam. Warum so spät?
In London und Berlin Es hätte schon zwei Jahrhunderte zuvor soweit sein
können. Die ersten Experimente mit dem, was heute autobiographisches
Gedächtnis heißt, fanden um 1879 statt. Sie wurden von dem englischen
>gentleman scientist< Sir Francis Galton (1822-1911) durchgeführt, der sich für
den Verlauf seiner eigenen Assoziationen interessierte. Während eines
Spaziergangs am Pall Mall entlang konzentrierte er sich auf Gegenstände, die
ihm unterwegs begeg-neten, und notierte in Gedanken immer wieder die
Assoziationen, die sie bei ihm hervorriefen. Erstaunt hatte er festgestellt, wie
unterschiedlich seine Assoziationen waren und daß sie ihm oft Dinge in
Erinnerung brachten, an die er schon sehr lange nicht mehr gedacht hatte. Die
Beobachtung seiner eigenen geistigen Prozesse erwies sich übrigens als
mühselig: er mußte auf seine Gedanken und Assoziationen achten, ohne ihren
freien Lauf zu behindern. Galton hatte dieses Problem gelöst, indem er seinem
Geist immer wieder erst drei, vier Sekunden Zeit ließ, in aller Ruhe abzuwarten,
welche Assoziationen in ihm aufstiegen, und danach die volle Kraft seiner Konzentration darauf zu richten,
welche Echos dann noch in seinem Geist vorhanden waren. Das Vorgehen erinnerte ein bißchen an eine
plötzliche Verhaftung samt Leibesvisitation. Nach seinem Spaziergang beschloß Galton, den Versuch
systematischer zu wiederholen. Er legte ein Verzeichnis aus ihm geeignet erscheinenden 75 Wörtern an wie
Fahrzeug, Abtei und Mittag, schrieb diese auf ein Blatt Papier und schob es so unter ein Buch, daß er das
nächste Wort nur sehen konnte, wenn er sich vorbeugte. Das Experiment verlief nach einem festen
Rhythmus. Galton beugte sich vor, drückte eine Stoppuhr, sobald er das Wort sehen konnte, wartete, bis
sich ein oder zwei Assoziationen gebildet hatten, las ab, wie viele Sekunden das gedauert hatte, und notierte
die Assoziationen. Danach stellte er seinen Geist wieder auf scharf (»on hair trigger«) und las das nächste
Wort.
Galton empfand die Experimente als eine Prüfung. Sie waren ermüdend und
langweilig, sie verlangten seinem Durchhaltevermögen viel ab. Er hatte
dieselben 75 Wörter viermal abgearbeitet, mit Zwischenpausen von etwa einem
Monat und unter sehr unterschiedlichen Umständen. Insgesamt hatte er 505
Assoziationen in 660 Sekunden gebildet. Das ergab ein Tempo von etwa fünfzig
pro Minute, »miserabel langsam«, fand er, verglichen mit der natürlichen
Schnelligkeit des Assoziierens, wenn man einfach nur so ein bißchen vor sich
hinsinniert. Die Anzahl unterschiedlicher Assoziationen lag deutlich darunter,
nämlich nur bei 289. Das überraschte Galton und minderte auch schnell seine
anfängliche Bewunderung für die Abwechslung, die er bei seinem ersten
Versuch festgestellt hatte. Bei näherer Betrachtung, erläuterte er, ähneln
Assoziationen Schauspielern, denen es gelingt, einen endlosen Aufzug zu
suggerieren, indem sie hinter die Bühne zurücklaufen, um dann erneut auf ihr zu
erscheinen. »Auf den Wegen unseres Geists befinden sich tiefe Karrenspuren«,
das stand jetzt jedenfalls fest.
Eine weitere Erkenntnis war, daß viele der Assoziationen in seine Jugend
zurückreichten, nämlich 39 Prozent. Unterschiedliche Wörter hatten ihm wieder
in Erinnerung gebracht, wie er als Junge ein paar Tage lang im Labor eines
befreundeten Chemikers herumstöbern durfte. Die Ereignisse lösten viel weniger
Assoziationen jüngeren Datums aus, 15 Prozent. Außerdem waren vor allem die
>alten< Assoziationen für die vielen Wiederholungen verantwortlich: ein Viertel
der Assoziationen aus den Jugendjahren erschien viermal auf der Bühne und war
demnach dreimal zurückgelaufen. Erziehung und Ausbildung hatten die
Assoziationen des Erwachsenen fest im Griff. Obwohl Galton viel von der Welt
gesehen und sich einen Namen als Entdeckungsreisender gemacht hatte, fiel ihm
auf, wie ausgesprochen britisch seine Assoziationen geblieben waren, stärker
noch: wenn er die Liste durchging, sah er, daß sie auch die Gesellschaftsschicht
kennzeichneten, in der er geboren und aufgewachsen war.
Am Ende seiner Experimente war Galton ein zufriedener Mann. Er hatte
nachgewiesen, daß man flüchtige Assoziationen zur statistischen Bearbeitung
festlegen kann, daß man sie datieren, sortieren, determinieren kann. Es war ihm
gelungen, das Halbdunkel seines Bewußtseins zu durchdringen. Was er dort
vorgefunden hatte, eignete sich nicht immer zur Veröffentlichung. All jene
Assoziationen, schrieb er, »legen die Fundamente der Gedanken einer Person
mit so wunderbarer Deutlichkeit bloß, sie enthüllen so lebendig und
wahrheitsgetreu die geistige Anatomie eines Menschen, daß er sie
wahrscheinlich lieber für sich behält.« Seine Experimente hinterließen bei ihm
den Eindruck eines Kellerbodens, den man für Reparaturen an den
Sanitäranlagen aufgerissen hatte: erst dann liegen die Rohre, Kabel und
Leitungen frei, die während der ganzen Zeit dem Komfort der Bewohner
unsichtbar gedient haben.
Francis Galton hätte mit dieser Studie Begründer einer blühenden Psychologie
des autobiographischen Gedächtnisses werden können. Er zeigte als erster den
>Reminiszenzeffekt< auf, das Phänomen, daß die Assoziationen von Menschen
um die sechzig -Galton war 57 - relativ oft in die Jugend zurückgehen. Er war
auch der erste, der eine Technik entworfen hatte, um sich zu Abteilen unseres
Gedächtnisses Zugang zu verschaffen, die man niemals zuvor einer
systematischen Erforschung unterworfen hatte. Dennoch wurden seine
Experimente nicht nennenswert fortgeführt. Zur selben Zeit, um 1879, war
nämlich noch jemand anders mit Gedächtnisexperimenten zugange, auch mit
Wörterlisten und einer Uhr, ein Deutscher.
Hermann Ebbinghaus (1850-1909) hatte in Philosophie promoviert. Nach einem
Aufenthalt als Hauslehrer in England und Frankreich wurde er 1878 nach Berlin
eingeladen, um dort am Preußischen Hof Prinz Waldemar zu unterrichten. Der
Unterricht fand ein abruptes Ende, als Waldemar 1879 an Diphtherie starb.
Ebbinghaus beschloß, den Versuch zu wagen, als Privatdozent in der
Philosophie zugelassen zu werden. Die Habilitationsschrift, die hierfür verlangt
wurde, widmete er einer Reihe von Experimenten, mit der er schon am Hof
angefangen hatte. Wie Galton -aber unabhängig von ihm - studierte er die
Funktion seines eigenen Gedächtnisses.
Ebbinghaus hatte seine eigenen Stimuli entworfen. Er fügte jeweils einen Vokal
zwischen zwei Konsonanten und erhielt so einen Vorrat von 2.300 Silben wie
>nol<, >bif< und >par<. Diese Silben - von Ebbinghaus >sinnlose Silben«
genannt, obwohl manche Silben tatsächlich als Worte existierten - schrieb er auf
Kärtchen. Ein durchschnittlicher Versuch verlief folgendermaßen: Zu einem
festen Zeitpunkt am Tag legte Ebbinghaus seine Uhr auf den Tisch und nahm
sich den Kartenstapel. Daraus zog er dann nach dem Zufallsprinzip eine
bestimmte Anzahl und übertrug die Silben in ein Heft. In der Hand hielt er eine
Schnur mit Holzknöpfen. Jeder zehnte von ihnen war schwarz. Anschließend las
er sich die Silbenreihe in hohem Tempo - zwei, drei Silben pro Sekunde - selbst
vor. Das tat er so lange, bis er die Reihe auswendig konnte. Danach schaute er
sich seine Holzknopfschnur an und notierte, wie oft er die Reihe hatte lesen
müssen. Zu einem späteren Zeitpunkt - und der konnte zwischen zwanzig
Minuten bis zu sechs Tagen oder sogar einem ganzen Monat schwanken -
wiederholte er den Versuch mit derselben Reihe. Indem er die Anzahl der
Wiederholungen für das Wiederlernen von denen für das Lernen abzog, erhielt
Ebbinghaus ein Maß für das, was er >Arbeitsersparnis< nannte: für das erneute
Lernen braucht man weniger Wiederholungen als für das Lernen, aber wieviel
weniger, hängt von der Zeit ab, die zwischen dem Lernen und dem Wiederholen
des Gelernten liegt.
Mit dieser Methode fand Ebbinghaus über einen Umweg eine Möglichkeit zur
Quantifizierung des Gedächtnisses. Man kann nicht direkt messen, was man
vergessen hat, aber man kann sehr wohl messen, wie viele Wiederholungen
notwendig sind, um das, was man vergessen hat, erneut zu lernen. So konnte er
die Erkenntnis, daß man um so mehr vergißt, je mehr Zeit seit dem Erlernen
verstrichen ist, zu einer Kurve präzisieren, die in den ersten zwanzig Minuten
schnell abfällt, nach einer Stunde etwas weniger steil verläuft und nach einem
Tag in eine allmähliche, fast flache Abnahme übergeht - die >Vergessenskurve
von Ebbinghaus«. Eine weitere Feststellung war, daß die Anzahl der