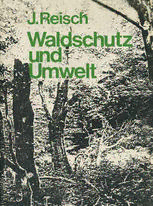Table Of ContentJoachim Reisch
Waldschutz
und
Umwelt
Mit 344 Abbildungen in 494 Einzeldarstellungen
und 11 Figuren
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York 1974
Dr. Dipl.-Fw. JOACHIM REISCH
Oberforstmeister
6465 Bieber, R6merberg 3
ISBN-13: 978-3-642-65805-1 e-ISBN-13: 978-3-642-65804-4
DOl: 10.1007/978-3-642-65804-4
Das Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte,
insbesondere die der Obersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen,
der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ahnlichem Wege
und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser
Verwertung, vorbehalten.
Bei Vervielfaltigungen fUr gewerbliche Zwecke ist gemaB § 54 UrhG eine
Vergiitung an den Verlag zu zahlen, deren H6he mit dem Verlag zu vereinbaren ist.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw.
in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, daB solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz
Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher vonjedermann benutzt werden
diirften.
© by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1974.
Library of Congress Catalog Card Number 73-21278.
Schrift: Monophoto-Times
Papier: OBOT* Scheufelen, Oberlenningen
Umschlagentwurf: W. Eisenschink, Heidelberg
Gestaltung und Layout: 1. Oppelt, Heidelberg
Geleitwort
Die Forderungen zur Erhaltung der Waldhygiene und zur Steigerung des Wirtschafts
erfolges sind nicht immer vereinbar und stellen den Forstmann vor schwierige Aufgaben.
Treten in einem Revier Massenvermehrungen von Schadlingen auf, so stellt sich die
heikle Frage der chemischen Bekampfung, die in gewissen Fallen tiberhaupt die einzig
gangbare Losung darstellt, urn den Bestand noch zu retten.
Vor solchen Situationen stehen z.B. die verantwortlichen kanadischen Forststellen
jedes Jahr, weil besonders der Schwammspinner Lymantria dis par in Bestanden Kahl
fraB und Vernichtung bringt, aber andererseits der Einsatz von Pestiziden mittels
Flugzeugen die Entrtistung der Offentlichen Meinung auslOst.
Obwohl Mischwalder gegentiber Schadlingsgradationen besser abgesichert erscheinen,
konnen auch in diesen Kalamitaten ausbrechen, die rasche GegenmaBnahmen fordern.
Solche Bekampfungsaktionen mtissen in bezug auf ihre Einwirkung auf die Biozonose
sorgfaltig tiberprtift werden, da ein brutaler Eingriff aus verstandlichen Grtinden
wegen seinen nachhaltigen Folgen schlimmer sein kann als das Ausbleiben jeglicher
Behandlung.
1m vorliegenden Buch widmet Oberforstmeister Dr. Reisch in verdienstvoller Weise
diesen schwierigen Vorgangen besondere Aufmerksamkeit. Seine rund zwanzigjahrige
Erfahrung als Forstpathologe, wah rend welcher er zunachst als Pilot groBraumige
Bekampfungsaktionen flog, urn alsdann eingehendst deren biozonotische Folgen zu
untersuchen, und die sich darauf sttitzenden okologischen Studien, bilden daflir eine
solide Grundlage. Die Bedeutung der Ntitzlinge und die Verfahren zu ihrer Erhaltung,
Vermehrung und Schonung stehen im Vordergrund, wobei auch die Schattenseiten
gewisser Pestizide objektiv dargelegt werden.
Sehr wertvoll flir den Forstmann und Praktiker sind nicht nur die in Tabellenform
schematisch prasentierten Beschreibungen der Arten, die sowohl Unkduter, Pilze,
Mikroorganismen, Insekten, Vogel und Kleinsauger umfassen, sondern auch die
Angaben tiber Lebensweise, Nutzen oder Schaden.
Die heikle Frage des wirtschaftlich vertretbaren Einsatzes mit bestimmten Pestiziden
wird eingehend untersucht; sie findet ihren Niederschlag in zahlreichen Angaben
tiber kritische Schwellenwerte. Solche Informationen sind neu und auBerst wertvoll;
sie stellen entscheidende Elemente flir einen rationellen Waldschutz dar.
Dieses Buch, in dem die Problemstellung Waldschutz und Umwelt in groBztigiger
Weise betrachtet wird, ist sowohl yom Biologen und Okologen als auch yom Wirt
schafter dankbarst zu begrtiBen. Die Ftille der Daten und das einfache und klare
Konzept bilden flir den Praktiker ein wertvolles Nachschlagewerk.
Paris, Februar 1973 Dr. G. MATHYS
Generaldirektor der
EPPO (European and
Mediterranean Plant
Protection Organization)
v
Vorwort
Die Idee zu diesem Buch geht auf einen vielfach geauBerten Wunsch der Praktiker und meiner
zahlreichen Schtiler zurtick, Wissen tiber den Pflanzenschutz im Walde verstandlich und kurz
gefaBt zu vermitteln. So entstand in jahrelanger Arbeit ein Kompendium aus der Praxis for die
Praxis.
Es ist aber bestimmt auch kein Zufall, daB ich zur Feder gegriffen habe in einer Zeit, die von
wachsenden Umweltproblemen bestimmt wird.
Ich habe die Sorgen und Note des Waldbesitzers zur Gentige und aus der Nahe kennengelernt,
aber auch den unerbittlichen Ehrgeiz und den fanatischen Einsatz von Schadlingsbekampfern.
Die Leiden der Natur unter den Giftwolken sind mir nicht verborgen geblieben.
Zu Beginn meiner Tatigkeit fUr den Pflanzen schutz im Jahre 1954 stand die groBe Maikafer
schlacht yom Bodensee bis tief in die Schwabische Alb. Zentimeterdick bedeckten die Kafer
leiber den Erdboden, wortiber knirschend die Bauernwagen rollten. Auch ich selbst fUhrte
einmal den Steuerkntippel am Flugzeug, das die todbringenden Giftsalven niederlieB.
Doch eines Tages im Jahre 1957 stand ich im Schwarzwald erschtittert vor den schrecklichen
Spuren des Giftes, welches einen argen Fichtenschadling vernichten sollte. Keine Vogelstimme
erklang mehr, am Boden krtimmten sich Larven, Kafer, Falter, Wtirmer und anderes Getier,
noch Wochen danach herrschte dort Totenstille, die Natur schien erloschen.
Dieser Anblick hat mich bis heute verfolgt. Sicherlich wurde ich auch dadurch immer wieder
angetrieben, in meiner Arbeit nicht nachzulassen, die Gefahren einer rticksichtslosen Chemo
therapie ungeschminkt aufzuzeigen und festzuhalten, sowie vor a11em aber nach neuen Wegen
zu suchen. Einen Ausweg sah ich bald in der Umstellung auf biologische Methoden.
Schon im Jahre 1959 ergab sich eine gtinstige Gelegenheit, den ersten groBeren Freilandversuch
mit spezifisch wirkenden Bakterien gegen den Eichenwickler zu starten. Der Erfolg dieser
MaBnahme ermutigte zu weiteren Versuchen. So gelang im Jahr 1966 erstmalig in Mitteleuropa
der Bakterieneinsatz anste11e von DDT im Dauerschadgebiet des Eichenwicklers (und seiner
Schadgese11schaft) im Main-Kinzig-Becken.
GroBartige Beispiele biologischer Einsatze mit Krankheitserregern, Parasiten und Raubern sind
aus vielen Landern der Erde bekannt.
A11e Bemtihungen werden aber im Walde Sttickwerk bleiben, solange nur wirtschaftliche
Gesichtspunkte dominieren. Aber wir konnen durch den Einbau moglichst vieler biologischer
Helfer, wozu zunachst vor a11em die Roten Waldameisen und die Vogel gehOren, auch den
Umweltwiderstand starken und das biologische Gleichgewicht regeln helfen. Darin muB gegen
wartig un sere Hauptaufgabe gesehen werden.
Bei der Niederschrift des Manuskriptes wurde mit klar, daB der Rahmen nicht zu weit gesteckt
werden durfte. Einfltissen aus der unbelebten Welt (abiotische Faktoren), wie Brand, Immis
sionen, Witterung und Klima, Wasser und Boden, steht der Praktiker meist machtlos gegentiber.
Die hierdurch verursachten Pflanzenkrankheiten sind in erster Linie waldbaulich, d. h. durch
eine entsprechende raumliche Ordnung, Aufarbeitung und Lagerung des Holzes u.a.m., zu
verhindern.
Meine Darste11ungen habe ich daher ausschlieBlich auf biotische Faktoren begrenzt. Neben den
allgemeinen Grundregeln eines geordneten Pflanzenschutzes habe ich in besonderem MaBe den
hiermit verbundenen Organismen Raum gewidmet. "Sehen und Erkennen" war das oberste
Gebot meiner Konzeption. Entsprechendes Bildmaterial untersttitzt daher die Darstellung im
Text. Die Aufzahlung vieler Arten, besonders bei den Insekten, so11 vor a11em dem Praktiker
VII
Vorwort
einen Hinweis auf die Fiille der noch vorhandenen Lebewesen geben und ihn vor einer
Begiftung stets daran erinnern.
Ziel des Buches ist es, das Augenmerk auf die vielen biologischen Helfer, die vorbeugende
Abwehr von Schaden, die Waldhygiene und die biologische und mechanische Bekampfung von
Pflanzenfeinden zu lenken.
Die Namen der Lehewesen sind in iiblicher Weise durch die "binare Nomenklatur" gekenn
zeichnet. Seit der Begriindung dieses Ordnungssystems durch den schwedischen Naturforscher
CARL v. LINNE (1707-1778) haben sich, sehr zum Leidwesen der Biologen, standig Anderungen
ergeben. Urn Irrtiimer oder Verwechslungen zu vermeiden, wurde daher der neuen Bezeichnung
die alte beigefUgt. Einem dringenden Wunsch meiner Schiiler folgend, habe ich den deutschen
Namen, soweit bekannt, vorangestellt.
Die Stoffgruppierung ist vollstandig neu und ganz auf den praktischen Gebrauch abgestimmt.
Die Lebewesen in der Waldlebensgemeinschaft sind von den niederen zu den hOheren gruppiert
und innerhalb dieser Gruppen nach ihrer Bedeutung in der Waldlebensgemeinschaft und nicht
nach ihrer Stellung im System geordnet bzw. zusammengefaJ3t. Okologische Gesichtspunkte
erhielten also den Vorrang.
Die Tahellenform erschien deshalb besonders zweckmaJ3ig, urn die Ubersichtlichkeit zu wahren
und ein rasches Auffinden zu ermoglichen. Bei Kleinlebewesen, Pilzen und Insekten wurde der
betroffene Wirt bzw. das befallene oder geschadigte Pflanzen organ (stets Laubholz vor Nadel
holz in gleicher Reihenfolge) links herausgestellt. Danach folgen die betreffenden Symptome
und schliel3lich die Charakterisierung des Taters bzw. die Schadenursache. Die Angaben iiber
MaJ3e und geographische Verbreitung sollen, namentlich den Anfanger, vor Fehldiagnosen
bewahren.
Die Bionomie ist bei Schmetterlingen und Hautfliiglern einfach durch Zahlen (Rhumhlersche
Formel) ausgedriickt. Die Einstufung der Organismen in niitzlich, schiidlich, indifferent ist
natiirlich rein menschlich bedingt und daher an bestimmte Erwartungen gekniipft. Un sere
Kenntnisse sind darin leider sehr liickenhaft, so daJ3 sich hier noch ein weites Feld fUr
F orschungsarbeiten eroffnet.
Forderungs-und GegenmaJ3nahmen sind fUr die jeweilige Organismengruppe zusammengestellt,
wobei mechanischen und/oder biologischen Methoden in jedem Fall der Vorzug gegeben
ist.
Eine Reihe von Fachkollegen des In- und Auslandes habe ich fUr spezielle Fragen konsultiert.
Mein Dank gebiihrt daher an dieser Stelle den Herren:
Dr. Baule, Lutterberg (Diingung); Dr. Behlen, Ranstadt (integrierte Schadlingsbekampfung
durch Synergid); Hofrat Dipl.-Ing. Prof. Dr. Beran, Wien (Bienenschaden durch Pestizide);
Dr. Bleichert, Hannover (Diingung und Anlage von Wild wiesen) ; Prof. Dr. Eichhorn, Delemont
(Adelgiden und Generationszyklus); Prof. Dr. GoJ3wald, Wiirzburg (Rote Waldameisen);
Griinwald, Nieder-Gemiinden (ornithologische Fragen); Hinz, Einbeck (Ichneumoniden), Dr.
Keil, Frankfurt-Fechenheim (ornithologische Fragen); Dr. Kneitz, Wiirzburg (Rote Wald
ameisen); Stud.-Dir. Leyer, Gelnhausen (Diingung, Futtermittel, Anlage von Wildwiesen und
Wildackern); Martouret, La Miniere par Versailles (mikrobiologische Verfahren); Dr. Maas,
Braunschweig (Fischtoxizitiit von Herbiziden); Dr. Peters, Frankfurt/Main (Aculeaten); Dr.
Przygodda, Essen-Bredeney (Vergiftungen von Vogeln durch Pestizide); Dr. RoJ3bach, Frank
furt-Fechenheim (ornithologische Fragen); Landforstmeister Dr. Schindler, Gottingen (lang
jahriger Erfahrungsaustausch im Forstschutz); Dr. Schroder, Frankfurt/Main (Schmetterlinge);
Oberamtsrat Schroder, Schotten (Forstliche Arbeitslehre und Forstmaschinenkunde); Stud.
Dir. Sich, Wuppertal-Barmen (Chemie); Prof. Dr. Schwenke, Miinchen (biologische Schad
lingsbekampfung durch Parasiten und Geschichte des F orstschutzes); Dr. Stute, Celle (Bienen
schiiden); Dr. Tobias, Frankfurt/Main (Zweifliigler); Wiistenberg, Radolfzell (Schlafer und
ornithologische Fragen); Prof. Dr. Ziirn, Steinach bei Straubing (Griinlanddiingung); Dr.
Zwolfer, Delemont (biologische Schadlingsbekampfung).
VIII
Vorwort
Das hervorragende Bildmaterial verdanke ich einer Reihe namhafter Tierfotografen, von denen
ich hier stellvertretend die Herren W. Rohdich, Miinster (Westfalen) und H. Pfletschinger,
Ebersbach (Fils) nenne, nicht zuletzt aber auch Herrn G. H. Weiss, Gevelsberg i. W. durch seine
Mithilfe in der Zeitschrift "F otos gesucht".
Besonderer Wert wurde auf die Darstellung lebender Organismen gelegt, was viel Geduld
und Miihe kostete.
Ganz besonderen Dank schulde ich meinem Schwiegervater, Herrn Realschuloberlehrer i. R.
Fr.-W. Kiichel, fUr die Durchsicht des Manuskriptes und meiner lie ben Frau, die aIle
Strapazen mit soviel Rat und Tat tapfer durchgestanden hat.
SchlieBlich verdanke ich dem Verleger Herrn Dr. Konrad F. Springer und seinen Mit
arbeitern ein sehr groJ3es Verstandnis und Entgegenkommen fUr meine Arbeit. Die vorlie
gende vorbildliche Ausstattung und iibersichtliche Gestaltung ist der Ausdruck fUr eine
harmonische Zusammenarbeit, wie sie sehr selten zu finden ist. In diesem Team hat Frau Inge
Oppelt hervorragenden Anteil, durch deren personlichen Eifer auch die letzten Schwierigkeiten
gl~nzend gemeistert wurden.
Bieber, im Oktober 1973 JOACHIM REISCH
IX
Inhalt
Erster Teil. Wald - Umwelt - Lebensgemeinschaft - Biologisches Gleichgewicht
I. Einfiihrung und grundsatzliche Betrachtungen . . . . . . . . . . . 1
1. Veriinderungen des Waldes als Ursache der Schiidlingsvermehrung 1
2. Ubersicht tiber GroBkalamitiiten. . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Hervorragende Forscher auf dem Gebiet des Forstschutzes und deren Standard-
werke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
4. Beurteilung von GegenmaBnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Veriinderungen in der Landschaft und deren Auswirkungen auf die Tier- und
Pflanzenwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II. Grundhegriffe der Bevolkerungs-und Krankheitslehre 15
1. BevOlkerungsdichte - Bevolkerungsbewegung . . . . . . . . . 15
2. Wirkungsweise von Pflanzenschiidlingen und ihren Gegenspielern . 17
III. Waldschutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Zweck und Ziel im Wandel der Zeiten . . . . . . . . . . . . 23
2. Diagnose - Erkennung und Bezeichnung der Krankheit bzw. des Erregers 24
3. Prognose - Voraussage des Krankheitsverlaufs und -ausgangs 25
3.1 Kritische Zahlen (Schadensschwellen). 25
3.2 Prognose-Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Probesuchen nach Kieferninsekten . . . . . . . . . . . . 28
Posthorn- oder Kiefernknospentriebwickler (Rhyacionia buoliana) 33
Grtiner Eichenwickler (Tortrix viridana) . . . 33
Nonne (Lyman tria monacha) . . . . . . . . 33
Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora abietina) 34
GroBer Brauner Rtisselkiifer (Hylobius abietis) . 34
Probegrabung nach Engerlingen der Maikiifer (Melolontha spec.) . 35
4. Der Kampf gegen Schiidlinge 35
4.1 Geschichtlicher Uberblick . 35
4.2 Waldhygiene . . . . 36
4.3 Waldtherapie . . . . 38
Mechanische Methode 38
Chemische Methode . 41
Biologische Methode . 51
Erfolgskontrolle. . . 56
Zweiter Teil. Die Lebewesen in der Waldlebensgemeinschaft
I. Mikroorganismen als Krankheitserreger hei Mensch, Tier und/oder Pflanze. 63
1. Viren . . . . . . . . . . .. 63
1.1 Insektenpathogene Viren. . . . 63
1.2 Viren zur Schadlingsbekiimpfung 66
XI
Inhalt
2. Rickettsien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3. Bakterien (Spaltpilze) . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.1 Insektenpathogene Bakterien (Erreger von Bakteriosen). 67
3.2 Bakterien zur Schiidlingsbekiimpfung 68
3.3 Pflanzenpathogene Bakterien . . . . . . . . . . . . 69
4. Mikrosporidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1 Insektenpathogene Mikrosporidien (Erreger von Mikrosporidiosen) 70
4.2 Mikrosporidien zur Schiidlingsbekiimpfung. . . . . . . . . . . 72
II. Pilzkrankheiten an Insekten und Waldhiiumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Allgemeines tiber Pilze (F ortpflanzung, Verbreitung und Infektion, Entwicklung). 73
2. Symbionten . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Insektenpathogene Pilze (Erreger von Mykosen) . 75
Mykosen zur Schiidlingsbekiimpfung. . . . . . 77
4. Pflanzen pathogene Pilze . . . . . . . . . . . 78
4.1 Pilzkrankheiten an Keimlingen und Jungpflanzen 78
4.2 Pilzkrankheiten an Wurzeln . . . . . . . . . 82
4.3 Pilzkrankheiten an Knospen, Bliittern, Nadeln, Trieben. 83
4.4 Pilzkrankheiten an Rinde, Ast, Stamm . 90
4.5 GefaBkrankheiten. . . . 96
4.6 Holzfaulen und Farbfehler . . . . . . 97
III. Unerwiinschter Pflanzenwuchs 109
1. Allgemeines . . . . . . 109
2. GegenmaBnahmen . . . 110
2.1 Vorbeugend (waldbaulich) 110
2.2 Mechanisch 110
2.3 Chemisch . . . . . . . 114
2.4 Biologisch . . . . . . . 117
3. Ubersicht tiber die betreffenden Pflanzen. 120
IV. Waldinsekten als Pflanzenfeinde und Regier des hiologischen Gleichgewichts 130
1. Allgemeine Kennzeichen der Insekten (Hexapoda, Insecta, Entoma) . 130
AuBere Gestalt (Mo rphologie) . 130
Innerer Bau ( Anatomie) . 134
F ortpflanzung. . 134
Entwicklung. . . 134
Erniihrungsweise . 13 5
Bionomieformel . 135
2. Ausgewiihlte Insekten der Waldlebensgemeinschaft und angrenzender Biotope 136
Streuzersetzer
2.1 Springschwiinze (Collembola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Insektenrauber
2.2 Libellen, Wasserjungfern (Odonata) 136
2.3 Netzflugler (Neuropteroidea) 138
Kamelhalsfliegen (Raphidides) 139
XII