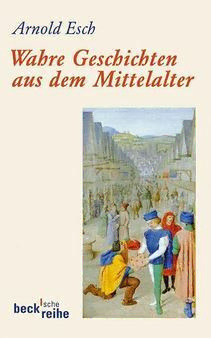Table Of ContentARNOLD ESCH
W A H RE G E S C H I C H T EN
AUS DEM M I T T E L A L T ER
Kleine Schicksale selbst erzählt
in Schreiben an den Papst
VERLAG C . H . B E CK
für Doris
Mit 2 5 Abbildungen
©Verlag C. H. Beek oHG, München 2010
Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten
Druck und Bindung: CPI Ebner & Spiegel, Ulm
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)
Printed in Germany
ISBN 978 3 406 6013 3 O
www.beck.de
INHALTSVHRZKICHNIS
EINFÜHRUNG 7
DIE QUELLE UND IHR AUSSAGEWERT 18
Schuld als Uberlieferungs-Chance 19. Argumentations-Tendenz der
Schilderungen 20
LEBENSALTER UND LEBENSLAGEN
IN EINZELSCHICKSALEN 26
Kindheit 2f>; Erste Lebensentscheidungen 30; Liebe, Ehe, Enttäu
schung j 3. Enthaltsamkeit 42. Gemütslagen. Depressionen, Kom-
plexe, Zusammenbrüche 44. Körperliche Mängel 46. Alter 48
GESELLSCHAFT 51
Die Lebenswelt der Stadt 51. Stadt und Universität; studenti-
sches Leben j2; Auslandsstudium 57. Berufliches Leben 59. Der
Arzt 62. Zwischen Anatomie und Magic 6Städtische Obrigkeit.
Verantwortung und Strafgewalt 68. Todesurteile und Hinrichtungen
72. Gemeinschaftserlebnisse, Gemeinschaftserfahrungen 74: Stadt-
brand; verunglücktes Krippenspiel; Schule; Singen und Musizieren.
Bauen 81. Ernährung 84
GEISTLICHE 86
In der Welt der Herrschaft: schuldig durch Schreiben 87. In der
Welt der Kirchc: schuldig durch Pfründenhandel 92. Aus Priester-
haushalten 96. Papstlinanz aus persönlicher Perspektive 97
IM KLOSTER 99
Eintritt: genötigt, überredet, überzeugt 99. Konfliktsituationen und
Verlassen des Klosters 10 j. Szenen klösterlichen Lebens 107. Klo-
sterreform als Eingriff 109
KRIEG 112
Aus dem Kloster in den Krieg 112. Aus großen Kriegen und kleinen
Fehden 114. Seeräuber und Seeschlachten 118. Handfeuerwaffen:
I lautieren mit einer neuen Erfindung 120
IM WIRTSHAUS 128
Der Wortschatz der Trunkenheit 130. Wortwechsel, Streitanlässe,
Zimmerschlachten 1 31 .Tatwaffen 134. Glücksspiel 136. Wettkampf-
spiele 139
AUF DEM LANDE 143
Dörfliches Leben 14Auf dem Felde 147. Unfälle an Dorfteichen
und Flüssen 149. Auf der Landstraße i$2
IN DER FREMDE 156
Auf dem Weg nach Rom i£f>. In Rom 159. Am päpstlichen Hof if>2.
Nach Santiago di Compostela und Jerusalem 164. Fernhandel 166:
Islam-Embargo; Sprachprobleme. Die Mißgeschicke eines Kölner
Kaufmanns auf Zypern 168
HISTORISCHE EREIGNISSE GESPIEGELT
IN KLEINEN SCHICKSALEN 174
Die Kriege Karls des Kühnen 174. Lokale Kriege und Fehden, fremde
Solddienste 178. Hussiten 183. Zeitalter und Menschenalter.
ANHANG 189
Anmerkungen 191
Bildnachweis 222
EINFÜHRUNG
Er habe beim Brand der Stadt, als der Feuersturm durch die
Straßen fegte, einen alten Mann, der ihm aus den Flammen ent-
gegenkam, in seinen Keller aufgenommen, dann aber selbst das
Haus durch den Hintereingang verlassen und, den Fluß durch-
querend, das Weite gesucht. So erzählt, das Gewissen belastet
vom Erstickungstod jenes Alten, ein Priester eine traumatische
Begebenheit seines Lebens.1 Und so berichten hier viele andere,
die eigentlich nicht die geringste Chance hätten, in eine histori-
sche Quelle hineinzufinden.2 Hier aber kommen sie nicht nur
vor, sie kommen sogar zu Wort — erzählen Episoden aus ihrem
Leben, ja ganze Lebensgeschichten: wahre Kurzgeschichten aus
dem späten Mittelalter.
Kleine Schicksale selbst erzählt. Was aber läßt Alltags-Szenen,
die nicht einmal wir selbst für überlieferungswürdig halten
würden (oder allenfalls in literarischer Gestaltung, bei Boccac-
cio, bei Chaucer) in historische Uberlieferung hineinfinden und
nacherzählbar werden? Was läßt unscheinbare Menschen, deren
kleine persönliche Schicksale zu großer Perspektive gar nicht
taugen (oder nur zur allergrößten: der Frage, wie der Mensch
durch die Nöte seines Lebens findet), und von denen in ihrer
Heimat womöglich keine Spur geblieben ist, in römische Über-
lieferung hineingeraten?
7
Um in römische Überlieferung zu kommen — wo man weit
besser aufgehoben ist als in mittelalterlicher deutscher Über
lieferung—, muß man ein Problem mit Rom haben. Das war
damals nicht schwer, denn die Kirche durchdrang in ganz an-
derer Weise das Leben, das der Geistlichen wie das der Laien.
Man mußte, zweitens, die Möglichkeit haben, sich in Rom ver-
nehmlich zu machen, sein Problem dort zur Sprache zu bringen.
Dafür sorgte die Kirche mit ihren zentralen Behörden. Und es
mußte, damit wir Historiker noch heute davon wissen, endlich,
drittens, gewährleistet sein, daß das darüber aufgesetzte Doku-
ment die Jahrhunderte überdauere, nicht verloren ging oder als
schließlich unnütz ausgeschieden wurde. Es mußte also einiges
zusammenkommen. Und hier kam es zusammen. In Rom zu su-
chen lohnt immer, auch auf dieser Ebene.
Daß der Historiker auch auf gewöhnliche Menschen hören
müsse, wird als Grundsatz gern propagiert. Aber das ist leichter
gesagt als getan (und oft auch bloßes Lippenbekenntnis): man
muß schon etwas dafür tun, muß zu ihnen finden, denn (anders
als manche Chronikenschreiber und Humanisten, die sich uns
mit ihrer Suada bisweilen auch ungebeten aufdrängen) kommt
der einfache Mann nicht von selbst zu uns. Er redet nicht unge-
fragt in einer Quelle. Er muß, damit er zu uns spreche, zum Re-
den genötigt werden: die Bauern von Montaillou, die Räuber um
Bern erzählen von sich (etwa der Räuber, wie er wochenlang im
Wald gelegen und vergeblich auf ein Opfer gewartet habe) weil
sie müssen, im Verhör unter Anklage. Der Bedürftige erzählt in
seiner Petition aus seinem Leben weil ihm der Antrag auf staat-
liche Pension das abverlangt. Die einfachen römischen Frauen
erzählen ihr Leben im Umkreis der Heiligen Francesca Romana
(wie sie die Heilige im Familienpalazzo haben wirtschaften se-
hen, unten Viehstall oben Adelswohnung) - weil sie endlich ein-
8
mal dürfen, aufgefordert in der Zeugenvernehmung eines Heilig-
sprechungsprozesses.5 In solchen lallen wollte man von ihren
Erlebnissen tatsächlich einmal wissen. Und selbst von hier bis zu
unserem Fall — ein eigenes Anliegen, mit begründender narratio,
vor eine bedeutende Behörde zu bringen ist es noch ein weiter
Schritt, der erklärt sein will.
Die kleinen Schicksale, von denen wir im folgenden so per-
sönlich erfahren, finden sich in Gesuchen von Personen jeden
(eben auch niederen) Standes, Klerikern wie Laien, an ein päpst-
liches Amt, an das man sich bei kirchlichen Strafen zu wenden
halte, deren Lösung nicht vom zuständigen Bischof vorgenom-
men werden konnte, sondern dem Papst vorbehalten war. Wer
in irgend einer Form gegen Bestimmungen des Kirchenrechts
verstoßen und eine entsprechende Maßregelung erfahren oder
zu befürchten hatte, beschritt diesen Weg, sei es direkt oder als
Appellation nach voraufgegangenem Prozeß vor dem örtlichen
bischöflichen Gericht. Häufig ging es etwa darum, daß ein Geist-
licher an der Verletzung oder gar am Tod eines Menschen schul-
dig oder mitschuldig geworden war und sich damit im Zustand
der irregularitas befand und folglich inhabilis war. Mit anderen
Worten: er war «non in regola» und darum «ungeeignet» zur
Ausübung seines Priesteramts. Und wenn er noch nicht Priester
war, sondern Laie oder Kleriker mit niederen Weihen, fehlte ihm
die Voraussetzung zur Erlangung der höheren Weihen und einer
Kirchenpfründe. Darum wandte er sich an Rom mit der Bitte
um Absolution (denn der Ausschluß bedrohte nicht nur den See-
lenfrieden, sondern auch die materielle Existenz) oder um eine
littera Jeclaratoria, eine Ehren- oder Unschuldserklärung, die ihm
bescheinigte, eine bestimmte Tat bzw. Sünde nicht begangen zu
haben.' Und erst recht hatte Gewalt gegen Kleriker ipso facto die
Exkommunikation zur Folge, von der nur der Papst absolvieren
9
ABB. I. Jurist mit Schriftstück. Vermutlich der Hl. Ivo, Patron der
Juristen (und vieler Juristenfakultäten), Advokaten und Notare.
Ivo Helory von Kermartin, gest. 1303, war Offizial (Vertreter des
Bischofs in Rechtssachen, besonders im Ehegericht), dann Pfarrer in
der Bretagne, deren Nationalheiliger er ist. Als Anwalt der Armen
und Bedrängten wirkte er, hier wohl die Bittschrift eines Hilfesuchen-
den lesend, vor kirchlichen und weltlichen Gerichten. So mag man
sich den Wunschadvokaten unserer Supplikanten vorstellen — und
den Geistlichen, der einem weltlichen Herrn die Fehdebriefe schrei-
ben und vorlesen konnte. Rogier van der Weyden (zugeschrieben),
St. Ivo (?, um 14.^0). London, National Gallerv.
konnte (so gerieten Täter und Opfer in eine andere, bessere
Überlieferung, die die uns bekannten Fälle unverhältnismäßig
vermehrt). In den meisten dieser Fälle war einer der Beteiligten
ein Geistlicher: doch ist der Anteil der Laien recht hoch, und die
niedere soziale Herkunft stellenweise deutlich feststellbar, zu-
mal die Gebühren «in der Regel nicht prohibitiv» waren.5
Diese dem Papst vorbehaltenen Fälle wuchsen in Zahl und
Vielfalt so an, daß sich um den Großpönitentiar, dem der Papst
seine Lösegewalt übertrug, bald eine eigene Behörde bildete,
die neben Kanzlei und Kammer zu den bedeutendsten der
römischen Kurie gehörte: die Sacra Poenitcntiaria Apostolica, das
oberste päpstliche Büß- und Gnadenamt, das für Absolution in
solchen Reservatfällen zuständig war und auf dem Gnadenwege
von den Normen des Kirchenrechts befreien konnte, für dies
eine Mal (Dispens) oder generell (Lizenz).6 Die von Klerikern
oder Laien eingereichten Bittgesuche sogenannte Suppliken,
von amtlich zugelassenen Prokuratoren in die richtige Form ge-
bracht (vgl. Abb. i) — wurden, wenn sie genehmigt waren und
den Petenten die darüber ausgefertigte littera ausgehändigt
wurde, nach Materien geordnet in die Supplikenregister einge-
tragen. Und in dieser Form liegen sie uns vor. Welche Vielfalt
von Fällen — Verstöße, Kompetenzüberschreitungen, Weihehin-
dernisse usw. da zur Sprache kommt, sei hier nicht systema-
tisch aufgeführt, sondern wird im Laufe der Darstellung in gan-
zer Breite zutage treten. Auch Geschäftsgang und Arbeitsweise
der Behörde (und weitere Fragen: wie weit die Gesuchstellcr
bei ihren Suppliken gingen; ob die Behörde aus ordentlicher
Amtsgewalt, fiat in forma, oder kraft speziellen päpstlichen Man-
dats, fat de speciali, entschied, usw.) werden nur dort und nur
soweit herangezogen, als sie dem Verständnis des Falles dienlich
sind.
• i
Das Archiv der Pönitentiarie, heute in den Räumen des Archi-
vio Segreto Vaticano (aber in der Zuständigkeit der Penitenziaria
Apostolica) war lange Zeit strikt verschlossen, da sich lange die
Auffassung hielt, das Material enthalte Aussagen pro foro interno
(also allein zwischen Beichtkind und Beichtvater), eine Veröf-
fentlichung verletze darum das Beichtgeheimnis.7 Nachdem das
Archiv 1983 der Forschung zugänglich wurde, beschloß 1991
das Deutsche Historische Institut in Rom, das im Kepcrtorium
Germanicum [RG] seit langem schon alle deutschen Betreffe in
allen vatikanischen Archivfonds sammelte,'1 auch die Suppliken-
register der Pönitentiarie in Regestenform als Kepertorium Poeni-
tentiariae Germanicum [RPG] in eigener Reihe herauszubringen.
Daß die Bearbeitung der Pönitentiarieregister so rasche Fort-
schritte macht und bereits 8 Pontifikate erfaßt, ist allein der Tat-
kraft von Ludwig Schmugge zu verdanken, der mit fachlicher
und technischer Kompetenz die Archivalienmasse durchdrang
und zusammen mit seinen Mitarbeitern, darunter vor allem sei-
ner Frau Hildegard Schneider-Schmugge, Band um Band heraus-
brachte und die kirchenrechtliche Seite der Thematik in zahlrei-
chen Publikationen erläuterte.5 Ohne diese Erschließungsarbeit
wäre das vorliegende Buch nicht geschrieben worden.10
Der folgenden Darstellung zugrunde liegen die rund 33 000
Gesuche von Petenten aus den Territorien des Reiches, die wäh-
rend der Pontifikate Eugens IV. bis Alexanders VI., also in den
Jahren 1431 bis 1503, in den Supplikenregisterbänden der Pöni-
tentiarie unter verschiedenen Rubriken (Materien) registriert
wurden. Davon werden hier die Fälle der Rubriken De diversis
jormis und De declaraioriis ausgewertet," die (im Unterschied zu
leichter bestimmbaren Materien wie «Ehehindernisse» oder
«Weihehindernisse aus unehelicher Geburt») nicht einfach in ein
Formularschema zu bringen waren und darum, die unterschied-
12