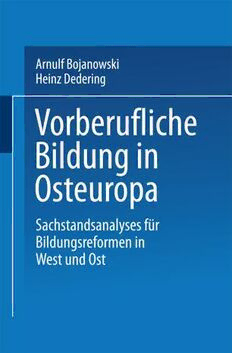Table Of ContentArnulf Bojanowski
Heinz Dedering
Vorberufliche
Bildung in
Osteuropa
Sachstandsanalyses für
Bildungsreformen in
West und Ost
Arnulf Bojanowski, Heinz Dedering
Vorberufliche Bildung in Osteuropa
Sachstandsanalysen für Bildungsreformen in West und Ost
Arnulf Boianowski, Heinz Dedering
Vorberufliche Bildung
in Osteuropa
Sachstandsanalysen fiir Bildungsreformen
in West und Ost
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Bojanowski, Amulf:
Vorberufliche Bildung in Osteuropa : Sechstandsanalysen für
Bildungsreformen in West und Ost I Arnulf Bojanowski ;
Heinz Dedering.-Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 1991
(DUV : Sozialwissenschaft)
ISBN 978-3-8244-4085-6
NE: Dedering, Heinz:
ISBN 978-3-8244-4085-6 ISBN 978-3-663-19806-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-663-19806-2
© Springer Fachmedien Wiesbaden 1991
Ursprünglich erschienen bei Deutscher Universitäts-Verlag GmbH,
Wiesbaden 1991
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Ur
heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver
arbeitung in elektronischen Systemen.
Druck und Buchbinder: difo-druck Samberg
Inhalt
Vorbemerkungen 9
A. ARBEITSLEHRE IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND - DIE INTEGRATION VON
ARBEITS- UND BERUFSBEZOGENER BILDUNG
IN DIE ALLGEMEINBILDUNG 17
1. Stand der Arbeitslehre in Theorie und Praxis 17
1.1. Zur gegenwärtigen Diskussion um die Arbeitslehre-
Konzeption 17
1.2. Die Einbindung der Arbeitslehre in die allgemein-
bildende Schule 21
2. Zentrale Probleme der Arbeitslehre vor dem Hinter-
grund des Strukturwandels in der Arbeitswelt 26
2.1. Zunehmende Komplexität der Arbeitswelt und atomi-
siertes Lernen 27
2.2. Gewandeltes Arbeitsverständnis und Vernachlässigung
subjektiver Bildungsinteressen 31
2.3. Höherqualifikation, Arbeitskräfteselektion und
ungleich verteilte Lernchancen 34
3. Perspektiven einer zukunftsorientierten Arbeitslehre 36
3.1. Bezugnahme auf die Grundstrukturen der Arbeitswelt 37
3.2. Ganzheitliche Bildung: Zur Einbeziehung von Schü-
lerarbeit 41
3.3. Arbeitslehre für alle Jugendlichen der Sekundar-
stufe I und II 45
B. STRUKTUR DES BILDUNGSWESENS UND
SITUATION DER VORBERUFLICHEN BILDUNG
IN DEN LÄNDERN OSTEUROPAS 47
1. Albanien 48
2. Bulgarien 51
3. Deutsche Demokratische Republik 58
4. Jugoslawien 64
5. Polen 70
6. Rumänien 79
6
7. Sowjetunion 85
8. Tschechoslowakei 95
9. Ungarn 102
10. Zusammenfassung 107
C. REFORMANSÄTZE UND DEFIZITE IN DEN
VORBERUFLICHEN BILDUNGSSYSTEMEN OST-
EUROPAS 113
1. Polytechnische Bildung als reduzierte Vorberei-
tung auf die Arbeitswelt 113
2. Schülerarbeit als eher anspruchs- und problemlose
Arbeitserziehung 119
3. Arbeits- und berufsbezogenes Lernen aller Jugend-
lichen als reglementierter Unterricht 124
Nachwort: Einige Vorschläge zur Intensivierung des Aus-
tausches zwischen Ost und West 127
Literaturverzeichnis 131
STUDIENANHANG: Ausgewählte Texte zur vorberuflichen
Bildung in Osteuropa 139
Bulgarien
Bernd Rothe: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt in
der polytechnischen Oberschule in der Volksrepublik
Bulgarien 139
DDR
Autorenkollektiv unter Leitung von Heinz Frankiewicz:
Der polytechnische Unterricht 150
Ministerium für Bildung und Wissenschaft der DDR:
Standpunkte und Vorschläge zur weiteren Umsetzung der
Lehrpläne für den polytechnischen Unterricht der Klassen
7 bis 12 161
7
Jugoslawien
Hans-Georg Hofmann: Das Bildungswesen in der SFR
Jugoslawien 168
Polen
Kazimierz Uzdzicki: System der polytechnischen Bildung
und Erziehung in der VR Polen 173
Rumänien
Hans Deubler: Das rumänische Bildungswesen und seine
Entwicklung 180
Sowjetunion
Gerhard Kittler/Gerd Joachim Saro: Die Weiterentwicklung
der Arbeitserziehung an der sowjetischen allgemeinbildenden
Schule 190
Bemd Meier: Umgestaltung der Arbeits- und Berufsvorberei-
tung der Schüler in der UdSSR 199
Tschechoslowakei
Hana Noväkova: Ergebnisse der polytechnischen Bildung
in den allgemeinbildenden Schulen der CSSR 207
Ungarn
Marta Ladanyi: Der neue Erziehungs- und Bildungsplan
in der ungarischen Grundschule 214
Vorbemerkungen
Mit dem Begriff des "gemeinsamen europäischen Hauses", der von
MICHAEL GORBATSCHOW Mitte der 80er Jahre in die Debatte gewor
fen worden ist, insbesondere aber mit den neueren dramatischen Verände
rungen im "real existierenden Sozialismus", hat in der Bundesrepublik
Deutschland das Interesse an Osteuropa sprunghaft zugenommen. Nicht
nur die Politik, die Wirtschaft und die Publizistik, sondern auch die Wis
senschaft- zumal die Erziehungswissenschaft- 'entdeckt' den Osten.
Dabei hat sich die Fragerichtung drastisch verändert. Bei der herkömmli
chen Beschäftigung mit den Problemen Osteuropas ließen sich zwei Rich
tungen identifizieren: Die einen betrieben eine "Ostforschung", die - den
Paradigmen des "kalten Krieges" der 50er Jahre entstammend - niemals
ganz frei von westlichem Dünkel und antisozialistischen Affekten war. Bei
den anderen, eher jüngeren Wissenschaftlern aus marxistischer oder Marx
naher Denktradition, überwog eine 'solidarische', aber im Grunde beschö
nigende Betrachtungsweise. Sie mochte aus der Auffassung rühren, daß
man als 'westlicher Sozialist' nicht die schon erreichten Errungenschaften
einer Gesellschaftsformation denunzieren dürfe, von der angenommen
wurde, sie sei dem Kapitalismus letztlich überlegen.
Angesichts der Dynamik der gesellschaftlichen Veränderungen in Europa,
alsoangesichtsdes rapiden Wandels zu mehr Demokratie in nahezu allen
Staaten und Nationen in Osteuropa, scheinenjene alten Kontroversen über
holt. Erst durch die Massendemonstrationen, die Volksaufstände, die De
mokratiebewegungen und die beobachtbaren Versuche, die verkrusteten
Gesellschaftsstrukturen Osteuropas aufzubrechen, zeigt sich eine neue Ver
bundenheit zwischen Ost und West. Fassungslos stehen wir vor der Tatsa
che, daß wir - angeleitet durch die erwähnten Forschungstraditionen - im
Grunde über die osteuropäischen Gesellschaften so gut wie gar nichts
wissen. Unser Informationsstand ist entweder ideologisiert oder schlicht
und einfach gering. Indessen wird es aber um so nötiger, verläßliche Infor-
10
mationen über die Länder Osteuropas zu gewinnen. Dies gilt auch für die
Bildungspolitik und die Erziehungswissenschaft in der Bundesrepublik
Deutschland. Zum einen kann die hiesige Erziehungswissenschaft durchaus
und in vieler Hinsicht von den Erfahrungen in Osteuropa lernen. Ohnehin
muß sie sich auf die sprunghaft gestiegene Zahl von Aus- und Übersied
lern einstellen und überlegen, wie die Lerninhalte und Schulfächer der
verschiedenen osteuropäischen Bildungssysteme mit den Strukturen des
bundesdeutschen Bildungssystems in Beziehung gesetzt werden können.
Zum anderen steht die Erziehungswissenschaft der Bundesrepublik- will
sie reale Hilfestellung für eine Demokratisierung Osteuropas leisten - vor
der Aufgabe, eine Fülle von Projekten und Kontakten in Bewegung zu
setzen, um auf verschiedenen Ebenen der jeweiligen Bildungssysteme
produktive Erfahrungen des bundesdeutschen Unterrichts-und Erziehungs
wesens fruchtbar zu machen. Dies gilt auch für den Bereich der vorberuf
lichen Bildung, in dem sich unter dem Stichwort "Polytechnische Bildung"
im Laufe der Jahre in den Ländern Osteuropas unterschiedliche Modelle
herausgebildet haben.
Mit diesen neuen Aufgaben der bundesdeutschen Erziehungswissenschaft
ist der Kontext bereits angedeutet, in dem diese Schrift zu sehen ist.
Zum einen ist die Analyse in das Bemühen eingestellt, die vorberufliche
Bildung in den allgemeinbildenden Schulen der Bundesrepublik Deutsch
land (Grundschule, Sonderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium,
Gesamtschule) mit ihrem zentralen Bereich der Arbeitslehre zukunftsorien
tiert weiterzuentwickeln.
So standen wir im Rahmen eines Gutachtens für die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages "Bildung 2000" vor der Aufgabe, Perspektiven
einer Arbeitslehre zu skizzieren, die an den gegenwärtig hervortretenden
Problemen dieses Lernfeldes anknüpfen und diese zukunftsweisend über
winden. Da die Polytechnische Bildung in den Ländern Osteuropas als
11
solche - also abgesehen von ihrer ideologischen Verpflichtung und Ein
bindung- in Fachkreisen der Bundesrepublik gemeinhin einen guten Ruf
genießt und ihr die Fähigkeit zugesprochen wird, der bundesdeutschen
Arbeitslehre vielfältige Anregungen zu geben, lag es für uns nahe, die vor
beruflichen Bildungssysteme der osteuropäischen Länder daraufhin zu
prüfen, was sie zur Beseitigung der Arbeitslehreprobleme und zur Fort
entwicklung dieses Lernfeldes herzugeben vermögen. Hierfür waren jedoch
umfängliche Literaturrecherchen notwendig, so daß es nicht möglich war,
die Ergebnisse unserer Untersuchung bereits in das Gutachten einzubrin
gen, zumal dieses zeitlich befristet und in seinem Umfang begrenzt war.
Deshalb präsentieren wir sie in dieser Schrift. Diese Vorgehensweise er
laubt es uns auch, zusätzliche Informationen durch Expertengespräche und
eigene Erfahrungen in osteuropäischen Ländern einzubeziehen. Befruch
tend auf unsere Arbeit war besonders ein Forschungsaufenthalt in Polen
zum Stand der dortigen Polytechnischen Bildung.
Zum anderen verstehen wir diese Untersuchung als eine Voraussetzung für
die Bildungsreformen in Osteuropa und damit zur demokratischen Erneue
rung der osteuropäischen Länder.
Sensibilisiert besonders durch unsere Gespräche in Polen wurde uns deut
lich, daß eine Wirtschaftshilfe für Osteuropa, auf die sich die Bemühungen
der westdeutschen Politik ja konzentrieren, allein nicht ausreicht (vgl. zum
folgenden Dedering 1989, S. 4). Ohne Frage müssen die osteuropäischen
Länder insbesondere bei der Sanierung ihrer Volkswirtschaften unterstützt
werden (etwa durch eineNa hrungsmittelhilfe, Investitionen, Kooperationen
oder bessere Exportmöglichkeiten auf westlichen Märkten). Dabei ist
jedoch darauf zu achten, daß zugleich auch der Prozeß der gesellschaftli
chen Demokratisierung in Osteuropa gefördert wird. Das eine ist mit dem
anderen eng verknüpft: Politische Reformen sind nur in dem Maße mög
lich und von Bestand, wie die Wirtschaftsreform gelingt und umgekehrt
ist die Demokratisierung der Lebensverhältnisse in den osteuropäischen