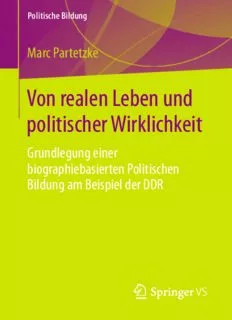Table Of ContentPolitische Bildung
Marc Partetzke
Von realen Leben und
politischer Wirklichkeit
Grundlegung einer
biographiebasierten Politischen
Bildung am Beispiel der DDR
Politische Bildung
Herausgegeben von
C. Deichmann, Jena
I. Juchler, Potsdam
Die Reihe Politische Bildung vermittelt zwischen den vielfältigen Gegenstän
den des Politischen und der Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen in
politischen Bildungsprozessen an Schulen, außerschulischen Einrichtungen und
Hochschulen. Deshalb werden theoretische Grundlagen, empirische S tudien und
handlungsanleitende Konzeptionen zur politischen Bildung vorgestellt, um unter
schiedliche Zugänge und Sichtweisen zu Theorie und Praxis politischer Bildung
aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. Die Reihe Politische Bildung wendet
sich an Studierende, Referendare und Lehrende der schulischen und außerschuli
schen politischen Bildung.
Herausgegeben von
Carl Deichmann Ingo Juchler
Institut für Politikwissenschaft Lehrstuhl für Politische Bildung
FriedrichSchillerUniversität Jena Universität Potsdam
Jena Potsdam
Deutschland Deutschland
Weitere Bände in dieser Reihe
http://www.springer.com/series/13420
Marc Partetzke
Von realen Leben und
politischer Wirklichkeit
Grundlegung einer
biographiebasierten Politischen
Bildung am Beispiel der DDR
Marc Partetzke
Bremen, Deutschland
Dissertationsschrift; Dissertation gefördert durch ein Graduiertenstipendium des
Landes Thüringen
Politische Bildung
ISBN 9783658134495 ISBN 9783658134501 (eBook)
DOI 10.1007/9783658134501
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer VS ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Vorwort
Dass den meisten Publikationen Vorworte vorangestellt sind, ist allgemein bekannt. Dass die meisten
dieser Vorworte Danksagungen enthalten, möglicherweise auch. Dass diese Danksagungen mehr als
das Bedienen eines bestimmten Topos’ oder mitnichten bloße Lippenbekenntnisse sind, können hin-
gegen wohl nur all’ diejenigen voll umfänglich erfassen, die selbst längere Zeit an einer solchen Pub-
likation gearbeitet haben.
Als mich Herr Professor Dr. Carl Deichmann im Jahr 2009 dazu ermutigt und diese Ermutigung
anlässlich der Examenspreisverleihung durch den Förderverein des Instituts für Politikwissenschaft
der Friedrich-Schiller-Universität Jena e.V. erneuert hat, das Thema „Biographisch-personenbezogen-
er Ansatz in der Politischen Bildung“ im Rahmen einer Dissertation zu bearbeiten, ahnte ich – zumal
angesichts meines gerade bestandenen Examens – noch nicht, welch’ langer, erkenntnisreicher,
manchmal steiniger, niemals aber geradliniger Weg trotz einer hohen Motivation vor mir liegen wür-
de. Indes Hinweise darauf gab es zuhauf. So musste etwa parallel zu den konzeptionellen Vorarbeiten
die Finanzierung des geplanten Dissertationsprojektes sichergestellt werden. Dass diese Finanzierung
nach einigen Rückschlägen letztlich doch erfolgreich zustande gekommen ist, verdanke ich neben der
Unterstützung durch Frau Professorin Dr. Dr. h.c. Monika Schwarz-Friesel und Herrn Professor Dr.
Reinhardt Hahn insbesondere dem Freistaat Thüringen sowie der Graduiertenakademie der Friedrich-
Schiller-Universität Jena, die mir ein auskömmliches Landesgraduiertenstipendium gewährt haben.
Dass ich trotz dieses Stipendiatenstatus’, der mir einige überaus angenehme Freiheiten gestattet hat,
nie die institutionelle Anbindung an das politikwissenschaftliche Institut im Besonderen sowie die
Jenaer Universität im Allgemeinen verloren habe, verdanke ich neben der Möglichkeit im ersten Jahr
meiner Dissertation verschiedene Lehraufträge wahrnehmen zu dürfen, insbesondere Herrn Professor
Dr. Michael May, nach der Emeritierung Herrn Deichmanns Inhaber der Professur für die Didaktik der
Politik an der FSU Jena, dessen Mitarbeiter ich von 2012 bis 2014 gewesen bin. Trotz der damit ver-
bundenen Aufgaben hat Michael May mich stets dabei unterstützt, mein Dissertationsprojekt konse-
quent voranzutreiben.
Eben diese kollegiale Unterstützung habe ich sodann auch durch Herrn Professor Dr. Andreas
Klee, Direktor des Zentrums für die Didaktiken der Sozialwissenschaften sowie des Zentrums für Ar-
beit und Politik an der Universität Bremen, erfahren, an der ich seit 2014 als Lektor für Politikwissen-
schaft und ihre Didaktik tätig bin. Trotz des an diese Stelle gebundenen Deputates akademischer
Lehrveranstaltungen sowie weiterer, an sie geknüpfte Aufgaben ist auch Andreas Klee stets darum
bemüht gewesen, dass ich mein Projekt zügig vorantreiben und zeitnah beenden kann und hat mich im
Großen wie im Kleinen sehr dabei unterstützt. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich dazu bereit erklärt
hat, meine Dissertationsschrift als Zweitprüfer zu begutachten, gebührt ihm großer Dank.
Eine Unterstützung, ohne die die vorliegende Arbeit nicht auf die Beine zu stellen gewesen wäre,
habe ich schließlich durch weitere Kolleginnen und Kollegen in Jena und Bremen erfahren. Trotz der
dabei stets existierenden Gefahr wichtige Personen zu vergessen, seien hier dennoch Dr. Dennis Hauk,
Dr. Steffen Piller, Christian Tischner, Benjamin Moritz, Marianne Beyer, Hendrik Schröder, Luisa
Lemme, Julia Neuhof, Katharina Röckendorf sowie Gaby Thiemann erwähnt. Unbedingt genannt
werden müssen in diesem Zusammenhang aber auch die studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an beiden Standorten, deren Engagement ich wohl einige Male über Gebühr in Anspruch genom-
men habe. Stellvertretend sei daher Dorothee Suchomel, Jakob Simon, Chris-Constanze Fahsing,
VI Vorwort
Helen Cornelius und Hannah Franke gedankt. Besondere Erwähnung finden müssen sodann auch die
Mitglieder des von Herrn Deichmann verantworteten Doktorandencolloquiums, in dessen Rahmen es
mir mehrfach möglich gewesen ist, über den Arbeitsstand meines Projektes zu berichten, besonders
aber die im Rahmen meiner Arbeit erhobenen Daten gemeinsam mit anderen intensiv zu interpretie-
ren. Dank gilt außerdem vielen Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaft für Politikdidaktik und
politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE). Besonders hervorzuheben ist neben dem Ar-
beitskreis „Hermeneutische Politikdidaktik“, in dessen Rahmen durchweg konstruktive Kritik geübt
worden ist, der wissenschaftliche Nachwuchs der GPJE, aus dem sich im Laufe der Zeit neben zahl-
reichen kollegialen Verbindungen auch einige feste und wichtige Freundschaften entwickelt haben.
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all’ jenen Menschen, die sich im Rahmen meines
Dissertationsprojektes zu einem autobiographisch-narrativen Interview bereit erklärt haben. Dies ist
vor allem deshalb besonders zu würdigen, weil es sich bei dieser Interviewform um eine handelt, bei
der die durch sie hervorgerufenen Gespräche in den meisten Fällen erst unter Inkaufnahme eines ganz
erheblichen zeitlichen, kognitiven sowie emotionalen Kraftaufwandes der Interviewten zustande
kommen. Da ein Gutteil der vorliegenden Arbeit ohne die Bereitschaft hierzu mithin nicht zu realisie-
ren gewesen wäre, sei allen Interviewten noch einmal mein tiefer Dank ausgesprochen.
Nicht nur zu bedanken, sondern auch zu entschuldigen habe ich mich schließlich bei meiner
Familie und meinen Freunden. Nicht nur, dass sie alle stets dann aufmunternde Worte für mich gefun-
den hatten, wenn mich Momente der Unsicherheit heimsuchten. Viel zu oft haben sie alle auch mit
meinen dadurch hervorgerufenen Launen umgehen müssen. Dass ich Euch allen für Euer Durchhalte-
vermögen danke und es mit meiner Entschuldigung tatsächlich ernst meine, kommt hoffentlich da-
durch zum Ausdruck, dass Euch allen diese Arbeit gewidmet ist. Ganz besonders bedanken möchte ich
mich bei Lisa Peyer, von der ich stets und ständig jenen Rückhalt erfahren durfte, der für die Fertig-
stellung eines derartigen Projekts so unerlässlich ist und in der ich – nicht nur im akademischen Sinne
– eine echte Gefährtin gefunden habe. Liebe Lisa: ganz, ganz herzlichen Dank! Ich hoffe, ich kann
mich – auch im Hinblick auf Dein Projekt – gebührend revanchieren.
Mein größter Dank gilt schließlich dem Betreuer meiner Dissertation, Herrn Professor Dr. Carl
Deichmann. Noch zu Beginn meines Studiums ein Dozent neben anderen ist er zunächst als mein Chef
während meiner Zeit als studentischer Mitarbeiter an der Jenaer Professur, dann während meiner Zeit
als Lehrbeauftragter an der FSU und schließlich als der engste Begleiter meines Projektes für mich zu
einem unschätzbaren akademischen Lehrer geworden. Seine allzeit voll umfängliche Unterstützung
sowohl mit Blick auf akademische als auch private Belange, seine Erfahrung und Weitsicht, die mich
vor manchem Schnellschuss bewahrt haben, seine Zuversicht, seine Gelassenheit und insbesondere
sein in mich gesetztes Vertrauen machen ihn für mich zu weitaus mehr als ›nur‹ zu dem Betreuer der
hier vorliegenden Arbeit. Für all’ dies – und mehr – gilt ihm mein tiefer Dank!
Bremen/Jena im Frühjahr 2016
Inhaltsverzeichnis VII
Abbildungsverzeichnis XIII
Tabellenverzeichnis XV
I Einleitung 1
1 Zielbestimmung Politischer Bildung: Verstehen politischer ›Realität‹ 1
1.1 Theoretischer, empirischer und normativer Ausgangspunkt 1
1.2 Politische ›Realität‹ im Kontext einer hermeneutischen Politikdidaktik 9
1.3 Fragestellungen, Ziel und Aufbau dieser Arbeit 17
1.4 Forschungsstand und verwendete Literatur 21
IIa Das Gegenstandsfeld der Biographieforschung 25
2 Das Gegenstandsfeld der Biographieforschung. Grundlagen, relevan-
te Fachbereiche und die Dimensionen der Biographie(-forschung) 25
2.1 Die psychologische Dimension der Biographie(-forschung) und die Bio-
graphie im Kopf 25
2.2 Die sprachliche Dimension der Biographie(-forschung) und die Biogra-
phie als Text 37
2.2.1 Die Memoire 42
2.2.2 Die Autobiographie 42
2.2.3 Die Biographie 46
2.3 Die Wirklichkeitsdimension der Biographie und die Biographie als Leben 49
2.4 Die soziologische Dimension der Biographie(-forschung) und die Bio-
graphie in der Gesellschaft 51
IIb Die Peripherie des Gegenstandsfeldes 61
2.5 Die (Auto-)Biographie in der Geschichtswissenschaft 61
2.5.1 Die historisch-politische Biographie ›großer Persönlichkeiten‹
als Genre der Historiographie 62
2.5.2 oral history und die Biographien von ›Namenlosen‹ 73
2
2.6 Biographie und Person in der (deutschen) Politikwissenschaft 81
2.6.1 Die Person als Politiker/-in: Politische Führung und
politischer Stil 86
VIII Inhaltsverzeichnis
2.6.1.1 Normative Ansätze der leadership-Forschung und das Konzept
›politischer Stil‹ 89
2.6.1.2 Empirisch-analytische Ansätze der leadership-Forschung 92
2.6.2 Die Person als Ideenspenderin: Politische Theorie und Ideen-
geschichte 101
2.6.2.1 Theorie 102
2.6.2.2 Politische Theorie, Politische Philosophie, Moderne Politische
Theorie, Ideengeschichte 103
2.6.3 Gründe für die Vernachlässigung/Vermeidung der ›politischen‹
Person und ihrer Biographie innerhalb der Politikwissenschaft
2SP
– eine conclusio 112
2.6.4 (K)Eine politikwissenschaftliche Biographik? 117
III Der biographisch-personenbezogene Ansatz in der Politi-
schen Bildung 125
3a Hintergrundfolien der Ansatzbegründung 125
3.1 Zum Verhältnis von Politischer Bildung, Politikwissenschaft und Politik-
didaktik 125
3.1.1 Politische Bildung 125
3.1.2 Politikwissenschaft und Politische Bildung 127
3.1.3 Politikdidaktik 128
3.1.4 Politikdidaktik, Politikwissenschaft und Politische Bildung 129
3.2 Das Leitziel Politischer Bildung 132
3.2.1 Demokratisch-politisches Bewusstsein 136
3.2.1.1 Bewusstsein 137
3.2.1.2 Politikbewusstsein 141
3.2.1.3 Demokratiebewusstsein 144
3.2.1.4 Die Entwicklung des politischen Bewusstseins 146
3.2.2 Demokratisch-politische Identität 149
3.2.2.1 Funktionen autobiographischer Erinnerungen 150
3.2.2.2 Entwicklung des Selbstkonzepts 152
3.2.2.3 Die Entwicklung demokratisch-politischer Identität 160
3b Zur Begründung des biographisch-personenbezogenen Ansatzes in
der Politischen Bildung 167
3.3 Biographien als potentielle Medien der Politischen Bildung 172
2SPD
Inhaltsverzeichnis IX
3.3.1 Biographien als mit den durch die Institution Schule vorge-
2SPD
gebenen (Rahmen-)Bedingungen kompatible Medien 175
3.3.2 Biographien als Lernhelfer im Politikunterricht 177
2SPD
3.3.2.1 Anthropogene Voraussetzungen 177
3.3.2.2 Sozialkulturelle Voraussetzungen 180
3.3.2.3 Biographien als Motivation erzeugende Medien des Politik-
2SPD
unterrichts 186
3.3.3 Biographien als die bildende Sachbegegnung ermöglichende
2SPD
Medien des Politikunterrichts 190
3.3.3.1 Dimensionen des Politikbegriffs 193
3.3.3.2 Dimensionen der Erkenntnisebenen 195
3.3.4 Biographien als zum Erreichen der Ziele des Politikunter -
2SPD
richts geeignete Medien 202
3.3.4.1 Perspektivenübernahme und politische Responsibilität 207
3.3.4.2 Sozialwissenschaftliches Analysieren: Urteilsbildung I 209
3.3.4.3 Politisch-moralisches Urteilen: Urteilsbildung II 230
3.3.4.4 Konfliktlösung bzw. Vermittlung konfligierender Urteile in
sozialer Auseinandersetzung 244
3.3.4.5 Partizipation(-sfähigkeit) 255
3c Potentielle Grenzen und mögliche Probleme des biographisch-
personenbezogenen Ansatzes in der Politischen Bildung – eine Dis-
kussion 265
IV Politikdidaktische (Auto-)Biographieforschung 277
4.1(cid:1) Einleitung 277
4.2 Die ehemalige DDR als Gegenstand Politischer Bildung 279
4.2.1 Zentrale Ergebnisse ausgewählter empirischer Studien… 281
4.2.1.1 …zur Stellung der ehemaligen DDR in der universitären For-
schung und Lehre 281
4.2.1.2 …zur Stellung der ehemaligen DDR in Lehrplänen 283
4.2.1.3 …zur Stellung der ehemaligen DDR in Schulbüchern 285
4.2.1.4 …zum DDR-spezifischen Wissen/DDR-bezogenen Bild von
Schüler(inne)n 287
4.2.2(cid:1) Bewertung der Ergebnisse/Kontextualisierung bereits existieren-
der Interpretationen 290
Description:Die vorliegende Arbeit zeigt, dass und wie sich der biographisch-personenbezogene Ansatz als eine neue politikdidaktische Lehr-Lern-Strategie begründen lässt. Gezeigt wird ferner, dass sich als Folge und Voraussetzung dieser Begründung gleichermaßen ein neues politikdidaktisches Forschungs- und