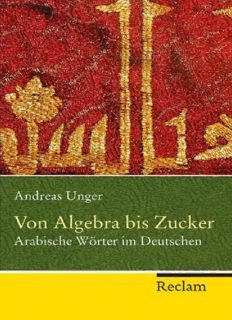Table Of ContentAndreas Unger
Von Algebra bis Zucker
Arabische Wörter im Deutschen
Reclam
2
Alle Rechte vorbehalten
© 2006, 2013 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Reihengestaltung: büroecco!, Augsburg
Umschlaggestaltung: Eva Knoll, Stuttgart, unter Verwendung
der Abbildung: Arabischer Segensspruch auf der Borte
des »Krönungsmantels« von König Roger II. von Sizilien
(Wien, Kunsthistorisches Museum, Weltliche Schatzkammer –
Foto: KHM, Wien)
Satz und e-book-Konvertierung: pagina GmbH, Tübingen
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2013
RECLAM ist eine eingetragene Marke
der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960334-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020281-4
www.reclam.de
3
Inhalt
Vorwort
Abkürzungen
Transkription arabischer Laute
Lexikon
Anhang
4
5
Vorwort
Gibt es einen »Kampf der Kulturen« (Samuel P. Huntington)? Der Blick auf die Geschichte der arabischen Wörter im
Deutschen ermöglicht jedenfalls eine andere Sichtweise: die des »Zusammenwirkens der Kulturen« (Claude Lévi-Strauss).
Dies aus zwei Gründen: Zum einen kann durch das Verfolgen der Wort- und Kulturgeschichte eines Begriffs von seinem ersten
Auftreten bis in die heutige Zeit sehr anschaulich der Weg von Kulturgütern zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen
nachvollzogen werden; zum anderen ist das Arabische diejenige außereuropäische Sprache, aus der die meisten Wörter in die
Sprachen des Westteils Europas gelangt sind. Dies ist kein Zufall: Die meisten dieser Wörter sind nämlich im Mittelalter
übernommen worden, wo die Muslime ab dem 8. Jahrhundert eine Kultur entwickelt hatten, die derjenigen der Bewohner des
Westens Europas nach heutigen Maßstäben in vielerlei Hinsicht überlegen war und diese deshalb faszinierte.
Die Entstehung dieser Kultur beruhte aber auf einem längeren Prozess. Zwar war schon in der Antike das durch den
Weihrauchhandel berühmte »Glückliche Arabien« als eigenständige Zivilisation aufgetreten (s. Myrrhe); und die Einführung
des Islam und die Einigung der arabischen Stämme durch den Propheten Mohammed (gest. 632) hatten einen gewaltigen
politischen und kulturellen Schub bewirkt. Dass es den Muslimen aber gelang, innerhalb eines Jahrhunderts ein Imperium zu
errichten, das von der spanischen Halbinsel bis zum Indus reichte, beruhte auch auf einer klugen und relativ toleranten Politik
insbesondere gegenüber Christen und Juden als den »Schriftbesitzern« (s. Dschihad, Koran), welche bewirkte, dass die
Einheimischen die arabischen Eroberer vielfach wohlwollend aufnahmen und sich dann einigermaßen problemlos in das
entstehende arabisch-muslimische Staatsgebilde integrierten. Über sie vermittelten sich den Arabern aber nun die
Errungenschaften und Kenntnisse der griechisch-hellenistischen und der persischen Kultur (s. Karat, Schach). Die Entstehung
eines einheitlichen Handelsraums bewirkte zudem, dass auch Produkte und Errungenschaften aus China (s. Ries, Satin) und
Indien (s. Ziffer, Zucker) sowie aus Afrika (s. Gamasche) bekannt und dann in den muslimischen Gebieten heimisch wurden.
Eine erstaunliche, auch religiös motivierte Wissbegier (s. Ries) führte ferner dazu, dass in großem Umfang Texte aus den
Wissenschaften der Perser, Inder und insbesondere der Griechen ins Arabische übersetzt wurden; das so erworbene Wissen
wurde dann eigenständig weiterentwickelt (s. Algebra) und durch Buchhandel und Bibliotheken verbreitet. Mit den neuen
Kulturgütern haben die Araber aber oft die Wörter der Herkunftssprache übernommen und an das Arabische angepasst. Dies
erklärt, warum von den in den folgenden Artikeln behandelten Wörtern nahezu die Hälfte ursprünglich nicht arabischer
Herkunft ist. Verbindendes Element der so entstandenen islamisch geprägten Kultur war jedenfalls die arabische Sprache. In
ihr drückten sich zumindest in ihren naturwissenschaftlichen Werken selbstverständlich auch christliche Perser aus wie der in
Artikeln mehrfach erwähnte Arzt aṭ-Ṭabarī (gest. um 865), der erst spät zum Islam übertrat, als auch spanische Juden wie
Maimonides, welcher, durch die rigide Religionspolitik der Almohadenherrscher ins Exil gezwungen, 1204 als Leibarzt eines
Sohns von Sultan Saladin in Kairo starb.
Auf diese Kultur trafen die westlichen Europäer (also die Bewohner des ehemaligen Weströmischen Reichs und
angrenzender Gebiete) in Spanien und Sizilien, auf den Kreuzzügen in Syrien und Palästina und fortschreitend im Rahmen des
Mittelmeerhandels auch in muslimischen Hafenstädten. Sie suchten vor allem das nachzuahmen, was sie als Luxus empfanden:
Wie sich beispielsweise in Wolfram von Eschenbachs »Parzival« an vielen Stellen zeigt, bemühte sich der Adel Westeuropas,
seine Stellung durch den Import von Gold und Edelsteinen (s. Azur, Karat), seidenen Stoffen (s. Baldachin), exotischen
Gewürzen (s. Safran) und Duftstoffen (s. Ambra) sowie durch Übernahme gesellschaftlicher Gepflogenheiten (s. Schach,
Zucker) nach außen hin glänzend deutlich zu machen. Aber auch das gesammelte Wissen der arabischen Kultur zog die
Europäer an. Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts, als Constantinus Africanus, wahrscheinlich ein zum Christentum
konvertierter Kaufmann aus dem heutigen Tunesien, sich daranmachte, für die Medizinschule in Salerno bei Neapel arabische
Werke auf Lateinisch wiederzugeben, entstanden ganze Übersetzerschulen oder -zentren, in denen Texte insbesondere aus den
Bereichen Medizin bzw. Pharmakologie (s. Mumie, Racket), Mathematik (s. Ziffer), Alchimie (s. d.), Astronomie und
Astrologie (s. Zenit), Geographie und Philosophie ins Lateinische übertragen wurden. Vor allem für die Verwendung in
6
(übersetzten) medizinischen Rezepten wurden zahlreiche Substanzen, sogenannte Drogen, eingeführt (s. Kampfer, Zucker); die
Kontakte im Mittelmeerraum ermöglichten zudem die Übernahme von Techniken, Einrichtungen und Geräten der muslimischen
Welt (s. Arsenal, Ries, Zenit).
Wie schon die arabische Welt Jahrhunderte zuvor entwickelten auch die Europäer die übernommenen Kenntnisse
selbständig weiter: Das Gemisch aus Schwefel, Salpeter und Holzkohle beispielsweise – ursprünglich eine Erfindung aus
China – erlangte seine enorme Bedeutung als Schießpulver erst, nachdem sie die Geschützrohre erfunden hatten (s. Kaliber,
Natron). Diese Fortentwicklungen aber trugen dazu bei, dass sich etwa ab dem 13. Jahrhundert das Verhältnis zwischen der
muslimischen und der christlich-westeuropäischen Welt änderte: Gegenüber dem inzwischen zerfallenen Kalifenreich und
angesichts der Stagnation von Forschungen und Neuerungen in den arabischsprachigen Gebieten erlangten Venezianer und
Genuesen, aber auch Katalanen und Franzosen allmählich die wirtschaftliche Vorherrschaft im Mittelmeerraum (s. Arsenal,
Zechine). Mit dem daraus folgenden Rückgang des Imports muslimischer Kulturgüter nahmen auch die Neuentlehnungen aus
dem Arabischen ab, und bereits vorhandene Wörter wurden im medizinischen Bereich im Rahmen des Wiederauflebens des
klassischen Griechisch und Latein durch Begriffe aus diesen Sprachen allmählich verdrängt. Diese Entwicklungstendenzen
wurden im 16. und 17. Jahrhundert ein wenig aufgehalten, als die kulturelle Ausstrahlung des Osmanischen Reichs dazu führte,
dass die Europäer Kulturgüter übernahmen, von denen einige Bezeichnungen trugen, die aus dem Arabischen stammten
(s. Kaffee, Lila, Sofa). Vor allem die Entwicklung von Naturwissenschaften und Industrie in Europa bewirkte dann aber, dass
viele Wörter arabischer Herkunft in Vergessenheit gerieten; das Wort (nhd.) Lack (s. d.) etwa, das ursprünglich ein
Rohprodukt aus Indien bezeichnete, welches zum Färben und in der Medizin genutzt wurde, überlebte vielleicht nur dadurch,
dass sich seine Bedeutung im Lauf der Zeit zu »(industriell hergestelltem) konservierendem Anstrich« gewandelt hatte. Neu
aufgenommen wurden ab dem 18. Jahrhundert nur noch wenige landestypische Begriffe aus Reiseberichten (s. Kadi) oder im
Rahmen von Kolonialherrschaft (s. Razzia, Safari); erst in neuester Zeit tragen Globalisierung und neue Gewohnheiten
(s. Safran, Hamam) ebenso wie die muslimische Einwanderung (s. Islam, Falafel, Moschee) und schließlich politisch-
ideologische Auseinandersetzungen (s. Minarett, Scharia) dazu bei, dass einige Wörter arabischer Herkunft im Deutschen neu
belebt oder erstmals heimisch werden.
Es fällt auf, dass Art und Umfang der Entlehnungen nicht davon abhängen, inwieweit sich Westeuropa in einem
konfliktreichen oder entspannteren Verhältnis zur islamischen Welt befand. Im Gegenteil, etwa die Hälfte der im Buch
behandelten Wörter sind zur Zeit der Kreuzzüge entlehnt worden, ein weiteres Dutzend zur Zeit der Türkenkriege, ein
zusätzlicher Hinweis darauf, dass die Sogwirkung, die von einer reicheren oder als überlegen bzw. interessant angesehenen
Kultur ausgeht, weit wirksamer ist als ideologische Vorbehalte, die mit der politischen Situation zusammenhängen (s. Admiral,
Islam). Wohl aber werden die entschiedene Hinwendung von Intellektuellen der Renaissance zur griechisch-römischen Antike
und die damit verbundene Ablehnung des Arabischen – auch als Teil des »dunklen« Mittelalters – dazu beigetragen haben,
dass nicht nur arabische Wörter in Vergessenheit gerieten, sondern auch der arabisch-islamische Beitrag zur Entwicklung
Europas weitgehend verdrängt wurde (de Libéra). Ein kurioses Beispiel hat Hans Belting herausgestellt: Die Entdeckung der
Zentralperspektive im 15. Jahrhundert in Florenz wurde ermöglicht durch die Rezeption der Theorie der Lichtstrahlen von Ibn
al-Haiṯam (mlat. Alhazen, gest. um 1040). Sein zugrunde liegendes Werk über die Optik war allgemein bekannt und wurde
noch Ende des 16. Jahrhunderts unter dem Titel »Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis« neu herausgegeben. Nichtsdestoweniger
zitiert einer der bekanntesten Theoretiker aus Florenz zwar ausführlich aus diesem Werk, verortet den Verfasser aber unter
dem Namen Alfantem irgendwo in der Antike, in welcher im übrigen angeblich schon der Römer Vitruv mit der Perspektive
gearbeitet habe. Und anderswo wurden die Forschungen des griechischen Mathematikers Euklid (auf denen Alhazen natürlich
aufbaute) als entscheidender Baustein zur Entwicklung der Perspektive gesehen. Insgesamt wurde den Arabern zumeist im
besten Fall lediglich die Rolle von Übermittlern der griechischen Wissenschaften zugebilligt – vielfach galten sie jedoch
gleichzeitig auch als deren Verfälscher (s. Alchimie, Spinat). Diese Sichtweise veränderte sich zumindest teilweise im
Zeitalter der Aufklärung – für Herder waren die Araber sogar »die Lehrer Europas« (s. Ghasel); in vergleichbarer Form
7
entwickelte sie sich aber wieder im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die Europäer ihre kolonialen Eroberungen damit
rechtfertigten, dass sie den eroberten Völkern die – europäische, in der griechischen Antike begründete – Zivilisation brächten.
Ins Deutsche sind die arabischen Wörter fast ausnahmslos zeitlich verzögert über andere europäische Sprachen gelangt,
neben dem Mittellateinischen vor allem über das Italienische und Französische. Dies liegt in erster Linie daran, dass
Deutschland bzw. das deutschsprachige Territorium praktisch nie an muslimische Gebiete grenzte und am Mittelmeerhandel
nicht beteiligt war. So vollzog sich die Übernahme dieser Wörter meistens in der Weise, dass man, etwa aus Italien oder
Frankreich, eine Neuerung oder Mode übernahm, die dort mit einem ursprünglich arabischen Wort belegt war: Aus (ar.)
maṭraḥ abgeleitetes materaffe taucht beispielsweise erstmals im 10. Jahrhundert in Spanien auf; als wertvolles Luxusgut
erscheint (mhd.) matraz, übernommen aus dem Italienischen oder Französischen dann um 1210 im »Parzival«; die heutige
Wortform Matratze geht allerdings auf eine neuerliche Entlehnung des Worts aus dem Italienischen des 15. Jahrhunderts
zurück, wo materazzo das Unterbett bezeichnete, das allmählich ein verbreiteter Gebrauchsgegenstand wurde.
Für die Auswahl der in den folgenden Artikeln dargestellten Wörter war erstes Kriterium, dass sie einigermaßen
zweifelsfrei aus dem Arabischen stammen. Wo dies nicht erwiesen ist, wurden Wörter wie Albatros, Almanach, Antimon,
Balsam, Farbe, Havarie, Jacke, Kabel, (Fata) Morgana, Mafia, Mütze, Scharlach, Risiko, Tabak, Troubadour, Watte u. a.
deshalb nicht in das Buch aufgenommen. Die zweite Bedingung war, dass sie im heutigen Deutschen bekannt und verankert
sind. Aus diesem Grund fehlen etwa früher beliebte Drogen bzw. Gewürze, wie Galgant oder Kubebenpfeffer, deren Namen
heute nur noch einige Apotheker kennen dürften. Ebenso beispielsweise die Zibebe, eine Rosinenart, die um 1900 noch so
bekannt gewesen sein muss, dass Christian Morgenstern dichten konnte: »Ich schieße keine Möwe tot, / ich laß’ sie lieber
leben – / und füttre sie mit Roggenbrot / und rötlichen Zibeben.« Viele andere heute relativ unbekannte Wörter, die beiläufig in
den Wortartikeln erwähnt und erklärt werden, tauchen allerdings im Register auf. Dort erscheinen auch einige Personen-, Orts-
und Völkernamen, die üblicherweise in etymologische Lexika nicht aufgenommen werden. Einige kaum mehr bekannte Wörter
wie Ghasel, Racket, Ries oder Zechine schließlich verdanken ihre Aufnahme als eigene Artikel in das Buch dem Bestreben,
möglichst alle wichtigen Bereiche des arabisch-muslimischen Einflusses auf das westliche Europa an Beispielen von Wörtern
darzustellen. Für das Gebiet der Philosophie, wo beispielsweise der Aristoteles-Kommentar des wie Maimonides ins Exil
getriebenen Averroes (latinisiert aus Ibn Rušd, gest. 1198) ähnlich wie Maimonides’ »Führer der Unschlüssigen« die
Auseinandersetzung über das Verhältnis von Vernunft und Glauben im westlichen Europa anregte und beeinflusste, war das
allerdings nicht möglich; aus ihrem Bereich ist kein arabischer Begriff in europäische Sprachen übernommen worden.
Entsprechendes gilt für die »Geburt der ›deutschen Mystik‹ aus dem Geist der arabischen Philosophie«, wie Kurt Flasch es
etwas provokativ formuliert hat.
Mein besonderer Dank gilt Jürgen Kluwig, Dr. Emilie Unger und Dr. Ernst Unger, ohne deren Unterstützung, sowie Judith
Grzegorczyk, ohne deren Recherchen das vorliegende Buch nicht zustande gekommen wäre. Von den vielen Personen, bei
denen ich mich für Informationen bedanke, möchte ich in erster Linie Prof. Walter W. Müller und Dr. Monica Niederer
(»Mittellateinisches Wörterbuch«), aber auch Prof. Peter Dilg, Prof. Paul Kunitzsch, Dr. Heinrich Kohring, Jürgen Neuss,
Prof. Diether R. Reinsch und Dr. Angela Schottenhammer erwähnen.
8
9
Abkürzungen
afrz. altfranzösisch
äg. ägyptisch
ahd. althochdeutsch
aind. altindisch
akkad. akkadisch
aprov. altprovenzalisch
ar. arabisch
aram. aramäisch
byz.-gr. byzantinisch-griechisch
chin. chinesisch
dt. deutsch
engl. englisch
frnhd. frühneuhochdeutsch
frz. französisch
gr. griechisch
hebr. hebräisch
it. italienisch
kat. katalanisch
lat. lateinisch
mhd. mittelhochdeutsch
mind. mittelindisch
mlat. mittellateinisch
mndl. mittelniederländisch
mpers. mittelpersisch
ndd. niederdeutsch
ndl. niederländisch
ngr. neugriechisch
nhd. neuhochdeutsch
nlat. neulateinisch
npers. neupersisch
osm.-tk. osmanisch-türkisch
pers. persisch
pl. Plural
port. portugiesisch
prov. provenzalisch
siz. sizilianisch
sp. spanisch
syr. syrisch
tk. türkisch
* Wort(form) ist erschlossen, nicht belegt
10
Description:Reclam, 2013. — 190 pages. — ISBN: 3150202817.Das Minarett, der Harem, die Falaffel – das sind Wörter aus der arabischen Sprache, die sich bei uns mit den Dingen, die sie bezeichnen, eingebürgert haben. Aber auch so geläufige, zum Teil ganz treudeutsch anmutende Wörter wie Aprikose, Benzin