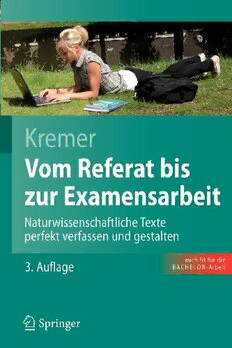Table Of ContentSpringer-Lehrbuch
Bruno P. Kremer
Vom Referat bis zur
Examensarbeit
Naturwissenschaftliche Texte perfekt
verfassen und gestalten
3., erweiterte und aktualisierte Auflage
1 J
Dr. Bruno P. Kremer
Universität zu Köln
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Institut für Biologie und ihre Didaktik
Gronewaldstraße 2
50931 Köln
Deutchland
[email protected]
ISSN 0937-7433
ISBN 978-3-642-02239-5 e-ISBN 978-3-642-02240-1
DOI 10.1007/978-3-642-02240-1
Springer Heidelberg Dordrecht London New York
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2004, 2006, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver-
vielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom
9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Einbandentwurf: WMXDesign GmbH, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem Papier
Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Nur weniges vorweg
Vorworte werden gewöhnlich nicht, allenfalls ungern oder höchstens dia-
gonal gelesen. Zugegeben: Sie blockieren den Weg zur Buchbotschaft, sind
oft reichlich langatmig, thematisieren fallweise psychosoziale Befindlich-
keiten des Autors und liefern kaum Essenz zum Thema. Angesichts dieser
Ausgangslage beschränken sich die folgenden Zeilen auf nur wenige not-
wendige Mitteilungen.
Bereits die erste, 2004 unter dem Titel „Texte schreiben im Biologiestu-
dium“ erschienene Auflage dieses Buches traf offenbar ins Schwarze, denn
ausnahmslos alle Rezensenten und sonstige um ihre Einschätzung gebete-
ne Mitmenschen an den verschiedenen Schreibfronten unserer Branche
fanden überaus freundliche sowie bestätigende bis ermunternde Worte zu
Konzept, Inhalt, Struktur, Stil und Gebrauchswert. Ebenso verhielt es sich
mit der aktualisierten zweiten Auflage (2006). Diese richtete sich nicht
mehr nur an schreibverzweifelt Ratsuchende aus den Biowissenschaften,
sondern erweiterte die Zielgruppe um Adressaten aus allen Naturwissen-
schaften: Wo immer in der naturwissenschaftlich-technischen Praxis eine
Textversion von Arbeitsergebnissen zu erstellen ist, kann dieser kurze,
kompakte Leitfaden die benötigte handwerkliche Hilfestellung bieten. Das
Umsetzen einer zündenden Idee oder eines unbedingt mitteilenswerten
Ergebnisses in einen lesefertig abgesetzten Text stellt sich im Prinzip über-
all gleich dar – in der Biologie ebenso wie in den Agrarwissenschaften und
in der Chemie, in den Geowissenschaften gleichermaßen wie in Medizin,
Pharmazie und Physik. Die auch in dieser Auflage verwendeten Beispiele
stammen zwar immer noch oft aus der Biologie (was sich aus dem fachli-
chen Hintergrund des Autors erklärt), stehen aber stellvertretend für ana-
loge Herausforderungen auch aus allen anderen Naturwissenschaften. Ob
man nun die spektralanalytischen Daten von Blütenfarbstoffen darzustel-
len hat oder solche einer neu entdeckten Galaxie, ist nach den Inhalten
zwar buchstäblich ein himmelweiter Unterschied, aber von der Vorge-
hensweise eben nicht. Von der Astrophysik bis zur Zahnmedizin spannt
sich zugegebenermaßen ein weiter Themenbogen. Die schriftlichen Kon-
densate ringen jedoch erfahrungsgemäß mit vergleichbaren Gestaltungs-
problemen.
VI Nur weniges vorweg
Eine hoffentlich nicht allzu enttäuschende Klarstellung ist vorauszuschi-
cken: Manche Rezensenten vermissten in den vorausgehenden Auflagen
dies, die anderen das. Ein 250-Seiten-Buch ist eben keine Enzyklopädie. Es
kann auch keine umfassende Einarbeitung in professionelle Layoutpro-
gramme wie InDesign oder QuarkExpress bieten und versteht sich auch
nicht als Ersatz für die Einführung in sämtliche Feinverzweigungen der
Textverarbeitung mit MS Word oder LATEX. Es ist eben wie in der Foto-
grafie: Annähernd 90% aller auftretenden Aufgaben oder Probleme lassen
sich mit einer brauchbaren Basisausstattung erledigen, während die restli-
chen 10% einen heftigen Spezialaufwand erfordern. Letzteren kann dieses
Buch nicht leisten. Die Grundrezepturen für den akademischen Schreibbe-
trieb können Sie auf den folgenden Seiten aber auf jeden Fall rasch ent-
nehmen und erfolgreich erlernen.
Außer unserer Tochter Melanie, die während der Reinschriftphase ihrer
Diplomarbeit täglich mehrfach an meinem Schreibtisch aufkreuzte, nach
Zitiertechniken oder Layout-Lösungen fragte und damit zur Auslöserin für
diese Werkstattanleitung wurde, danke ich vielen mittelbar Beteiligten für
Einschätzungen und Erfahrungen, Hinweise und Hilfen. Wertvolle Tipps
und Vorschläge steuerten Dr. Tamara Kleber-Janke (GKSS Geesthacht)
sowie wiederum Dr. Gerwin Kasperek (Senckenberg-Bibliothek Frankfurt)
bei. Frau Stefanie Wolf vom Springer-Verlag danke ich für die bewährte
und wiederum exzellente Betreuung des Projektes.
Köln/Wachtberg, im Mai 2009 Bruno P. Kremer
Inhaltsverzeichnis
1 Ermutigung: Keine Angst mehr vor dem leeren Blatt................... 1
2 Suchen, Finden, Anfreunden: Erstkontakte mit dem Thema....... 3
2.1 Check-in: Der erste Schritt ... führt in die Sprechstunde............... 3
2.2 Triebwerke zünden: Arbeitsplan und Zeitbudget.......................... 6
2.3 Take-off: Lesen, Sammeln und Verzetteln.................................... 8
2.3.1 Zettelwirtschaft................................................................... 10
2.3.2 Archivieren per PC............................................................. 12
2.3.3 Zwischen Inspiration und Transpiration............................. 13
2.3.4 Lesestrategien: Scanning und Skimming............................ 14
2.3.5 Daten speichern und sichern............................................... 15
2.4 Streckenflug: Schweigen verinselt, Reden ist Gold....................... 16
3 Auf gezielte Trüffelsuche: Bibliotheken und Datenbanken........... 19
3.1 Stöbern in Bibliotheken................................................................. 20
3.2 CD-ROM-Datenbanken................................................................. 23
3.3 Online-Recherche.......................................................................... 24
3.3.1 Suchmaschinen und Verzeichnisse..................................... 25
3.3.2 Virtuelle Bibliotheksbesuche.............................................. 30
3.3.3 Fachdatenbanken und Fachbibliografien ........................... 33
3.3.4 Akut oder latent? Warnung vor elektronischen Plagiaten... 37
3.4 Andere Informationsquellen.......................................................... 38
4 Der Teil und das Ganze – Textsorten und ihre Bausteine............. 39
4.1 Schreiben im Studium ... und danach............................................ 39
4.1.1 Die Form folgt der Funktion............................................... 41
4.1.2 Textumfänge....................................................................... 42
4.1.3 Themen durchgliedern........................................................ 44
4.2 Exkursionsbericht.......................................................................... 47
4.3 Versuchsprotokoll oder Laborbericht............................................ 48
4.4 Referat sowie Haus- bzw. Semesterarbeit..................................... 51
4.5 Bachelorarbeit................................................................................ 53
4.6 Master- und Promotionsarbeit....................................................... 60
VIII Inhaltsverzeichnis
5 Mit starken Worten: Texte stilvoll formulieren........................... 63
5.1 Sprachebene................................................................................. 64
5.2 „Denglisch“................................................................................. 64
5.3 Fremdwörter und Fachbegriffe.................................................... 66
5.4 Satzbau........................................................................................ 67
5.5 Darstellungsperspektive............................................................... 71
5.6 Tempus und Modus..................................................................... 72
5.7 Texte mit Leidensdruck: Das unselige Passiv............................. 73
5.8 Weitere Kandidaten für den Rotstift............................................ 75
6 Auf den Schultern der Riesen: Zitate und Zitieren...................... 83
6.1 Aufgaben des Zitierens................................................................ 83
6.2 Technik des Zitierens................................................................... 86
6.3 Zitate im Lauftext........................................................................ 87
6.3.1 Wörtliches Zitat ............................................................... 88
6.3.2 Indirektes Zitat.................................................................. 89
6.3.3 Andere Kurzbelegformen.................................................. 92
6.4 Quellenangaben im Literaturverzeichnis..................................... 94
6.4.1 Zitate aus Zeitschriften..................................................... 95
6.4.2 Zitate aus Büchern............................................................ 99
6.4.3 Zitate aus Sammelwerken................................................. 100
6.4.4 Zitate aus wissenschaftlichen
(unveröffentlichten) Arbeiten.............................................. 101
6.4.5 Zitate aus der „grauen Literatur“...................................... 102
6.4.6 Weitere Quellenangaben................................................... 102
6.4.7 Quellen aus dem Internet.................................................. 103
6.5 Sortierung im Literaturverzeichnis.............................................. 104
7 Ansehnliche Schaustücke: Fotos, Grafik und Tabellen............... 109
7.1 Mittel der Textveranschaulichung............................................... 109
7.2 Rechtliche Aspekte...................................................................... 110
7.3 Bildschön: Fotografische Dokumente......................................... 111
7.4 Topographische Karten................................................................ 114
7.5 Grafiken....................................................................................... 115
7.5.1 Zeichnungen...................................................................... 115
7.5.2 Strichzeichnungen von Hand............................................ 118
7.5.3 Strichzeichnungen per PC................................................. 121
7.5.4 Strukturformeln und Versuchsgeräte................................ 123
7.5.5 Diagramme........................................................................ 126
7.5.6 Tabellen............................................................................ 132
Inhaltsverzeichnis IX
8 Die Dinge beim Namen nennen: Größen und Bezeichnungen..... 137
8.1 SI-Einheiten................................................................................. 137
8.1.2 Teile und Vielfache von Einheiten.................................... 142
8.1.3 Besondere Schreibweisen................................................. 144
8.1.4 Mengenangaben in der Chemie......................................... 146
8.2 Ziffern und Zahlen....................................................................... 148
8.2.1 Zahlensysteme................................................................... 148
8.2.2 Ziffern im Lauftext........................................................... 150
8.3 Korrektes Benennen von Organismen......................................... 151
8.3.1 Beginn der wissenschaftlichen Nomenklatur.................... 152
8.3.2 Umgang mit wissenschaftlichen Artnamen...................... 154
9 Ansprechend verpacken: Das Thema Schrift............................... 159
9.1 Schnellkurs in Typographie......................................................... 161
9.2 Schriftart...................................................................................... 163
9.3 Schriftschnitt................................................................................ 165
9.4 Schriftgrad................................................................................... 166
9.5 Laufweite..................................................................................... 169
9.6 Zeilenabstand............................................................................... 170
10 Ansichtssachen: Layout und Seitengestaltung.............................. 175
10.1 Papierformat.............................................................................. 176
10.2 Papierqualität............................................................................. 177
10.3 Satzspiegel................................................................................. 178
10.4 Deck- oder Titelblatt.................................................................. 179
10.4.1 Schnellinformation über das Wesentliche....................... 180
10.4.2 Schriftgestaltung der Titelseite....................................... 183
10.4.3 Zeilenanordnung............................................................. 184
10.5 Inhaltsverzeichnis...................................................................... 185
10.5.1 Gliederungstechnik......................................................... 186
10.5.2 Schriftgestaltung im Inhaltsverzeichnis.......................... 189
10.6 Seitenlayout im Innenteil........................................................... 191
10.6.1 Zeilenlänge...................................................................... 191
10.6.2 Zeilenausrichtung............................................................ 192
10.6.3 Absatzgestaltung............................................................. 194
10.6.4 Bildmaterial..................................................................... 196
10.6.5 Bildnummern.................................................................. 197
10.6.6 Bildlegenden................................................................... 198
10.6.7 Tabellen........................................................................... 200
10.6.8 Andere Textelemente...................................................... 200
10.6.9 Literaturverzeichnis........................................................ 203
10.6.10 Fuß- und Endnoten........................................................ 203
X Inhaltsverzeichnis
10.7 Formatvorlage............................................................................ 205
10.8 Einband und Umschlag ............................................................. 206
10.9 Präsentationen............................................................................ 207
10.9.1 Overhead und Beamer..................................................... 207
10.9.2 Poster.............................................................................. 212
10.10 Zum Abhaken – Checkliste „Formale Gestaltung“................. 213
11 Nachschlagen im Notfall: Tipps fürs Tippen................................ 215
12 Zu guter Letzt.................................................................................. 243
Literaturverzeichnis............................................................................. 247
Register.................................................................................................. 253