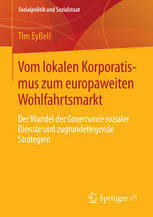Table Of ContentSozialpolitik und Sozialstaat
Herausgegeben von
A. Evers, Gießen, Deutschland
R. G. Heinze, Bochum, Deutschland
S. Leibfried, Bremen, Deutschland
L. Leisering, Bielefeld, Deutschland
T. Olk, Halle-Wittenberg, Deutschland
I. Ostner, Göttingen, Deutschland
Tim Eyßell
Vom lokalen Korporatis-
mus zum europaweiten
Wohlfahrtsmarkt
Der Wandel der Governance sozialer
Dienste und zugrundeliegende
Strategien
Tim Eyßell
Gießen, Deutschland
Gießener Dissertation im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Justus-
Liebig-Universität, 2014
Sozialpolitik und Sozialstaat
ISBN 978-3-658-08887-3 ISBN 978-3-658-08888-0 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-08888-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbi-
bliografi e; detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Die korporatistische Governance sozialer Dienste 17
2.1 Die historische Entwicklung des Verhältnisses von
öffentlichen und freien Trägern bei der Erbringung
sozialer Dienste 17
2.2 Der Korporatismus sozialer Dienste 28
2.3 Gründe für die Abkehr vom Korporatismus 32
3 Dimensionen des Strukturwandels der Governance
sozialer Dienste 37
3.1 Ökonomisierung: Neue Steuerungsmodelle und Ausweitung
des Trägerspektrums 38
3.2 Vermarktlichung: Wettbewerb um den Markt durch
Trägerauswahlverfahren? 44
4 Theorien 51
4.1 Kooperation verschiedener Akteure in unterschiedlichen
sozialen Settings 51
4.1.1 Governance 51
VI Inhaltsverzeichnis
4.1.2 Wohlfahrtspluralismus 63
4.1.3 Einbettung 68
4.2 Korporatismus versus Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnis 75
4.2.1 Korporatismus 75
4.2.2 Prinzipal-Agent-Theorie 79
4.2.3 Stewardship-Theorie 83
4.3 Verschiedene Handlungslogiken im Wohlfahrtspluralismus 87
4.3.1 Vermarktlichung 87
4.3.2 Zivilgesellschaft 91
4.3.3 Daseinsvorsorge 97
4.3.4 Gewährleistungsstaat 99
4.4 Kommunale Sozialpolitik im Mehrebenensystem 102
4.4.1 Europäisierung 102
4.4.2 Compliance 114
4.4.3 Institutioneller Isomorphismus 115
4.5 Relevante Erklärungsfaktoren staatlichen Handelns 120
4.5.1 Verwaltung 120
4.5.2 Legitimation durch Verfahren 125
4.5.3 Professionen 128
4.5.4 Demokratie 132
5 Methodik 135
5.1 Experteninterviews 135
5.2 Dokumentenanalyse 141
6 Europäisierung der Governance sozialer Dienste?
Handlungsspielräume kommunaler Sozialpolitik
im europäischen Binnenmarkt 145
6.1 Die Europäische Union und die Governance sozialer
Dienste 146
6.2 Die EU-Binnenmarktregulierung 147
Inhaltsverzeichnis VII
6.2.1 Der EU-Binnenmarkt und Dienste im allgemeinen
wirtschaftlichen Interesse 148
6.2.2 Das Binnenmarktrecht und soziale Dienste 152
6.2.3 Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des EU-
Wettbewerbsrechts 155
6.2.4 Das Beihilferecht der EU 158
6.2.5 Das Vergaberecht der EU 166
6.3 Die Governance sozialer Dienste in verschiedenen EU-
Mitgliedsländern 170
6.4 Die rechtliche Kontroverse über die Anwendbarkeit des
Vergaberechts im Rahmen des Sozialrechts 177
6.5 Der Spielraum der Kommunen 180
6.6 Der Forschungsstand zu möglichen Folgen der
EU-Politiken 182
7 Reaktionsweisen der Kommunen 189
7.1 Die kommunalen Reaktionen auf das EU-Beihilferecht 189
7.1.1 Traditionelle Zuwendungsfinanzierung 190
7.1.2 Zuwendungsverträge - mehr Planungssicherheit und
detailliertere Regelung 194
7.1.3 Rückstellungen – Anreiz oder Fehlsteuerung? 196
7.1.4 Alternative Finanzierungsformen sozialer Dienste 197
7.1.5 Wirkungen des EU-Beihilferechts auf die
Finanzierungsform sozialer Dienste 199
7.2 Die kommunalen Reaktionen auf das EU-Vergaberecht 202
7.2.1 Bilateraler Korporatismus 203
7.2.2 Multilateraler Korporatismus 207
7.2.3 Partizipativer Korporatismus 208
7.2.4 Interessenbekundungsverfahren – Zwischen Markt und
Korporatismus 209
7.2.5 Freestyle-Ausschreibungen 212
7.2.6 Vergaberechtliche Ausschreibungen 216
7.3 Zentrale Faktoren bei der Wahl des Trägerauswahl-
verfahrens 221
VIII Inhaltsverzeichnis
7.3.1 Externe Einflussfaktoren 221
7.3.2 Interne Einflussfaktoren 224
8 Fazit 241
9 Literaturverzeichnis 271
1 Einleitung
Steigender Bedarf an sozialen Diensten
Dem Wandel des Verhältnisses zwischen den Kommunen als Auftragge-
bern sozialer Dienste und den freien Trägern als Erbringern dieser Diens-
te liegen verschiedene Faktoren zugrunde. Neben veränderten wirt-
schaftspolitischen Ansichten spielen gesellschaftliche Entwicklungen eine
wesentliche Rolle. Sie spiegeln sich in gewandelten Bedarfen wider.
Während der letzten Jahrzehnte stieg die Nachfrage nach sozialen
Diensten deutlich und kontinuierlich an. Die zunehmende Erwerbsquote
von Frauen begründet ein Abnehmen sowohl der privaten Pflege von
älteren Angehörigen als auch der Betreuung der Kinder in der Familie
(Bäcker et al. 2008, S. 520f). Fortschreitend werden diese Aufgaben von
der privaten in die öffentliche Verantwortung verlagert. Darüber hinaus
verursachte die lange hohe Arbeitslosigkeit große Bedarfe an öffentlich
erbrachten sozialen Diensten. Aber auch in anderen Bereichen, wie in
der Jugendhilfe, insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung, wuchs die
Nachfrage in den letzten Jahren erheblich (Dahme 2011, S. 122). Die
größte, aktuell zu bewältigende Bedarfszunahme entstand durch die
Ausweitung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung auf die Ein-
bis Dreijährigen zum ersten August 2013 (Riedel 2009, S. 13; Kinderför-
derungsgesetz Art. 7; 8 und 10). Darüber hinaus wuchsen die Bedarfe
durch die Ausweitung der Ganztagsbetreuung von Kindern.
Parallel zur Veränderung und Ausweitung des Bedarfs an sozialen
Diensten wurden die tradierten korporatistischen Strukturen der Zusam-
T. Eyßell, Vom lokalen Korporatismus zum europaweiten Wohlfahrtsmarkt, Sozialpolitik und
Sozialstaat, DOI 10.1007/978-3-658-08888-0_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
2 Einleitung
menarbeit von Kommunen und freien Trägern mancherorts umorgani-
siert. Sie erschienen einigen kommunalen Akteuren nicht mehr geeignet,
um dem steigenden und veränderten Bedarf angemessen gerecht wer-
den zu können. So erforderte die Ausweitung des Angebots Anpassun-
gen der unterschiedlichen Formen und Arbeitsteilungen seiner Organisa-
tion, Finanzierung und Erbringung. Der massive Ausbau des Angebots in
der Kindertagesbetreuung setzte sogar vielfach die Gründung neuer Ein-
richtungen voraus. Wie in den meisten anderen Dienstleistungsbereichen
tragen die Kommunen hier die Verantwortung, kompetente Partner für die
Dienstleistungserbringung zu finden. Ihnen obliegt die Aufgabe, ein dafür
geeignetes Auswahlverfahren zu bestimmen. Viele Kommunen rückten
dabei von den traditionellen verhandlungsbasierten Verfahren ab und
nutzen neue Auswahlverfahren, die vielfach Wettbewerbselemente auf-
weisen. Die eigentliche Organisation und Gestaltung der Erbringung so-
zialer Dienste wird so primär in die Hände von freien Trägern gegeben. In
einigen Fällen übernehmen Kommunen auch selber die Trägerschaft von
Einrichtungen. Diesem Zusammenspiel von Kommunen und freien Trä-
gern liegt in Deutschland eine lange Tradition zugrunde.
Das zentrale Element des lokalen Miteinanders von Kommunen und
freien Trägern sind die Trägerauswahlverfahren. In ihnen spiegeln sich
die mitunter sehr unterschiedlichen Ausprägungen des lokalen Wohl-
fahrtspluralismus wider. Einige Kommunen werden von exklusiven Netz-
werken dominiert, in anderen Kommunen bestehen wettbewerbliche oder
auch partizipative Arrangements.
Bisher liegen keine systematischen Untersuchungen der Verfahren
zur Trägerauswahl vor. Weder die traditionellen korporatistischen noch
die wettbewerbsorientierten oder sonstige alternative Verfahren wurden
in ihren Eigenschaften und strategischen Hintergründen vertiefend analy-
siert. Diese Lücke wird mit der vorliegenden Arbeit geschlossen.