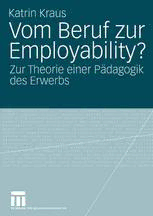Table Of ContentKatrin Kraus
Vom Beruf zur Employability?
Katrin Kraus
Vom Beruf zur
Employability?
Zur Theorie einer Pädagogik
des Erwerbs
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Die vorliegende Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich im Sommer-
semester 2005 auf Antrag von Prof.Dr.Philipp Gonon und Prof.Dr.Jürgen Oelkers als Dissertation
angenommen.
1.Auflage Januar 2006
unveränderter Nachdruck der 1.Auflage 2007
Alle Rechte vorbehalten
© VSVerlag für Sozialwissenschaften | GWVFachverlage GmbH,Wiesbaden 2006
Lektorat:Monika Mülhausen / Nadine Kinne
Der VS Verlag für Sozialwissenschaften ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media.
www.vs-verlag.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen,Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungen usw.in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung:KünkelLopka Medienentwicklung,Heidelberg
Korrektorat:Annette Kuppler
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN 3-531-14840-0
Inhalt
Vorwort.......................................................................................................................... 7
1 Einleitung .............................................................................................................. 9
2 Arbeit,Erwerb undPädagogik ........................................................................... 21
2.1 "Arbeit"alsKonzeptbegriff............................................................................ 22
2.2 DerBegriffdesErwerbs–theoretischeÜberlegungen
inAnschlussanMaxWeber........................................................................... 31
2.3 ZuRelevanzundEntwicklung vonArbeitsorganisation .................................. 37
2.4 Berufspädagogik,Arbeitspädagogik und"PädagogikdesErwerbs"................. 44
2.5 Pädagogik undErwerb:ZuProblematik undAktualität
despädagogischenBezugsaufdieAnforderungenderErwerbsarbeit.............. 49
2.6 Fazit:Arbeit,Erwerb undPädagogik.............................................................. 53
3 "Employability"–Ansatz,DiskursundKontexte ............................................. 55
3.1 ZurBestimmung vonEmployabilityimaktuellenDiskurs .............................. 56
3.2 DieaktuelleThematisierungvonEmployabilityundihreKontexte ................. 61
3.2.1 DergesellschaftlicheKontext.............................................................. 61
3.2.2 Dersozial-ökonomischeKontext......................................................... 75
3.2.3 Der(bildungs-)politischeKontext ....................................................... 91
3.2.4 Der(berufs-)pädagogischeKontext .................................................... 100
3.3 EmployabilityimangelsächsischenKontext.................................................. 114
3.4 Work-Life-BalancealsErgänzungsdiskurs .................................................... 121
3.5 ZusammenfassungundFazit:Employability–einaktuellerDiskurs .............. 134
4 DasBerufskonzept–Entwicklung,Kritik,StandundPerspektiven ................ 143
4.1 ZurhistorischenRekonstruktiondesBerufskonzepts ..................................... 143
4.2 DieDiskussionumdie'KrisedesBerufs' ...................................................... 149
4.3 DasBerufskonzeptinseineraktuellenFassung.............................................. 154
4.3.1 Zum Vorgehen bei der Bestimmung der aktuellen Fassung
desBerufskonzepts ............................................................................ 155
4.3.2 Begriffsbestimmungen,DefinitionenundAspektedesBerufs ............. 158
4.3.3 Eckpunktedes'deutschen Berufskonzepts' amÜbergangvom
20.zum21.Jahrhundert–eineBilanzierung ...................................... 174
4.3.4 FazitzumaktuellenBerufskonzept..................................................... 186
4.4 "Beruflichkeit" als potenzialorientierter Transformationsbegriff –
eineneuePerspektiveimBerufsdiskurs......................................................... 188
4.5 FazitzumBerufskonzept:AktuellerStandeinestraditionellenKonzepts ....... 199
5
5 DerAnsatzdesErwerbsschemas ....................................................................... 203
5.1 DieGrundlagendesErwerbsschemas ............................................................ 205
5.2 DieDimensionen desErwerbsschemas.......................................................... 211
5.3 ZurDimensionderErwerbsorientierung........................................................ 220
5.3.1 Erwerb,OrientierungundPädagogik.................................................. 221
5.3.2 ErwerbsorientierungundArbeitskraft................................................. 224
5.3.3 ErwerbsorientierungundLebensführung ............................................ 231
5.3.4 ErwerbsorientierungundNorm .......................................................... 235
5.3.5 Erwerbsorientierungund(Arbeits-)Tugend ........................................ 242
5.4 Exkurs:Pädagogik derIndustrialisierung undTaylors
"Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung" als pädagogisches
Programm..................................................................................................... 251
5.5 Fazit:ErwerbsschemaalsdreidimensionalerAnsatz ...................................... 258
6 Schlussfolgerungen–"VomBerufzurEmployability?" .................................. 263
Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 275
Danksagung................................................................................................................. 299
ZurAutorin .................................................................................................................301
6
Vorwort
DieFrage,inwiefernErziehungaufdieArbeitsweltvorbereitetundvorbereitensoll,isteine
dieseitderfrühenIndustrialisierung diskutiertwird.DennimUnterschiedzurtraditionellen
Ökonomiedes Hauses, dieaufReproduktion der ArbeitskraftundNachwuchsrekrutierung
durch eng begrenztes familiäresZur-Verfügung-Stellen von Ressourcen setzte, begibtsich
seit dem industrialisierten 19. Jahrhundert dieMehrzahl junger Menschen in organisierte
Bildungsprozesseund anschließend aufden Arbeitsmarkt, wosieihreFähigkeiten feilbie-
tenmüssen.
Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts hat sich ein System etabliert, das in der Form des
Berufs und der beruflichen Bildung eine breite Akzeptanz gewann. Denn der Beruf als
Ausbildungsberuf sicherte nicht nur die Allokation in der Arbeitswelt, sondern war auch
Garant dafür, dass Qualifikationen in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. Als
solide Qualifikationsbasis, die darüber hinaus ein gewisses Maß an allgemeiner Bildung
vermittelt, sollteder BerufeinerseitsgesellschaftlicheIntegrationgewährleistenundande-
rerseitsdieindividuelleLernbereitschaftundFlexibilitäterhöhen.
Die aktuelle Kritik am Beruf nimmt Katrin Kraus zum Ausgangspunkt, nochmals
grundlegend dasVerhältniszwischenBildung undArbeitsweltzuthematisieren.Indemsie
hier aufein KonzeptdesErwerbsBezugnimmt, öffnetsieden Blick dafür, dassder Beruf
als Bildungsweg nur eine Möglichkeit ist, sich auf Arbeit einzulassen, obwohl sich die
Berufsförmigkeit der Arbeit und darauf fokussierter Bildungsmaßnahmen im deutschen
Kontext insoweit verfestigt hat, dass Alternativen diesbezüglich kaum mehr in den Blick
gerieten.
Employabilityistnun ein neuesHoffnungswort,das sichzunächst im politischenDis-
kurs etablierte und inzwischen auch die Pädagogik als Disziplin erreicht hat. Durch Be-
schäftigungsfähigkeitalsZielsetzungwird dersichstarkwandelndenArbeitsweltscheinbar
besserRechnung getragen.KatrinKrauszeigtallerdings,dassderAnsatz,"Beschäftigungs-
fähigkeit" auch als Haltung zur Arbeit zu bestimmen, keineswegs mit der internationalen
Rhetorik um Employability ihren Anfang nahm, sondern bereits als "Industriosität" im
Rahmen der Frühindustrialisierung bedeutsam ist, ebensowiein Taylors Vorschlägen zur
wissenschaftlichenBetriebsführung.DieindieserArbeitentwickeltePerspektivekannman
auch aufeineAuseinandersetzungmitanderenAutorenbeziehen,diesichmitderQualifi-
zierungfürdieArbeitbeschäftigthaben.BeispielsweiseaufPestalozzi,derhierdenBegriff
der "Gewerbsamkeit"benutzte, oder aber aufdievon der Autorin erörterteSichtMaxWe-
bers aufBerufund Erwerb, der nüchtern aufdieAufdauerstellung von Erwerbsarbeit ver-
wies.
Diehier vorgelegteAnalysezum Verhältnis von BerufundEmployabilityzeigtnicht
zuletzt, dassdiejenigen, diemitEmployabilitydieradikaleUmkehr und dasEndedesBil-
dungs- und Berufsprinzips verkündeten, zu voreilig sind, denn auch das Berufskonzept
kann sich aufneueFormen desZugangszur Arbeitswelteinlassen. Erneutstelltsich auch
beiderGegenüberstellungvonBerufundEmployabilitydieFrage,inwiefernAnsprüchean
Bildungin neuenKonzeptionenaufgehobenbleiben.
PhilippGonon
7
1 Einleitung
Seit mehreren Jahren wird eine intensive Debatte über einen grundlegenden Wandel der
Erwerbsarbeitgeführt.Dabeigehtesauchdarum,inwelcherFormdieindividuelleBefähi-
gungfürErwerbstätigkeitgesellschaftlichwiepädagogischsinnvollgestaltetwerdenkann.
Die Frage, ob damit ein Übergang vom "Beruf" zur "Employability" eingeläutet ist, spitzt
dieaktuelleAuseinandersetzunginpointierterWeisezu.
Der "Beruf", im deutschen Kontext das traditionelleKonzept der Befähigung für Er-
werbsarbeit, wird im Zuge dieser Diskussionen zu einem Kristallisationspunkt der Ausei-
nandersetzung umneueAnforderungeninderErwerbsarbeit.Diearbeitsmarkt-,sozial- und
bildungspolitischenReformdiskussionenderletztenJahregehen häufigvoneinerdezidier-
ten KritikamBerufskonzeptaus, während gleichzeitig dasSchlagwort"Employability"an
Präsenz gewinnt. DieaktuelleDiskussion umden "Wandelder Arbeit"und den Übergang
zur"post-industriellenArbeitsgesellschaft"unterzieht mit dem"Beruf"nichtnurdastradi-
tionelle Konzept einer kritischen Bewertung, sondern versucht auch einebegrifflicheund
konzeptionelleNeubestimmungvorzunehmen."Employability"erscheinthieralseinemög-
licheAlternative.MitdiesemSchlagwortwerdenoffensichtlich neueAnforderungenandie
IndividuenzumAusdruck gebracht,dievomBerufskonzept–sodieProblemwahrnehmung
–nichtabgedecktwerdenkönnen.
Das Berufskonzept verbindet in Deutschland traditionellerweise Pädagogik und Ar-
beitswelt.1Von Kurtz wird der Beruf daher auch als die der Pädagogik zugewandte Seite
der Arbeit bezeichnet (vgl. Kurtz 2002). Aus pädagogischer Perspektive stellt er analog
dazu die der Arbeit zugewandte Seite der Pädagogik dar. Bezogen auf den Bereich der
AusbildungisteralsErgebnisvonAushandlungsprozesseninBerufsbildernfestgelegtund
institutionalisiert, der "Beruf" stellt somit eine 'öffentliche Fassung' von Arbeitskraft dar
(vgl.Gonon1999:7,Harney1998 und 2004:154ff.).DasBerufskonzeptfungiertaberüber
seineFunktion für dieAusbildunghinausauch als"Inputder Weiterbildung"(Harneyu.a.
1999) und biografisches Strukturmoment (vgl. Hillmert/Mayer 2004). Die Praxis berufli-
cherBildungistvorallemdaranausgerichtet,dassdieAbsolvent/innenspätereinequalifi-
zierteErwerbstätigkeit ausüben können. Siesollen befähigt werden, einer beruflichenAr-
beitnachzugehen. Der "Beruf"istdamitstruktureller AusgangspunktundZielder Berufs-
bildung.ErstellteinequalifizierteFormderVoraussetzungenfürErwerbsarbeitdar,dieauf
einer allgemein festgelegten und gesetzlich geregelten Grundlage mit einem spezifischen
Anforderungsprofilbasiert.Als solchehatereineorientierendeFunktionfürdieIndividuen
und dieBerufsbildung,diesich–theoretischund praktisch– primäram"Beruf"als spezifi-
scherFormvonArbeitskraftausrichtet.
1 Aus diesem Grund wird im Folgenden nicht immer eigens darauf hingewiesen, dass sich das Berufskonzept
auf den deutschen Kontext bezieht. Der "Beruf" ist so eng mit den historischen Entwicklungen und aktuellen
Strukturen in Deutschland verbunden, dass der Begriff seine spezifische Bedeutung gerade aus diesem Kon-
text heraus gewinnt und ihn insofern implizit mit anspricht, ohne dass dies jeweils explizit betont werden
muss.
9
Trotz dieser vielfältigen Verankerungen ist der "Beruf" nicht nur in der politischen,
sondern geradeauch in der wissenschaftlichen Debatteverstärkt in dieKritik geraten,den
aktuellen ökonomischen wiegesellschaftlichenAnforderungen nicht mehrzuentsprechen.
In diesem Kontext werden dieveränderten individuellen Voraussetzungen von Erwerbstä-
tigkeitverstärkt mit demBegriffder"Employability"neuzusammengefasst.DerEmploya-
bility-BegriffstammtursprünglichausdemangelsächsischenKontext.ImZugeglobalisier-
terWirtschaftsstrukturenundeinerinternationalisiertenBildungs- undBeschäftigungspoli-
tik ist er mittlerweile auch im deutschen Kontext präsent, wobei der englische Ausdruck
häufiger verwendet wird als die deutsche Übersetzung "Beschäftigungsfähigkeit". "Em-
ployability" bzw. "Beschäftigungsfähigkeit" ist jedoch nicht nur im politischen Kontext
etabliert. Der Begriffhat in der Personalentwicklungs-(vgl. Sattelberger1999,Lombriser/
Uepping 2001 oder Speck 2004) und Arbeitsmarktdiskussion (vgl. Bosch 2002, Blancke
u.a.2000)ebenfallsFuß gefasstundstößtauchinderPädagogikzunehmendaufResonanz
(vgl.Hendrich2004,Kraus2004a,Lutz2003,Nuissl2003,Wittwer2001).
Eine besondere Brisanz gewinnt der Diskurs um "Employability" für die Pädagogik
geradedadurch, dasser in einemBereich ansetzt, der durch den"Beruf"miteinemklassi-
schen,pädagogischen(Bildungs-)Begriffbelegt ist.VordiesemHintergrundstelltderaktu-
elleEmployability-DiskursnichtnureineHerausforderungfürdasBerufskonzeptdar,son-
dernauchfüreinePädagogik,diesichinDeutschlandseitdem19.Jahrhunderthauptsäch-
lich über dasBerufskonzeptaufdieArbeitsweltbezieht. Denn angesichtsdesWandelsder
Gesellschaftzueiner"post-industriellen"Arbeits- undGesellschaftsordnungistdasBerufs-
konzepteinerwachsendenKritik undDefizitzuschreibungausgesetzt.
ZumAnliegen desBuches
DasSpannungsverhältniszwischen"Beruf"und"Employability"istderaktuelleAusgangs-
punkt für eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wie Pädagogik und Er-
werbsarbeitkonzeptionell miteinanderverbundensind."Beruf"und"Employability"haben
sich alsverbindendeKonzeptejeweilsinunterschiedlichen historischenundgesellschaftli-
chen Kontexten entwickelt;"Beruf"ist im deutschen und"Employability"ursprünglichim
angelsächsischenKontextverankert.Der"Beruf"alstraditionellesKonzeptanderSchnitt-
stellevonPädagogik undErwerbsarbeit istdeutlichausformuliert,währendimnochrelativ
neuen deutschsprachigen Diskursüber EmployabilitydiesesKonzeptgerade erstKonturen
gewinnt.Wie"Employability"imdeutschenKontextbisherinhaltlichbestimmtwird,istfür
eine Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen den Begriffen ebenso von Be-
deutung wie die Frage, in welcher Form das vermeintlich (allzu) bekannteBerufskonzept
dem aktuellen berufspädagogischen Diskurszugrundegelegtund konzeptionellentwickelt
wird.
Der deutsche Employability-Diskurs ist vor dem Hintergrund der Debatten um die
"Krisedes Berufs" und den "Wandel der Arbeit" zu sehen, dieauch eineNeubestimmung
des Verhältnisses von Pädagogik und Erwerbsarbeit intendieren. Daher beinhaltet eine
Beschäftigungmitden beiden Konzepten "Beruf"und"Employability"nichtnureineVer-
gewisserung überden'aktuellenStand'destraditionellenBerufskonzepts,sondernauchdie
Frage nach der spezifischen Adaptation des 'internationalen Begriffs' "Employability" im
deutschen Kontext. EsgehtdabeinichtumdieFrage,ob"Beruf"oder"Employability"das
10
'bessere Konzept' ist, sondern darum, das Verhältnis beider innerhalb des aktuellen Kon-
textszu untersuchen, in demsieaufeinandertreffen.Damit istzunächstdasrekonstruktiv-
analytischeAnliegen desBuchesbeschrieben.ÜberdieAuseinandersetzungmitkonkreten
Konzepten hinaus verfolgt es aber auch ein theoretisches Anliegen: Es geht darum, im
Rahmeneiner"Pädagogik desErwerbs",einenAnsatz zuentwickeln,wiemandasVerhält-
nis von individuellen Voraussetzungen und Anforderungen der Erwerbsarbeit, dasjeweils
in historisch und kontextuellgeprägten Konzepten gefasst ist,auseinererziehungswissen-
schaftlichenPerspektiveheraustheoretischbestimmenkann.AufdieserGrundlagekönnen
dannKonzeptewie"Beruf"und"Employability"theoriegeleitetbeschriebenundverglichen
werden. Bei der Entwicklung diesesAnsatzeswirdvon folgendemZusammenhangausge-
gangen:DieTheoriebildung und diepädagogischePraxiseiner"erwerbsorientiertenPäda-
gogik" beziehen sich aufein spezifisches "Erwerbsschema", in dem dieindividuellen An-
forderungen für eine Erwerbstätigkeit konkret konzeptionalisiert sind. Das "Erwerbssche-
ma" bündelt jeweils relativstabil diewechselseitigen Erwartungen undAnforderungen an
dieindividuellenVoraussetzungenfüreineErwerbstätigkeit.EsumfasstdreiDimensionen:
Fachlichkeit, überfachliche Kompetenzen und Erwerbsorientierung, die je nach Kontext
unterschiedlich ausformuliert sind. Der "Beruf", d.h. das im deutschen Kontext herausge-
bildeteund verankerte"Erwerbsschema", stellt in dieser Perspektivelediglich einemögli-
che Form dar, das "Erwerbsschema" konkret auszugestalten. Abhängig vom historischen,
ökonomischen und kulturellen Kontext kann das "Erwerbsschema" jedoch auch andere
Formen annehmen. Als theoretischer Ansatz versucht die"Pädagogik desErwerbs"damit
allgemeiner alsdieBerufspädagogik dieGrundlagen einer OrientierungvonPädagogikan
der Erwerbsarbeit und ihren Anforderungen zu bestimmen. Sienimmt das Berufskonzept
damit alseinemöglicheAusprägungin den Blick, deren Entstehung, Bedeutung undEnt-
wicklungmaßgeblich von den historischen und gesellschaftlichen Kontextenabhängt.Der
Ansatzder"Pädagogik desErwerbs"bietetsoeinenRahmen,umKonzepteanderSchnitt-
stellevonPädagogik undErwerbsarbeitzuanalysierenundzuvergleichen.Dieswirdinder
ArbeitexemplarischmitdemBerufskonzeptund demEmployability-Diskursdurchgeführt.
DiekonkretenZiele dervorliegendenUntersuchunglassensichdamitfolgendermaßen
benennen:
den aktuellenDiskursum"Employability"inDeutschlandrekonstruieren.Diespezifi-
scheAdaptationvon"Employability"wird durcheineAuseinandersetzungmitdem in-
ternationalenHintergrund diesesKonzeptsund denkonkretenBedingungenseinerzu-
nehmenden Präsenz im deutschen Diskurs analysiert. Der Wegführthierbeiüber die
AnalysederverschiedenenDefinitionen,die"Employability"zugrundegelegtwerden.
Darüber hinaus erfolgt eineEinordnung in dierelevanten Kontexte(gesellschaftlich,
politisch,ökonomischund pädagogisch),durchderenje eigeneDynamiksichderBeg-
riffindenletztenJahrenetablierthat.
das Berufskonzept ausgehend von seiner historischen Entwicklung systematisch in
seiner aktuellen Fassung und konzeptionellen Weiterentwicklung (Beruflichkeit)her-
ausarbeiten. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund der Kontroverse um
die 'Krise des Berufs', die sowohl eine Kritik am Berufskonzept ausdrückt wie auch
dieSuchenachAlternativenwie"Employability"forciert.
den Ansatz des "Erwerbsschemas" als Kern einer "Pädagogik des Erwerbs" entwi-
ckeln.HierzuwerdendieverschiedenenDimensionendesgemeinsamenBezugspunkts
11