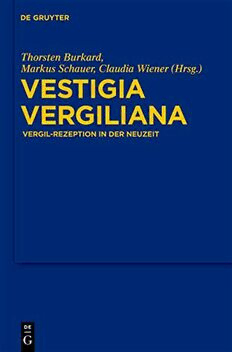Table Of ContentVestigia Vergiliana
Göttinger Forum
für Altertumswissenschaft
Beihefte
Herausgegeben von
Bruno Bleckmann, Thorsten Burkard,
Gerrit Kloss, Jan Radicke
Neue Folge
Band 3
De Gruyter
Vestigia Vergiliana
Vergil-Rezeption in der Neuzeit
Herausgegeben von
Thorsten Burkard, Markus Schauer,
Claudia Wiener
unter Mitarbeit von Eltje Böttcher
De Gruyter
ISBN 978-3-11-024720-6
e-ISBN 978-3-11-024721-3
ISSN 1866-7651
BibliografischeInformationderDeutschenNationalbibliothek
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschen
Nationalbibliografie;detailliertebibliografischeDatensindimInternet
überhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
(cid:2)2010WalterdeGruyterGmbH&Co.KG,Berlin/NewYork
Druck:Hubert&Co.GmbH&Co.KG,Göttingen
(cid:2)GedrucktaufsäurefreiemPapier
PrintedinGermany
www.degruyter.com
Vorwort
Die Erforschung der Rezeptionsgeschichte der Antike war und ist ein
zentrales Anliegen des Münchner Latinisten Werner Suerbaum. Davon
zeugen nicht nur die beiden vielen in Erinnerung gebliebenen Ausstellun-
gen zu Horaz und Vergil in den neunziger Jahren,1 sondern gerade auch
seine jüngsten Arbeiten zur Vergilrezeption, etwa das im Jahr 2008 er-
schienene, knapp siebenhundert Seiten zählende Handbuch der illustrierten
Vergil-Ausgaben.2
Daher scheint es so naheliegend wie angemessen, Werner Suerbaum
diesmal mit einer Festschrift zu ehren, die sich auf die Suche nach antiken
und insbesondere vergilianischen Spuren in der Literatur der Neuzeit
begibt. Neunzehn Autorinnen und Autoren, Schüler, Kollegen, Freunde,
Verehrer und Weggefährten von Werner Suerbaum, haben sich für ihn auf
Spurensuche begeben und dabei mehr als ein halbes Jahrtausend durch-
wandert. Diese Spurensuche hat eine eindrucksvolle Fülle und oft überra-
schende Vielfalt von vestigia Vergiliana nicht nur in der neulateinischen,
sondern in der neuzeitlichen Literatur überhaupt zutage gefördert, die das
breite Spektrum der Vergilrezeption bis in die Gegenwart hinein illustrie-
ren.
Das Wort vestigium hat mehrere Bedeutungen, so bezeichnet es vor al-
lem die Fußspur, die jemand hinterlassen hat und der man folgen kann, in
übertragener Bedeutung auch die Spur im Sinne eines Kennzeichens oder
eines Merkmals. Beide Nuancen spielen in der Rezeptionsgeschichte
Vergils eine Rolle: Vergil hat unübersehbare Spuren hinterlassen, auf die
kaum einer der späteren Dichter stoßen konnte, ohne die Verlockung zu
verspüren, diesen Spuren zu folgen. Dabei versuchten die einen, in seine
Fußstapfen zu treten, womöglich sogar, ihn einzuholen und seine Rich-
––––––––––––
1 Vgl. die insgesamt neun Beihefte zu den beiden Münchener Ausstellungen: Ho-
raz. Disiecti membra poetae, München 1993; Vergil visuell, München 1998.
2 Handbuch der illustrierten Vergil-Ausgaben 1502-1840. Geschichte, Typologie,
Zyklen und kommentierter Katalog der Holzschnitte und Kupferstiche zur
Aeneis in Alten Drucken. Mit besonderer Berücksichtigung der Bestände der
Bayerischen Staatsbibliothek München und ihrer Digitalisate von Bildern zu
Werken des P. Vergilius Maro sowie mit Beilage von 2 DVDs, Hildesheim u.a.
2008, 684 S. (Bibliographien zur Klassischen Philologie 3).
VI Vorwort
tung zu korrigieren, andere wiederum nahmen zwar Maß an seiner Spur,
gingen aber eigene und neue Wege, im Schritt weit ausholend wie einst ihr
großes (und unerreichbares?) Vorbild. Ob die Dichter nun Vergils Spuren
folgten oder eigene Spuren hinterließen, an ihren Werken ging die Be-
schäftigung mit Vergil nicht spurlos vorüber, sie sind von ihr gezeichnet
und tragen daher vestigia Vergiliana an ihrem ‘Leib’.
Wenn nun die Beiträger der vorliegenden Festschrift den vestigia
Vergiliana in der neuzeitlichen Literatur nachspüren wollten, so wandelten
sie in gewisser Weise ebenfalls auf Vergils Spuren. Wie jedoch die Dichter
nicht an Vergil vorbeigehen können, so die Vergilforscher nicht an Wer-
ner Suerbaum, der mit seinen Arbeiten zu Vergil und seiner Rezeption
Wege bereitet und Maßstäbe gesetzt hat. Wegen dieser vielfältigen Bedeu-
tungsnuancen haben wir uns für den Titel Vestigia Vergiliana entschieden.
Die Beiträge der Festschrift sind grundsätzlich chronologisch nach den
Geburtsdaten der behandelten Autoren geordnet. Der erste Aufsatz von
Mario Geymonat widmet sich zwar nicht der neuzeitlichen
Vergilrezeption, stellt aber einen wunderbar bukolisch-georgischen Ein-
stieg dar und eröffnet vielleicht nicht nur dem Vergil-Kenner, sondern
auch dem Weinliebhaber neue Aspekte. Mehrere Beiträge behandeln den
vergilischen Einfluss in der neulateinischen Literatur, und zwar im Epos
(Nikolaus Thurn, Thorsten Burkard, Gerhard Binder, Reinhold Glei,
Markus Schauer), in der Bukolik (Alexander Cyron, Lothar Mundt, Eckard
Lefèvre), in der Lyrik (Claudia Wiener, Eckard Lefèvre), in anderen Dich-
tungsarten (Eckard Lefèvre) sowie in poetologischen Texten (Thorsten
Burkard, Eckard Lefèvre). In anderen Aufsätzen steht Vergils Nachleben
in der volkssprachlichen Literatur vom 16. Jahrhundert bis in die heutige
Zeit im Mittelpunkt, so die Rezeption in Frankreich (Gerhard Binder,
Maria Mateo Decabo, Rudolf Rieks), in Deutschland (Hans Jürgen
Tschiedel, Andreas Patzer), in der DDR (Gerhard Binder), im englischen
Sprachraum (Silke Anzinger, Siegmar Döpp, Frank Wittchow), in Polen
(Gerhard Binder) und in Portugal (Stefan Feddern). Renate Piecha unter-
suchte anhand von Zeitungen, welche vergilischen Spurenelemente sich in
der Allgemeinbildung unserer nicht klassisch-philologisch gebildeten Zeit-
genossen noch nachweisen lassen.
Somit spannt sich ein weiter, durchgehender Bogen vom 15. bis zum
20. Jahrhundert. Bei diesem iter Vergilianum wird der Leser nicht nur auf
eher unbekannte Autoren treffen, sondern auch vielen großen Namen
begegnen: Iacopo Sannazaro, Konrad Celtis, Marco Girolamo Vida, Pierre
de Ronsard, Luís de Camôes, Jacob Balde, Simon Dach, Voltaire, Charlot-
te von Stein, Thomas Mann, John R.R. Tolkien, Heiner Müller und
Cormac McCarthy.
Vorwort VII
Den Band beschließt ein aktuelles Publikationsverzeichnis des Jubilars,
das an die entsprechende Bibliographie in seinen Kleinen Schriften von 1993
nahtlos anschließt.3 Auch in der Zeit des Internets sollten die clarorum
virorum scripta auch in der würdigeren Papierform zugänglich sein – und
seien es auch nur die Titel.
Unser Dank gilt vor allem den Beiträgern, die dankenswerterweise bereit
waren, sich unserer Themenstellung zu fügen, und die mit ihren instrukti-
ven Arbeiten ein faszinierendes Panoptikum der Vergil-Rezeption ermög-
licht haben. Wir Herausgeber stehen auch deswegen bei allen Autoren in
tiefer Schuld, weil wir aus verschiedenen Gründen den ursprünglich ge-
planten Erscheinungstermin nicht einhalten konnten. Für diese bienniale
Verzögerung bitten wir natürlich nicht nur sie, sondern vor allem den
Jubilar um Entschuldigung. Aber vielleicht reift ja eine Festschrift wie ein
guter Wein immer besser heran.
Zu Dank verpflichtet sind wir des Weiteren dem De Gruyter Verlag,
hier vor allem unserer Lektorin, Frau Dr. Sabine Vogt (Lektorat Alter-
tumswissenschaft), und Herrn Florian Ruppenstein (Herstellung) für ihre
geduldige und kompetente Begleitung.
Wie immer so galt auch hier, dass Professoren ohne ihre treuen und
zuverlässigen Mitarbeiter verloren sind, unser fidus et fortis Achates war die
Kieler Hilfskraft Frau Eltje Böttcher, die uns mit Scharfsinn, Sorgfalt und
großem Engagement bei der Gesamtredaktion dieser Festschrift zur Seite
stand.
Dank schulden wir auch der Bamberger Hilfskraft Frau Isabelle
Feuerhelm für Korrektur und das Erstellen des Stellenregisters.
Nec Phoebo gratior ulla est quam sibi quae vestri praescripsit pagina nomen (mit
einem inhaltlich und metrisch notwendigen Pluralis maiestatis): Wir über-
reichen Ihnen, lieber Herr Suerbaum, diese Festschrift in der Hoffnung,
dass diese Beiträge vielleicht sogar Ihrer Gelehrsamkeit die eine oder an-
dere neue Facette an Vergil und seiner Rezeption aufweisen können – also
eben Vestigia Vergiliana.
Thorsten Burkard (Kiel)
Markus Schauer (Bamberg)
Claudia Wiener (München)
––––––––––––
3 In Klios und Kalliopes Diensten. Kleine Schriften von Werner Suerbaum, hrsg.
von Christoph Leidl und Siegmar Döpp, Bamberg 1993, S. 458-464.
Inhalt
MARIO GEYMONAT
Tiroler Wein an der Tafel von Vergil und Augustus ........................... 1
NIKOLAUS THURN
Heros Aeneas und Iuno, die Hera. Der Wandel des
Heldenbegriffes von der Antike zur Neuzeit ....................................... 9
THORSTEN BURKARD
Kannte der Humanismus „den anderen Vergil“? Zur two voices-
Theorie in der lateinischen Literatur der frühen Neuzeit ................. 31
GERHARD BINDER
Goldene Zeiten: Immer wieder wird ein Messias geboren…
Beispiele neuzeitlicher Aneignung der 4. Ekloge Vergils ................. 51
CLAUDIA WIENER
Die Aeneas-Rolle des elegischen Helden. Epische Inszenierung
und dichterisches Selbstverständnis in Celtis’ Amores ....................... 73
REINHOLD F. GLEI
Das leere Grab und die Macht der Bilder. Vergilrezeption in
der Christias des Marco Girolamo Vida ............................................. 107
STEFAN FEDDERN
Die Rezeption der vergilischen Seesturmschilderung
(Aen. 1,34-156) in Camões’ Epos Os Lusíadas (6,6-91) ................... 121
ALEXANDER CYRON
Melchior Barlaeus, 5. Ekloge Pharmaceutria.
Text – Übersetzung – antike Vorbilder. ............................................ 147
MARIA MATEO DECABO
Hardys Didon se sacrifiant. Ein ‘Kommentar’ zum vierten Buch
der Aeneis? .............................................................................................. 169
X Inhalt
ECKARD LEFÈVRE
Jakob Balde und der Rex Poetarum Vergil – von der Pudicitia
vindicata zur Expeditio Polemico-Poëtica. Ein Überblick. ...................... 187
LOTHAR MUNDT
Simon Dach als neulateinischer Bukoliker. Seine Eklogen
zum Weihnachts- und Osterfest (1651/1652) .................................. 211
MARKUS SCHAUER
Vulcanus und Constantia als Waffenschmiede – die Schild-
beschreibungen in Vergils Aeneis und Ubertino Carraras
Columbus .................................................................................................. 251
RUDOLF RIEKS
Zu Voltaires Vergilrezeption in der Henriade .................................... 269
HANS JÜRGEN TSCHIEDEL
Die Dido der Charlotte von Stein ....................................................... 299
ANDREAS PATZER
Ah Virgil, Virgil! – der Speichellecker des julischen Hauses.
Die literarische Bedeutung des Lateinischen in Thomas
Manns Zauberberg ................................................................................... 315
RENATE PIECHA
Wo Britting irrte, oder: Wie die Presse Vergil am Verstummen
hindert .................................................................................................... 349
SILKE ANZINGER
Von Troja nach Gondor. Tolkiens „The Lord of the Rings“
als Epos in vergilischer Tradition ....................................................... 363
SIEGMAR DÖPP
Te, Palinure, petens. Vergilrezeption in Palinurus’ The Unquiet
Grave ........................................................................................................ 403
FRANK WITTCHOW
Aeneas ohne Sendung? Cormac McCarthys The Road..................... 443
Werner Suerbaum: Publikationen 1993-2009 ................................... 455
Namenregister ....................................................................................... 465
Stellenregister ........................................................................................ 472