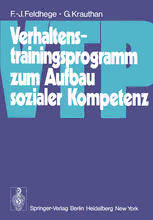Table Of ContentF.-J. Feldhege G. Krauthan
Verhaltens
trainingsprogramm
zum Aufbau
sozialer Kompetenz
(VTP)
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg NewYork 1979
Dr. Franz-losef Feldhege
Max-Planck-Institut für Psychiatrie
Parzivalstraße 25
8000 München 40
Dipl.-Psych. Günter Krauthan
Max-Planck-Institut für Psychiatrie
Parzivalstraße 25
8000 München 40
Das Kapitel V dieses Buches ist gesondert lieferbar unter dem Titel:
F.-J. Feldhege, G. Krauthan: Übungsheft für Klienten. Arbeitsunterlagen zum
Verhaltenstrainingsprogramm zum Aufbau sozialer Kompetenz (VTP).
ISBN-13:978-3-540-09059-5
ISBN -13:978-3-540-09059-5 e-ISBN -13 :978-3-642-67104-3
001: 10.1007/978-3-642-67104-3
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek. Feldhege, Franz-Josej' Verhaltenstrainingsprogramm
zum Aufbau sozialer Kompetenz (VTP)/Franz-Josef Feldhege; Günter Krauthan.-
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1979.
NE: Krauthan, Günter:
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeicbnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne be
sondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Marken
schutzgesetzgehung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Das Werk ist urheherrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem
oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser
Verwertung, vorbehalten. Bei Vervielfältigungen rur gewerbliche Zwecke ist gemäß § 54 UrhG eine Vergütung
an den Verlag zu zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.
© by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1979
2126/3140-543210
Geleitwort
Das Training von Verhaltensweisen hat bereits eine lange Tradition und man
bräuchte ein umfassendes Glossar als Wegweiser, um sich unter den
zahlreichen Angeboten zurechtzufinden. Man hat sich daran gewöhnt, daß
die steigende Anzahl von Trainingsmanualen auf spekulativen Ideen, um
nicht zu sagen Theorien, aufgebaut ist, so daß die Rückführung der
praktischen Trainingsschritte auf die theoretische Begründung an einem
Punkt endet, wo man zu glauben hat ohne weiter zu fragen. Andererseits ist es
zur Gewohnheit geworden, Trainingsprogramme ohne nachweisbare empiri
sche Grundlage anzubieten. Bestenfalls werden die Trainierten befragt, ob
ihnen das Training gefallen oder gut getan habe.
Es fehlt an brauchbaren Kriterien und langfristiger Nachkontrolle zur
Bewertung der Trainingseffektivität. Die Anforderung, daß Trainingspro
gramme aus der experimentellen Praxis entstehen sollten, wird heute nur sehr
selten erfüllt.
Das Programm von Fe1dhege und Krauthan stellt einen verhaltenstherapeu
tischen Ansatz dar. Damit verbinden sich sofort bestimmte Erwartungen, die
mit dieser wissenschaftlichen Fortentwicklung der Psychotherapie assoziiert
sind. Diese Erwartungen werden nicht enttäuscht, wenn man nach sauberer
Spezifikation, Transparenz des Vorgehens, Ausrichtung auf genau
beobachtbare Verhaltensweisen, durchgängiger Operationalisierbarkeit,
theoretischer Unvoreingenommenheit und Überprüfbarkeit Ausschau hält.
Man sieht es dem Werk an, daß es aus langdauernder experimenteller Praxis
und nicht aus unüberprüften klinischen Eindrücken entstanden ist.
Ein besonderes Kennzeichen des vorliegenden Ansatzes besteht in der
Vereinigung der kognitiven und motorischen Aspekte des Verhaltens. Das im
VTP praktizierte Verfahren macht Gebrauch von den kognitiven und
Verhaltensaspekten der Problemlösung. Zuerst werden die zur Problemlö
sung notwendigen Kenntnisse und rationalen Einsichten erarbeitet und dann
im Verhalten praktiziert, um die tatsächliche Umsetzung sicherzustellen.
Trotz der notwendigen Spezifikation des Verfahrens ist eine beträchtliche
Ungebundenheit eingeplant worden aufgrund der experimentellen Erkennt
nis, daß aktive und selbstschöpferische Teilnahme seitens des Klienten den
therapeutischen Erfolg und dessen Stabilität verbessert. Der Rahmen wird
vom Therapeuten vorgegeben, die Inhalte dazu erarbeitet der Klient
selbständig.
Gegenüber bisherigen Verfahren zur Hebung der Selbstsicherheit hat das
VTP durch Einbeziehung eines Kommunikations- und Belastungstrainings
eine wesentlich breitere Grundlage. Dies hat den Vorteil, daß es sich besser
auf individuelle Bedürfnisse einstellen läßt und Lösungsansätze für eine
große Palette psychischer Probleme bietet.
VI Geleitwort
Der Anwendungsbereich des VTP ist sehr breit. Es ist offensichtlich, daß das
Programm im präventiven Bereich einsetzbar ist. Wir wissen aber auch, daß
hinter den traditionellen psychiatrischen Kategorien der Psychosen, Neuro
sen und Abhängigkeiten schwere Verhaltensstörungen verschiedener Art
verborgen sind, ganz besonders aber solche des Sozialverhaltens. Der
Ausgleich solcher Defizite ist eines der Ziele des VTP.
Schließlich haben Erfahrungen aus der Praxis gezeigt, daß logischer Aufbau
und konkrete Beschreibung der einzelnen Therapieschritte das VTP zu einem
praktikablen und bevorzugten Instrument machen.
~ünchen, Januar 1979 Johannes C. Brengelmann
Vorwort
Die Grundkonzeption des VTP entstand im Jahre 1977, als die Autoren im
Auftrag und mit Mitteln des Bundesministeriums für Jugend, Familie und
Gesundheit innerhalb der Projektgruppe Rauschmittelabhängigkeit am
Max-Planck-Institut für Psychiatrie unter der Leitung von Prof. Dr. J. C.
Brengelmann eine ambulante Breitbandtherapie für jugendliche Drogenab
hängige entwickelten.
Da wir nicht auf bestehende Trainingsprogramme zurückgreifen konnten,
die einerseits den vielfältigen Defiziten im Sozialverhalten unserer Klienten
gerecht werden konnten, und andererseits - aufg rund ihrer flexiblen Struktur
- eine möglichst aktive und schöpferische Selbstbeteiligung der Klienten am
therapeutischen Prozeß gewährleisteten, sahen wir uns vor der Aufgabe, diese
Lücke durch die Entwicklung eines entsprechenden Hilfsangebotes zu füllen.
Wir haben uns dabei von den folgenden Kriterien leiten lassen:
Das Gruppenkonzept sollte die Klienten sehr aktiv an der Durchführung des
Übungsprogramms beteiligen. Weiterhin sollte soziale Kompetenz nicht nur
anhand einzelner Übungssituationen, sondern auch mittels situations- und
zeitunabhängiger Regeln und Verhaltensstrategien vermittelt werden, so daß
die Klienten dazu befähigt werden, auf beliebig viele und verschiedene soziale
Konfliktsituationen sozial kompetent zu reagieren. Schließlich sollte das
Konzept möglichst umfassend und repräsentativ für den Bereich der sozialen
Kompetenz angelegt sein.
Der zu Anfang noch sehr abstrakte Rahmen erhielt erst in der praktisch
therapeutischen Auseinandersetzung mit unseren Klienten seine konkrete
inhaltliche Ausformung. Nach der Erweiterung und Vertiefung unserer
ersten praktischen Erfahrungen mit dem VTP, im therapeutischen und
präventiven Bereich, haben wir versucht, unser Vorgehen möglichst genau zu
beschreiben und es damit transparent und für andere Therapeuten reprodu
zierbar zu gestalten.
Wir sind uns angesichts der vielfältigen Einflüsse, die das Gruppengeschehen
steuern, bewußt, daß eine Erfassung und getreue Wiedergabe des therapeuti
schen Prozesses bestenfalls in einer mehr oder weniger geglückten Annähe
rung möglich ist. Daher bleibt dem Praktiker stets die Aufgabe, das
Programm an die komplexeren und sich immer wieder veränderten Bedin
gungen seines konkreten Arbeitsfeldes anzupassen.
Wir hoffen, daß die Erfahrungen aus diesem schöpferischen Prozeß zur
Weiterentwicklung sowohl des vorliegenden Programms als auch allgemein
der verhaltenstherapeutisch orientierten Gruppentherapie beitragen werden.
Zum Schluß möchten wir unseren Dank für die konstruktive Hilfe, die uns
von vielen Seiten zuteil wurde, aussprechen. Zunächst sind dabei unsere
Klienten zu nennen, die uns in unerbittlicher Kritik auf die Schwächen des
Programms aufmerksam gemacht und uns ebenso für die hilfreichen Aspekte
VIII Vorwort
durch ihre produktive Mitarbeit mit ihrem persönlichen Fortschritt belohnt
haben.
Das Programm wäre jedoch nicht zustande gekommen ohne die Unterstüt
zung von Prof. Dr. J. C. Brengelmann, der als Leiter unserer Arbeitsgruppe
wesentliche Anstöße zur Fertigstellung dieser Arbeit gegeben hat.
Ebenso möchten wir unseren Kollegen, Dipl.-Psych. Bettina Schulze, Dr.
Sibylle Kraemer, Dipl.-Psych. Heinz Vollmer und Dipl.-Psych. Ralf Schnei
der danken, die mit uns das Programm an mehreren Klientengruppen erprobt
und uns durch Hinweise und Kritik manche Verbesserungen ermöglicht
haben.
Die Kolleginnen Dipl.-Psych. Ursula Hotopp und Gabriele Knochenstjern
unterzogen das umfangreiche Manuskript einer eingehenden Prüfung und
haben dadurch manche Fehler und Unklarheiten beseitigt.
Zum Schluß danken wir Charlotte Korintenberg, die das Entziffern unserer
Handschriften auf sich nahm und so das Manuskript für den Druck
vorbereiten half, und Frau Karin Kluge vom Springer-Verlag, die auf all
unsere Änderungswünsche und Korrekturen mit viel Geduld und Ver
ständnis einging und unserer Arbeit die nun vorliegende Form verlieh.
München, im Januar 1979 Franz-Josef Feldhege, Günter Krauthan
Inhalt
Kapitel I:
Einführung in das Verhaltenstrainingsprogramm zum Aufbau
sozialer Kompetenz (VTP). . . . . . . . . . . . . .
1 Verhaltenstherapeutische Gruppen - ein neuer Ansatz in der
Verhaltenstherapie . . . . . . . . . . . . . . . . :. 3
2 Die Entwicklung verhaltenstherapeutischer Gruppenansätze
zum Aufbau sozialer Kompetenz . . . . . . . . . . . . 4
3 Struktur und Gliederung des Verhaltenstrainingsprogramms
zum Aufbau sozialer Kompetenz . . . . . . . . . . . 8
4 Verhaltenstherapeutische Änderungsprinzipien, die im VTP zur
Anwendung kommen. . . . . . . . . . 12
5 Die Reihenfolge der vier Trainingsabschnitte
als Motivationsfaktor . . . . . . . . . . 15
6 Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten des VTP . 16
7 Kontrolle des Therapieverlaufs und Überprüfung des
Therapieerfolgs . . . . . . . . . . . . . 18
8 Organisationstherapeutische Variablen im VTP 19
9 Durchführung von Einzelsitzungen . 22
10 Auffrischungssitzungen zum VTP. . . . . . 23
11 Modifikationsmöglichkeiten des VTP . . . . 23
12. Einbeziehung von Sozialpartnern in das Verhaltenstraining . 25
13 Einführung der Klienten in die theoretischen Grundlagen
des VTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
14 Gliederung der Unterlagen zum Trainingsprogramm 27
Kapitel II:
Leitfaden zum Trainingsmanual. Hinweise und Instruktionen for den
Therapeuten. . . . . . . . . . . . . 29
1 Einführung.......... 31
1.1 Inhalt und Funktion des Leitfadens 31
1.2 Beginn der Gruppensitzung . . . 31
2 Strukturelle Gliederung des VTP . 33
2.1 Theoretische Einführung in den jeweiligen Verhaltensbereich des
VTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Vorübungen zum jeweiligen Verhaltensbereich . 33
2.3 Erarbeiten der Wissenstechniken zum jeweiligen
Verhaltensbereich . . . . . . . . . . . . 34
2.4 Erarbeiten und Durchführen der Übungssituationen zu den
Verhaltenstechniken des jeweiligen Verhaltensbereichs mit dem
Schwierigkeitsgrad I (leicht) . . . . . . . . . . . . .. 35
x Inhalt
2.5 Besprechen und Durchführen der Übungssituationen zu den
Verhaltenstechniken des jeweiligen Verhaltensbereichs mit dem
Schwierigkeitsgrad II (mittel) bzw. III (schwer) . . . .. 43
2.6 In-vivo-Übungen zu den Verhaltenstechniken des jeweiligen
Verhaltensbereichs . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
2.7 Wiederholung des Lernstoffes des jeweiligen
Verhaltensbereichs . . . . . . . . . . . 45
2.8 Durchführung einer interaktionsorientierten Gruppensitzung 45
KapitelllI:
Manual zum Verhaltenstrainingsprogramm. Eine praktische Anleitung
for den Therapeuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
Einführung in das Verhaltenstrainingsprogramm ..... . 49
2 Verhaltensbereich I: Verbesserung der Beziehung zu Partnern,
Freunden und Bekannten (Kommunikationstraining) 54
2.1 Theoretische Einführung in den 1. Verhaltensbereich
(Kommunikationstraining) . . . . . . . . . . . 54
2.2 Vorübungen zum Kommunikationstraining . . . . 57
2.3 Erarbeiten der Wissenstechniken zum 1. Verhaltensbereich . 58
2.4 Die Verhaltenstechniken des 1. Verhaltensbereichs . . .. 66
3 Verhaltensbereich II: Kontakt zu fremden Personen aufnehmen
und aufrechterhalten (Kontakttraining) . . . . . . 79
3.1 Theoretische Einführung in den 2. Verhaltensbereich
(Kontakttraining) . . . . . . . . . . . . . . 79
3.2 Vorübungen zum Kontakttraining. . . . . . . . 80
3.3 Erarbeiten der Wissenstechniken zum 2. Verhaltensbereich 81
3.4 Die Verhaltenstechniken des 2. Verhaltensbereichs . . . 84
4 Verhaltensbereich III: Berechtigte Ansprüche und Forderungen
durchsetzen (Selbstbehauptungstraining) . . . . . . 93
4.1 Theoretische Einführung in den 3. Verhaltensbereich
(Selbstbehauptungstraining) . . . . . . . . . . 93
4.2 Vorübungen zum Selbstbehauptungstraining . . . . 96
4.3 Erarbeiten der Wissenstechniken zum 3. Verhaltensbereich . 97
4.4 Die Verhaltenstechniken des 3. Verhaltensbereichs . . 105
5 Verhaltensbereich IV: Belastungssituationen bewältigen
(Belastungs training) . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1 Theoretische Einführung in den 4. Verhaltensbereich
(Belastungstraining) . . . . . . . . . . . . . 109
5.2 Vorübungen zum Belastungstraining .... , . . 113
5.3 Erarbeiten der Wissenstechniken zum 4. Verhaltensbereich . 113
5.4 Die Verhaltenstechniken des 4. Verhaltensbereichs 119
Kapitel IV:
Anhang zumVTP-Manual 141
1 Protokollbogen für Einzelsitzungen 143
2 Protokollbogen für Gruppensitzungen I 145
3 Protokollbogen für Gruppensitzungen II 147
4 Anwesenheitsliste für Gruppensitzungen 149
5 Beispiel für eine ausgefüllte Erlern-Verlern-Liste 151
Inhalt XI
6 Beispielsituationen zu den Verhaltenstechniken des
1. Verhaltensbereichs (Kommunikationstraining) . 153
7 Beispielsituationen zu den Verhaltenstechniken des
2. Verhaltensbereichs (Kontakttraining) 167
8 Beispielsituationen zu den Verhaltenstechniken des
3. Verhaltensbereichs (Selbstbehauptungstraining) . 175
9 Beispielsituationen zu den Verhaltenstechniken des
4. Verhaltensbereichs (Belastungstraining) . 181
10 Evaluationsbogen zum VTP 213
11 Literatur. 227
Kapitel V:
Arbeitsunterlagen zum Verhaltenstrainingsprogramm zum Aufbau
sozialer Kompetenz (VTP). . . . . . . . . . 231
Allgemeine Gruppenregeln . . . . . . . . 233
2 Merkbogen für Termine und Hausaufgaben . 235
3 Protokollbogen für Klienten . . . . . . . 237
4 Erlern-Verlern-Liste 239
5 Liste mit den Namen, Adressen und Telefonnummern von
Klienten, Therapiehelfern und Therapeuten. . . . . .. 242
6 Arbeitsunterlagen zu den vier Trainingsabschnitten des VTP 245