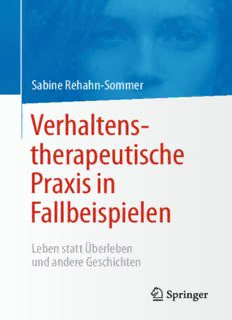Table Of ContentSabine Rehahn-Sommer
Verhaltens-
therapeutische
Praxis in
Fallbeispielen
Leben statt Überleben
und andere Geschichten
Verhaltenstherapeutische Praxis in Fallbeispielen
Sabine Rehahn-Sommer
Verhaltens
therapeutische
Praxis in
Fallbeispielen
Leben statt Überleben und andere Geschichten
Sabine Rehahn-Sommer
Marburg, Deutschland
ISBN 978-3-642-55077-5 ISBN 978-3-642-55078-2 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-642-55078-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung,
die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen
Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Planung und Lektorat: Marion Krämer, Stella Schmoll
Redaktion: Maren Klingelhöfer
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer.com
V
Vorwort
In meiner langjährigen Tätigkeit als Dozentin für Selbsterfahrung und Supervisorin
in der Verhaltenstherapieausbildung habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht,
dass die angehenden Therapeutinnen1 trotz eines umfangreichen theoretischen
Lernstoffs nur unzureichend auf die Konfrontation mit der realen therapeutischen
Situation vorbereitet sind. Ursachen dafür sehe ich zum einen in dem normalen, für
den Übergang von der Theorie zur Praxis typischen „Praxisschock“ dieser Phase;
zum anderen aber in den derzeit üblicherweise vermittelten störungsspezifischen
Konzepten, die sich nur begrenzt auf die therapeutische Praxis übertragen lassen.
Angesichts dieser Problematik formulieren Ausbildungskandidatinnen ein großes
Bedürfnis, zusätzlich zur Supervision und Selbsterfahrung Einblick in das konkrete
therapeutische Vorgehen erfahrener Therapeutinnen zu erhalten, um damit an un-
terschiedlichen Modellen lernen zu können. Hierbei ist der Wunsch von Bedeutung,
nicht nur einzelne Situationen, sondern gesamte Therapieprozessverläufe mitzu-
verfolgen.
Im Folgenden möchte ich diesem Bedürfnis entsprechen, indem ich – unter Rück-
griff auf die alte Tradition der Fallgeschichten – fünf Therapieverläufe aus meiner
Praxis beschreibe.
Zudem wenden sich diese Geschichten auch an interessierte Laien. Zum einen
könnte dies Leserinnen betreffen, die selbst keinen Bezug zur Therapie haben, sich
aber für Lebens- und Therapieprozesse interessieren. Zum anderen möchten viel-
leicht Menschen, die selbst schon eine Psychotherapie gemacht haben, schauen, wie
es anderen in deren Behandlung ergangen ist. Schließlich richtet sich dieses Buch
an potenzielle oder bereits in Therapie befindliche Patientinnen.
Im Laufe meiner Berufstätigkeit bin ich immer wieder folgenden Fragen begegnet:
Was tun Sie eigentlich als Therapeutin? Wie funktioniert, was passiert in einer The-
rapie? Wer sind diese Patientinnen? Wer geht mit welchen Problemen wann in The-
rapie? Könnte mich das auch betreffen? Und wenn ja, worauf sollte ich dann achten?
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und aufgrund der Tatsache, dass heutzutage sowohl
Therapeuten als auch Patienten überwiegend weiblichen Geschlechts sind, verwende ich
in diesem Buch zumeist die weibliche Form. Dies schließt selbstverständlich Männer ein.
Zur Erläuterung: Nur ein Drittel der Psychotherapiepatienten sind Männer, was nicht
am geringeren Bedarf liegt – die Suizidrate von Männern z. B. ist dreimal so hoch wie
von Frauen –, sondern an deren spezifischer Symptomatik und typischen Bewältigungs-
strategien (somatische Symptome, Süchte, Ausagieren etc.) sowie an Psychothera-
pievorbehalten, die mit bestimmten Männlichkeitsvorstellungen zusammenhängen.
Zudem gibt es aktuell nahezu doppelt so viele niedergelassene Psychotherapeutinnen wie Psy-
chotherapeuten. Die Entwicklung in den Ausbildungsinstituten lässt keine Änderung dieses pro-
blematischen Zustandes erwarten, im Gegenteil: Die Anzahl der Frauen nimmt in diesem Beruf
weiter zu (Bühring 2013; DPV 2013c).
VI Vorwort
Mit der Einführung und den Therapiegeschichten hoffe ich, einige dieser Fragen
beantworten zu können. Das im Anhang befindliche Glossar soll eine Übersetzungs-
hilfe bieten, wo ich – trotz guter Vorsätze – doch in ein Fachchinesisch verfallen bin.
Über das Interesse erfahrener Kolleginnen würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Der
fachliche Austausch anhand konkreter Therapiebeispiele gehört meines Erachtens
zu den fruchtbaren Möglichkeiten der Reflexion, der Anregung für die fachliche
Weiterbildung und letztlich der Qualitätssicherung.
Dr. Sabine Rehahn-Sommer
Marburg, Juli 2014
VII
Danksagung
Vielen Menschen gilt mein Dank.
Mein erster und tiefer Dank richtet sich an meinem Mann. Erst seine Anregung hat
mich zum Schreiben dieses Buches veranlasst; sein Ermutigen sowie seine emotio
nale und fachliche Unterstützung waren wichtige Säulen meiner Arbeit. Vor allem
danke ich ihm für sein Verständnis, dass dieses Projekt – durch mein intensives
Eingebundensein über viele Monate hinweg – einen so großen Raum unseres ge
meinsamen Lebens besetzt hielt.
Meiner Tochter Anna Sommer danke ich für ihre geduldige Hilfe bei Computer
problemen sowie für ihre sorgfältigen Korrekturarbeiten.
Mein besonderer Dank geht weiterhin an Dr. Kerstin Kühl. Ihr kritisches Lesen mei
nes Manuskriptes unter redaktionellen, klinischpsychologischen, therapeutischen
und Ausbildungsaspekten sowie ihre Hinweise auf aktuelle Forschungsergebnisse
und Literatur waren für mich gleichermaßen Ermutigung, Anregung und Rückhalt.
Petra Müller, Ärztliche Psychotherapeutin, danke ich für die Überprüfung des Textes
aus medizinischer und psychoonkologischer Sicht.
Prof. Dr. Reiner Bastine danke ich für unsere langjährigen, intensiven fachlichen
Diskussionen, die in dieses Projekt eingeflossen sind, sowie für seine hilfreichen
Rückmeldungen zum Manuskript.
Mein Dank gilt auch meinen Ausbildungskandidatinnen und kandidaten sowie
meinen Supervisandinnen und Supervisanden mit ihren intensiven Fragen bzgl.
meines eigenen Umgangs mit komplexen Therapiesituationen. Hierdurch wurde
mir der Bedarf nach ergänzender Praxisanleitung – speziell durch das Lernen am
Modell erfahrener Therapeutinnen und Therapeuten – deutlich, und dies bestärkte
mich in der Idee meines Projektes.
Dipl.Psych. Pia von Blanckenburg und Dipl.Psych. Franziska Schuricht danke ich
für ihr kritisches Korrekturlesen aus der Perspektive zweier Ausbildungskandida
tinnen.
Den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Ausbildungsinstitute verdanke
ich aus unserer Zusammenarbeit viele Anregungen, die letztendlich in dieses Projekt
eingeflossen sind. Insbesondere Prof. Dr. Annette Kämmerer, Dr. Friedrich Kapp
und Dr. Dietmar Juli möchte ich hier nennen, mit denen ich mich schon viele Jahre
dem Thema Selbsterfahrung in der Verhaltenstherapieausbildung widme. Die Erfah
rungen bei der gemeinsamen Konzeptentwicklung, der Durchführung der Selbst
erfahrungsseminare sowie bei der Ausbildung von Selbsterfahrungsdozentinnen und
dozenten haben mein Verständnis von Therapie und Lehre entscheidend beeinflusst.
VIII Danksagung
Ich danke den Kolleginnen meiner Intervisionsgruppe – Dr. Jutta Hermanns,
Dipl.Psych. Brigitte Probst und Dr. Christiane ZimmerAlbert – für die wertschät
zende und hilfreiche Unterstützung bei therapeutischen Problemen und Fragen.
Meinen Freundinnen und Freunden sowie meinen Geschwistern danke ich dafür,
dass sie meinen sozialen Rückzug mit Verständnis ertrugen und für die von ihnen
erhaltenen Rückmeldungen zu meinem Text.
Vor allen anderen danke ich meinen Patientinnen und Patienten. Ich bedanke mich
für ihr Vertrauen, sich auf mich und meine Therapievorschläge einzulassen. In der
Arbeit mit ihnen bin ich immer wieder gefordert, mein Wissen und mein Verständ
nis zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ihre immer wieder geäußerten Fragen
nach Informationsmaterial mit möglichst konkreten Therapiebeispielen zu Vor
gehen und Wirkung der Verhaltenstherapie hat ebenfalls meine Projektidee bestärkt.
Mein größter Dank jedoch gilt den Patientinnen und dem Patienten meiner Fall
geschichten. Ohne ihre Einwilligung zur Veröffentlichung wäre dieses Projekt nicht
möglich gewesen. Ihr Interesse, ihr Engagement und ihre Reaktionen auf die Texte
haben mich in meinem Vorhaben bestärkt und ermutigt.
All diesen Menschen danke ich von ganzem Herzen.
IX
Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen und Ziele dieses Buches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1 .1 Adressatinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Interessierte Laien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Therapeutinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1 .2 Konzepte und Prinzipien meines therapeutischen Vorgehens . . . . . . . . . . . . . . . .5
Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1 .3 Mein therapeutisches Vorgehen in der Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1 .4 Kennzeichen der Fallgeschichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2 Im Unruhestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 .1 Herrn Bergers Lebensgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2 .2 Symptomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2 .3 Problemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
2 .4 Diagnostische Beurteilung5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2 .5 Therapiekonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2 .6 Konzeptbesprechung und Therapievereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2 .7 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Das Unverständliche verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Der Angst entgegentreten: Bewältigen und neu bewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Sich einrichten in der neuen Lebenssituation: Strukturieren, erkunden,
installieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Rückfallvorbeugung: Das Handeln neu ausrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2 .8 Abschlussbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2 .9 Ein halbes Jahr später8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
2 .10 Reflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
3 Schicksals Schläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3 .1 Erste Sitzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Die Welt in tausend Splittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
3 .2 Fünf Monate später . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Die Scherben ordnen, den Gefühlen ihren Platz geben,
Einflussmöglichkeiten nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
3 .3 Symptomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
3 .4 Diagnostische Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
3 .5 Übergeordnetes Therapiekonzept, Ziele der ersten Interventionen . . . . . . . . . .57
3 .6 Konzeptbesprechung und Therapievereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
3 .7 Erste Therapiephase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
X Inhaltsverzeichnis
3 .8 Kennzeichen des aktuellen Trauerprozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3 .9 Therapiekonzept für den Umgang mit der Trauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3 .10 Konzeptbesprechung, Therapievereinbarungen,
Fortsetzung der Trauerarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3 .11 Frau Blums Lebensgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
3 .12 Problemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
3 .13 Therapiekonzept für das Leben mit der Krankheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
3 .14 Konzeptbesprechung und Therapievereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
3 .15 Zweite Therapiephase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Rückkehr ins Leben, Renovieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
3 .16 Zwischenbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
3 .17 Dritte Therapiephase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
3 .18 Erneute Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
3 .19 Vierte Therapiephase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
3 .20 Fünfte Therapiephase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Loslassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
3 .21 Reflexion24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
4 Das Opfer Selberschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4 .1 Frau Ahrends Lebensgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4 .2 Drei Monate später . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
4 .3 Symptomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
4 .4 Problemanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
4 .5 Diagnostische Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
4 .6 Besprechen der Ergebnisses der Problemanalyse: Widerspruch . . . . . . . . . . . . .104
4 .7 Therapiekonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4 .8 Konzeptbesprechung und Therapievereinbarungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
4 .9 Erste Therapiephase: Stress reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Schlafen, Anspannung reduzieren und Entspannung fördern . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Selbstbehauptung und Selbstfürsorge: Zwei schwierige Themen . . . . . . . . . . . . . . .109
Den Alltag und die Arbeit strukturieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
4 .10 Zweite Therapiephase: Das Trauma integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Rekonstruieren: Ergänzung der Lebensgeschichte durch das Traumageschehen 117
Konfrontieren, emotional distanzieren, Kontrollerleben stärken . . . . . . . . . . . . . . . .118
Erreichtes und Offenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Zwischenfälle: Die Liebe und andere Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Neu interpretieren, neu bewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Therapeutische Zwischenreflexionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Beziehungsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Körperreaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
4 .11 Dritte Therapiephase: Arbeit am Oberplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Akzeptieren und integrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Neu orientieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Description:Angelehnt an die Form der Novelle werden in fünf Fallgeschichten komplette Therapieverläufe aus der realen, komplexen verhaltenstherapeutischen Praxis beschrieben, einschließlich der Reflektionsebene der Therapeutin.Die fünf Fallgeschichten repräsentieren:- Lebensgeschichten: Sie beschreiben bi