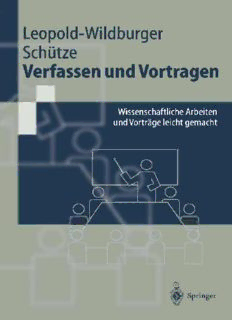Table Of ContentSpringer-Lehrbuch
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
Ulrike Leopold-Wildburger . Jörg Schütze
Verfassen
und Vortragen
Wissenschaftliche Arbeiten
und Vorträge leicht gemacht
Springer
Univ.-Professor Dr. Ulrike Leopold-Wildburger
Dr. ]örg Schütze
Karl-Franzens-Universität Graz
Institut für Statistik und Operations Research
Universitätsstraße 15/E3
A-8010 Graz
Österreich
[email protected]
[email protected]
ISBN 978-3-540-43027-8 ISBN 978-3-662-10771-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-10771-3
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Leopold-Wildburger, Ulrike: Verfassen und Vortragen: wissenschaftliche Arbeiten und
Vorträge leicht gemacht 1 Ulrike Leopold-Wildburger; Jörg Schütze. - Berlin; Heidelberg;
New York; Barcelona; Hongkong; London; Mailand; Paris; Tokio: Springer, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesonde
re die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen
und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf ande
ren Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur aus
zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen
dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in
der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwider
handlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
http://www.springer.de
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2002.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Design & Production GmbH, Heidelberg
SPIN 10861199 42/2202-5 4 3 2 1 0 - Gedruckt auf säurefreiem Papier
Vorwort
Der Einsatz des Manuskriptes in Lehrveranstaltungen hat uns in der
Absicht bestärkt, dieses den Studierenden als Buch zur Verfügung
zu stellen. Der Inhalt basiert im Wesentlichen auf den Erfahrungen
aus Seminaren für Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften der Karl-Franzens-Universität Graz. Das Manuskript wurde
mehrfach überarbeitet und an die neusten Entwicklungen angepasst.
Es handelt sich um eine ausgewogene Kombination notwendiger
theoretischer Anleitungen mit einfach umsetzbaren, praktischen
Beispielen für die wir aus dem Kreis der Studierenden viele
sinnvolle Anregungen erhalten haben.
Wir geben zu Bedenken, dass es im wissenschaftlichen Bereich kein
einheitliches Vorgehen gibt! Sie finden weder Generalrezepte noch
Zaubermittel! Das individuelle Erarbeiten verschiedener Themen
und die Präsentation von Ergebnissen können auf unterschiedlichste
Weise geschehen.
In diesem Buch geben wir Hinweise, die sich auf effizientes
Erarbeiten einer Thematik beziehen und Sie vor Fehlern bewahren
sollen. Die anwendungsorientierten Überlegungen basieren sowohl
auf traditionellen Methoden wie auch auf modemen Technologien.
In diesem Zusammenhang findet das Internet grundlegende
Verwendung.
Beachten Sie, dass Internetseiten häufig zeitlich eingeschränkt
angeboten werden. Wir bieten Ihnen daher auf unserer persönlichen
Homepage einen Service zum Aufrufen aller im Buch genannten
Internetseiten.
www.uni-graz.atlsoowww/ personal/Leopold/methode/index.html
Graz, im November 2001 U. Leopold-Wildburger
J. H. Schütze
Danksagung
Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und für viele wertvolle
Anregungen möchten wir unseren Kollegen und Freunden
Lutz Beinsen, Heinrich Berger, Bemd Brandl, Christian Klamler,
Sarah Knights, Heinz Kurz, Alois Lafer, Klaus Ladner,
Franz Leopold, Ulrich Pferschy, Filippina Risopoulos und Klaus
Weiss herzlich danken. Wir danken Frau Hildegunde Grabl-Ruttner
für die Mithilfe beim Tippen des Manuskripts. Schließlich gilt unser
Dank Herrn Wemer Müller und dem Springer Verlag für die
angenehme Zusammenarbeit und die schnelle Drucklegung des
Buches.
Graz, im November 200 I U. Leopold-Wildburger
J. H. Schütze
INHALT SVERZEICHNIS
1 Einleitung ..................................................................... 1
1.1 Die Zeitkomponente ............................................................ 2
1.2 Die Zielkomponente ............................................................ 3
1.3 Die Zweckkomponente ....................................................... 4
1.4 Die Entdeckungsrelation .................................................... 5
1.5 Die Begründungsrelation .................................................... 5
1.6 Die Folgerungsrelation ....................................................... 6
1.7 Die Empfehlung 1 der D FG ............................................... 7
2 Motivation und Konzentration ..................................... 9
2.1 Motivation und Ressourcen ............................................... 9
2.1.1 Tipps zur Mobilisierung unserer Motivation ....................... 10
2.1.2 Vorschläge für einen Arbeitsplan ......................................... 13
2.2 Konzentration und Störungen ......................................... 15
2.3 Ideen- und Kreativitätsmanagement ............................... 17
2.4 Herausforderungen und Probleme .................................. 22
2.4.1 Die Problemkommunikation ................................................ 23
2.4.2 Ein erfolgreiches Prob1emlösungsmodell ............................. 24
2.5 Individuelles Lernen ......................................................... 25
2.5.1 Lernen all eine oder in Gruppen ............................................ 26
2.5.2 Effizientes Lernen ................................................................ 28
2.6 Bücher und Vorträge richtig nutzen können ................. 31
2.6.1 Schritte einer Aufnahme eines Buches oder eines Artikels .31
3 Sammeln von Grundlagen in traditioneller Weise .... 35
3.1 Methodologische Grundlagen .......................................... 36
3.2 Einleitung und Abstecken des Themas .......................... .40
3.3 Defmitionen und Erläuterungen suchen ........................ .42
3.4 Grundlegende Arbeiten sammeln und recherchieren .. .46
3.5 Abstecken des Rahmens gegenüber Nachbargebieten .. 48
3.6 Dispositionen suchen und Gliederungen erstellen ......... 51
3.7 Ordnen und Ausarbeiten .................................................. 54
3.8 Folgerungen ziehen ........................................................... 57
3.8.1 Empfehlung 7 der Deutschen Forschungsgemeinschaft ...... 58
3.9 Bewertung und Interpretation samt Ausblick ............... 60
3.10 Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis ..................... 61
3.11 Fußnoten ............................................................................ 63
3.12 Literaturverzeichnis und Anhänge ................................. 64
x
3.13 Formale Kriterien ............................................................. 67
3.13.1 Generelle Beurteilungskriterien ........................................... 67
3.13.2 Merkblatt für das Doktoratsstudium .................................... 68
3.13.3 Merkblatt für technische Diplomstudien .............................. 69
3.14 Beispiele ............................................................................. 70
3.14.1 Experimentelle Ökonomie .................................................. 70
3.14.2 Englische Kurzfassung über Rationalität ............................. 72
3.14.3 Bevölkerungs-und Wirtschafts statistik ............................... 73
3.14.4 Politikwissenschaft ............................................................... 76
3 .14.5 Vergleichende Geschichtswissenschaften ............................ 77
3.14.6 Simulationsstudie Konfliktforschung ................................... 79
3.14.7 Diplomarbeit Erziehungswissenschaften ............................. 80
3.14.8 Mathematik .......................................................................... 82
3.14.9 Spieltheorie .......................................................................... 84
3.14.10 Medizin ................................................................................ 85
4 Modeme Technologien .............................................. 87
4.1 Einige allgemeine Tipps .................................................... 87
4.1.1 Arbeitsplatz .......................................................................... 87
4.1.2 Softwareausstattung ............................................................. 88
4.1.3 Systemsicherungen ............................................................... 88
4.1.4 Sicherheit im Netzwerk und Internet ................................... 89
4.1.5 Drucker. ................................................................................ 90
4.1.6 Ältere und aktuelle Programmversionen .............................. 91
4.2 Grundsätze der Dateiverwaltung .................................... 91
4.2.1 Versionskontrolle ................................................................. 91
4.2.2 Diskette und Speichermedien ............................................... 93
4.2.3 Auswahl der zu sichernden Dateien ..................................... 94
4.2.4 Dateien brennen ................................................................... 97
4.3 Viren und Hacker ............................................................. 97
4.3.1 Anhänge ............................................................................... 97
4.3.2 Passwörter, Firewall und Viren ............................................ 98
4.4 Textverarbeitung ............................................................... 99
4.4.1 Benutzerlexikon Word ....................................................... 10 0
4.4.2 Wichtige Befehle in Word ................................................. 103
4.4.3 Formatvorlagen .................................................................. 10 4
4.4.4 Word und Bilder. ................................................................ 104
4.5 Grartken ........................................................................... 10 7
4.5.1 Dateigröße und Qualität ..................................................... 10 7
4.5.2 Bildschirmkopie ................................................................. 110
4.5.3 Fremdgrafiken anpassen. .................................................... 111
XI
4.6 Bibliotheksnutzung ......................................................... 111
4.7 Das Internet als Quelle ................................................... 117
4.7.1 Eignung des WWW als Quelle .......................................... 117
4.7.2 Zugäng1ichkeit und Überprüfbarkeit.. ................................ 118
4.8 Organisation mit Hilfe des Internet .............................. 120
4.8.1 Kommunikation und Lesezeichen ...................................... 120
4.8.2 Speicherplatz im WWW .................................................... 120
4.9 Suche mit Hilfe des Internet. .......................................... 121
4.9.1 Suchmaschinen: Übersicht ................................................. 121
4.9.2 Suchen mit Boo1eschen Operatoren ................................... 124
4.9.3 Goog1e ................................................................................ 125
4.9.4 Altavista ............................................................................. 127
4.9.5 Northern Light. ................................................................... 128
4.9.6 Metasuchmaschinen ........................................................... 129
4.10 Deutschsprachige Suche ................................................. 130
4.10.1 Wörterbücher in Internet .................................................... 130
4.11 Kommunikation im Internet .......................................... 131
4.11.1 "Partnerschaftssuche" Online ............................................. 131
4.11.2 Kommunikation: E-Mail und Homepage ........................... 131
4.11.3 IRe und Mailing Lists ........................................................ 134
4.12 Endkontrolle .................................................................... 134
5 Vortragen ................................................................. 137
5.1 Die Kunst des Vortragens .............................................. 137
5.2 Ausstrahlung und V orbereitung .................................... 138
5.3 Organisation Ihres Vortrags .......................................... 140
5.4 Die wichtigsten Grundsätze einer guten Präsentation 142
5.4.1 Aufbau einer Präsentation .................................................. 145
5.4.2 Beispiele für den Stil eines Vortrags .................................. 146
5.4.3 Tipps und Tricks für Ihren Vortrag .................................... 147
5.4.4 Beispiele für Folien und Powerpoint... ............................... 149
5.4.5 Einige Tipps für Ihr Auftreten ............................................ 15 5
5.4.6 Nachbereitung .................................................................... 156
5.5 Die Aktivierung der Zuhörer und die Diskussion ........ 157
5.6 Ihr Kontakt mit der Sie betreuenden Person ............... 161
6 Literaturverzeichnis ................................................. 166