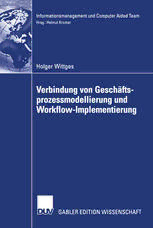Table Of ContentHolger Wittges
Verbindung von Geschiiftsprozessmodellierung
und Workflow-Implementierung
GABLER EDITION WISSENSCHAFT
Informationsmanagement
und Computer Aided Team
Herausgegeben von Professor Dr. Helmut Krcmar
Die Schriftenreihe prasentiert Ergebnisse der betriebswirtschaft
lichen Forschung im Themenfeld der Wirtschaftsinformatik. Das Zu
sammenwirken von Informations- und Kommunikationstechnologien
mit Wettbewerb, Organisation und Menschen wird von umfassenden
Anderungen gekennzeichnet. Die Schriftenreihe greift diese Fragen
auf und stellt neue Erkenntnisse aus Theorie und Praxis sowie an
wendungsorientierte Konzepte und Modelle zur Diskussion.
Holger Wittges
Verbindung von Geschafts
prozessmodellierung und
Workflow-Implementierung
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Helmut Krcmar
Deutscher Universitats-Verlag
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Ober
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Dissertation Universitat Hohenheim, 2004
D 100
ALFABET, ARIS, ARIS-Tooiset, Domino-Workflow, Lotus Notes, SAP R/3 sind eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
1. Auflage September 2005
Aile Rechte vorbehalten
© Deutscher Universitats-Verlag GmbH/ GWV Fachverlage Wiesbaden, 2005
Lektorat: Brigitte Siegel/Anita Wilke
Der Deutsche Universitats-Verlag ist ein Unternehmen von
Springer Science + Business Media.
www.duv.de
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
waren und daher von jedermann benutzt werden dOrften.
Umschlaggestaltung: Regine Zimmer, Dipl.-Designerin, Frankfurt/Main
Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
ISBN-13:978-3-8244-831 0-5 e-ISBN-13:978-3-322-81937-6
DOl: 10.1007/978-3-322-81937-6
Geleitwort
In aktuellen Softwarearchitekturen ist die Frage der Verbindung von Geschiiftspro
zessmodellen auf fachlicher Ebene und deren technischer Umsetzung in Form von
Workflows ein aktuelles Forschungsfeld. Der Kopplung beider Ebenen kommt bei der
praktischen Umsetzung von Service-orientierte Architekturen (SOA) eine wesentliche
Bedeutung zu, da Services zunehmend auf fachlicher Ebene konfiguriert und sofort im
Systemumfeld ausfiihrbar sein sollen.
Die Arbeit von Holger Wittges zeigt mit dem LINK-Konzept einen pragmatischen
Weg zur Verbindung von Geschiiftsprozessmodellierung und Workflow-Implementie
rung auf. Das Konzept hat seine Starke in der Unabhiingigkeit von konkreten
Modellierungstechniken und Werkzeugen sowie der Unterstiitzung der Modellpflege
uber ihren Lebenszyklus. Gerade der zweite Aspekt wird bei einer strengen Top
Down-Vorgehensweise im Rahmen der Workflow-Implementierung oft vernach
liissigt, ist fUr die Wartung des Systems jedoch von zentraler Bedeutung.
Die Darstellung der verschiedenen Sprachtypen (informal, semi-formal und formal)
wie sie fUr die Modellerstellung im Umfeld Geschiiftsprozessmodellierung, Workflow
Modellierung und Workflow-Implementierung verwendet werden, und die
vergleichende Darstellung ihrer Metamodelle, macht auf konzeptioneller Ebene die
semantischen Lucken deutlich.
Anhand der durchgefiihrten Fallstudie, wird im konkreten Anwendungsfall
eindrucksvoll dargestellt, wie stark fachliche Prozessmodelle von den technisch
irnplementierten Prozessen abweichen konnen, so dass auch hier die Grenzen einer
automatischen Uberfiihrung deutlich werden.
Die Arbeit entstand am Lehrstuhl fiir Wirtschaftsinformatik an der Universimt
Hohenheim im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der Stadtwerke Dusseldorf
AG.
Es ist zu wiinschen, dass die dargestellten Ergebnisse in die aktuelle Diskussion urn
Service-orientierte Architekturen Eingang finden und dadurch die semantische Lucke
zwischen fachlichem Modell und technischer Implementierung verkleinert werden
kann.
Prof. Dr. Helmut Krcmar
Vorwort
Die Verbindung von Geschiiftsprozessmodellierung und Workflow-Implementierung
ist eine Aufgabenstellung, die mich seit meinem Wirtschaftsinformatik-Studium an der
Universitat Bamberg (1991-1996) begeistert. Viele Veroffentlichungen zeigen, dass es
zahlreiche inhaltliche Uberschneidungen in den zugehorigen Metamodellen und
Modellen gibt, die eine automatische Generierung von W orkflows auf Basis von
Geschiiftsprozessmodellen nahe leg en. In der Praxis findet man entsprechende
Werkzeuge jedoch nicht im Einsatz. Warum?
Ais Erstes mochte ich meinem akademischen Lehrer Herrn Prof. Dr. Helmut Krcmar
danken. Durch seine Unterstiitzung bei der Systematisierung der Aufgabenstellung,
seine Diskussionsbereitschaft, seinen wichtigen Input auch "weiche Faktoren" in die
Betrachtung einzubeziehen und seine kontinuierliche Betreuung hat er ganz wesentlich
zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen.
Herrn Prof. Dr. Walter Habenicht danke ich flir die Ubemahme des Koreferats und
Herrn Prof. Dr. Stefan Kim fUr die Leitung meines Kolloquiurns.
Herrn Prof. Dr. Elmar 1. Sinz und Herrn Prof. Dr. Otto K. Ferstl mochte ich fUr die
zahlreichen Anregungen wiihrend meines Studiurns danken, die AuslOser flir dieses
Projekt waren. Insbesondere der SOM-Ansatz und der generische Architekturrahmen
waren mir von groI3er Hilfe.
Fiir die Unterstiitzung bei der Durchfiihrung der Fallstudie mochte ich mich bei der
Stadtwerke Dusseldorf AG, mit ihrem ehemaligen DV-Leiter Prof. Dr. Manfred Esser
und den Mitarbeitem Dr. Manfred Fidelak, Karin Peters, Jens Schmittchen, Dr. Ivonne
Servaes, Hans-Josef Wolber, Oliver Sporrer und Prof. Dr. Rene Treibert bedanken.
Der Firma alfabet AG in Berlin danke ich fUr die Teststellung ihrer Software zur
Metamodellierung und Herrn Walter Wahl flir den guten Support.
Meinen Kollegen am Lehrstuhl von Professor Krcmar an der Universitiit Hohenheim
danke ich fUr konstruktive Doktoranden-Seminare und das gute Arbeitsurnfeld: Dr.
Tilo Bohmann, Helga Daurn, Miriam Daum, Florian Fogl, Dr. Karin Griislund, Prof.
Dr. Dieter Hertweck, Astrid Hoffinann, Sandra Hummel, Dr. Andreas Johannsen, Dr.
Markus Junginger, Dr. Amd Klein, Dr. Jan Marco Leimeister, Dr. Lars Najda, Michael
Reb, Prof. Dr. Birgit Schenk, Prof. Dr. Gerd Schwabe, Dr. Bettina Schwarzer, Beate
Viakowski, Dr. Bernd Vohringer, Jom Weigle, Dr. Dietrnar Weill, Petra Wolf, Stephan
Wilczek, Thomas Winkler und Dr. Stefan Zerbe.
Bei der Diskussion verschiedener Teilbereiche dieser Arbeit waren die Gespriiche und
Workshops mit meinen Diplomanden Evelyn Bar, Jorg Degen, Sven Munk sowie
Marco Schmucker spannend und hilfreich. Auch dafUr herzlichen Dank.
VIII Vorwort
Fiir wichtige KorrekturvorschHige zur ersten Fassung danke ich Heike Lipinski, Dr.
Carsten Malischewski, Heike Munk, Sven Munk, Dr. Heiko Raue, Andreas Schicht,
sowie Dr. Ulrich Vomefeld.
Fiir die Ubemahme des Lektorats danke ich Simone Hoffmeister und Hagen Schick.
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie Eleonore Wittges, DetlefWittges, Wolfgang
Wittges, Ilona Wittges und Jessica Wittges, die mir jederzeit den notwendigen
Riickhalt gegeben haben.
Holger Wittges
Abstrakt
1m Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass in den unterschiedlichen Zielsetzungen
von Geschiijtsprozessmodellen und Modellen fur die Worliflow-Implementierung die
unterschiedlichen Anforderungen an deren Modellierungssprachen und Software
Werkzeuge begriindet ist. So benotigt der Modellierer zur Erstellung von
Geschiiftsprozessmodellen eine informale oder semi10rmale Modellierungssprache,
da wesentliche Inhalte in Prosa-Texten, nicht formalisierten Diagrammen und Tabellen
dokumentiert werden (vgl. Becker/Schutte 1996; FerstllSinz 1993b; Scheer 1994,
1998a). Der Anteil dieser informal (d.h. nicht unter Verwendung einer formalisierten
Notation) abgelegten Informationen variiert, da er unter anderem von der verwendeten
Modellierungssprache, der Domiine und den Priiferenzen des Modellierers abhiingt.
Fiir die Modelle zur Workflow-Implementierung wird hingegen zwingend eine
formale Modellierungssprache benotigt, da nur so Workflow-Implementierungen von
einem Workflow-Management-System interpretiert werden konnen.
Darnit grenzt sich diese Arbeit deutlich von anderen Ansiitzen ab, die die Verwendung
einer gemeinsamen, formalisierten Notation sowohl fur die Geschiiftsprozess
modellierung als auch fur die Workflow-Implementierung vorschlagen.
Weiter wird im Rahmen dieser Arbeit mit dem LINK-Konzept ein Ansatz vorgestellt,
der Zeitaufwand, Kosten und Qualitiit von Geschiiftsprozessmodellierung und
Workflow-Implementierung durch ein den Lebenszyklus der Modelle mit ihren
unterschiedlichen Notationen beriicksichtigendes Integrationskonzept deutlich
optimiert. 1m LINK-Konzept kommt dem Worliflow-Modell als "Mittler" zwischen
Geschiiftsprozessmodell und Workflow-Implementierung eine zentrale Bedeutung zu.
Wesentliche MerkmaIe des LINK-Konzeptes sind:
• Lose Kopplung der drei Modellebenen Geschiiftsprozessmodellierung, Workflow
Modellierung und Workflow-Implementierung
• Nutzung von etablierten, kommerziellen Tools fur die Modellerstellung innerhalb
der drei Modellebenen
• Konzeptionelle und technische Unterstutzung bei der Uberfohrung von
Modellinhalten zwischen den verschiedenen Modellebenen
Unterstutzung des .,i'nderungsmanagements aller Modelle
• Dokumentation der A.'nderungen uber den gesamten Lebenszyklus der Modelle
Diese Arbeit liefert damit einen Beitrag zur Abgrenzung von Geschiiftsprozess- und
Workflow-Modellen sowie zur Optimierung der Integration von Geschiiftsprozessen
und Workflows. Die Ergebnisse konnen fur die Entwicklung zukiinftiger Software
Werkzeug-Generationen genutzt werden und damit die Entwicklung von Workflows
auf Basis von Geschiiftsprozessen verbessern.
Inhaltsverzeichnis
v
Geleitwort
Vorwort VII
Abstrakt IX
Abbildungen XV
Tabellen XVIII
Abkiirzungsverzeichnis XIX
1. Einleitung 1
1.1 Prolog I
1.2 Motivation 2
1.3 Zielsetzung 3
1.4 Einordnung in die Wirtschaftsinformatik- F orschung 5
1.5 Darstellungshinweise 6
l.6 Begriffiichkeiten 6
2. Abgrenzung von Geschiiftsprozess und Workflow 13
2.1 Einleitung 13
2.2 Modellbildung (generisch) 14
2.2.1 Modell 14
2.2.2 Vorgehensmodell 16
2.2.3 Modelltypen 18
2.2.4 Modellierung 21
2.2.5 Zusarnmenfassung 21
2.3 Der generische Architekturrahmen 23
2.3.1 Allgemeine Darstellung 23
2.3.2 Anwendbarkeit im Rahmen dieser Arbeit 26
2.4 Modellbildung (konkret) 27
2.4.1 Informationserhebung 29
2.4.2 Geschiiftsprozessmodellierung 30
2.4.3 Workflow-Modellierung 31
2.4.4 Workflow-Implementierung 32
2.4.5 Betriebsphase/Lebenszyklus 33
2.4.6 Abgrenzung der Modelle 33