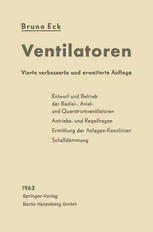Table Of ContentVentilatoren
Ventilatoren
Entwurf und Betrieb der Radial-, Axial
und Querstromventilatoren
Von
Bruno Eck
Dr.-Ing.
Vierte
verbesserte und erweiterte Auflage
Mit 598 Abbildungen
Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH
1962
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet,
dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege
(Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen
Copyright 1937 and 1952 by Springer-Verlag OHG, BerIin/Göttingen/Heidelberg
© by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1957 and 1962
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag, OHG., BerlinJGöttingenJHeidelberg 1962
Softcover reprint oftbe hardcover 4th edition 1962
ISBN 978-3-662-30212-5 ISBN 978-3-662-30211-8 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-30211-8
Die Wiedergabe von Gehrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Buche berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften
Vorwort zur vierten Auflage
Die anhaltende Aufwärtsentwicklung im Ventilatorenbau machte eine
vollkommene Neubearbeitung und Erweiterung der schnell vergriffenen
dritten Auflage notwendig. Seit dem Bekanntwerden des Hochleistungs
gebläses (1952) mit einem Wirkungsgrad von 90% erlebte der
Ventilatorenbau einen unerwarteten Aufschwung, der zu einer Umstel
lung dieses Industriezweiges führte und noch nicht abgeschlossen ist.
Bei den Hochleistungsgebläsen dürften die letzten Verbesserungen
die Grenze des Möglichen erreicht haben. Neu sind Typen, die bei einem
Wirkungsgrad von über 80% die gleiche Schluckfähigkeit wie Axial
gebläse erreichen bei erstaunlich kleinen Abmessungen. Beachtlich ist
die neuere Entwicklung der Trommelläufergebläse, die infolge ihrer Ge
räuscharmut und kleinen Abmessungen bestimmte Anwendungsgebiete
beherrschen. Neue Anwendungsgebiete von Querstromventilatoren wur
den bekannt. Es gelang, die Theorie und Ausführungen dieser eigen
artigen V entilat oren einigermaßen zu klären.
Die neue Gesamteingliederung aller Ventilatortypen in ein einheitliches
Kennzahlgebiet ist beachtlich.
Fortschritte auf dem Ge biet der Regulierung wurden sowohl bei Radial
wie bei Axialventilatoren erreicht.
Nach wie vor bleibt als Sorgenkind die äußerst schwierige Anpassung
des Ventilators an gegebene Betriebsverhältnisse. Eine große Anzahl
von Ventilatoren ist falsch ausgelegt. Eine eingehende Beschäftigung
mit dieser schwierigen Aufgabe ist unerläßlich, da sonst die hohen Wir
kungsgrade der neuen Ventilatoren nicht ausgenutzt werden.
Inzwischen werden die Anforderungen an die Geräuscharmut von
Ventilatoren und der anschließenden Anlagen immer höher. Bei be
stimmten Anwendungen sind diese Forderungen wichtiger als der Wunsch
nach hohen Wirkungsgraden. So war es nötig, den Stoff durch eine
Behandlung dieser akustischen Fragen abzurunden. Die HerrenB. REGEN
SCHEIT u. E. GOEHLICH haben es in dankenswerter Weise übernommen,
den Stand der Technik auf diesem Neuland darzulegen.
Herr Baurat Dip!. Ing. NIERMEYER, Berlin, unterzog die Neuauflage
einer genal.1,ßn Durchsicht, wofür ihm bestens gedankt sei.
Der Springer-Verlag verdient Anerkennung für die Ausstattung,
insbesondere des sehr umfangreichen neuen Abbildungsmateriales.
Köln, im Juli 1961
Bruno Eck
VI Aus dem Vorwort zur dritten und zweiten Auflage
Aus dem Vorwort zur dritten Auflage
Die Neubearbeitung der schnell vergriffenen zweiten Auflage konnte
erst jetzt besorgt werden. In der Zwischenzeit ergaben sich weitere
bemerkenswerte Fortschritte in der Entwicklung der Ventilatoren. Die
Aufwärtsentwicklung der Radialgebläse hat dazu geführt, daß diese nun
mehr den ihnen gebührenden Platz wieder voll einnehmen. Sie stehen in
ihrer Güte noch über den Axialgebläsen. Beachtenswerte Fortschritte
wurden bei der Regulierung erreicht. Auf dem Gebiete der Axialgebläse
sind neue Entwicklungen im Bereiche der meridianbeschleunigten Bau
art zu verzeichnen. Hoffnungsvoll ist auch die Entwicklung des Quer
stromge bläses.
Das heute bereits Erreichte kann dadurch charakterisiert werden,
daß die Ventilatoren, die vor wenigen Jahren noch zu den schlechtesten
Strömungsmaschinen gehörten, inzwischen zu den besten Vertretern
dieser Maschinengruppe aufgerückt sind.
Die in verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgte Hochzüchtung von neuen
Ventilatoren brachte es nun mit sich, daß besondere Probleme, die früher
mehr oder weniger vernachlässigt werden konnten, in den Vordergrund
traten. Um die Vorteile der neuen Ventilatoren voll und ganz auszu
nutzen, muß die Anpassung an die Betriebsbedingungen genauer vorge
nommen werden als früher. Es zeigt sich aber, daß hier ein Problem
vorliegt, welches unerhörte praktische Schwierigkeiten bereitet. Daneben
spielen Meßmethoden, Antriebsfragen, Regelfragen, die Auswahl der
Antriebsmaschine eine viel größere Rolle als früher. Eine besondere Be
handlung dieser Fragen war somit nicht zuvermeiden. Es ist einfach
unmöglich, dem Abnehmer eines Ventilators alle diese Fragen unbeant
wortet zu lassen, zumal hier eine Reihe ungelöster Aufgaben vorliegt.
Köln, im September 1956
Bruno Eck
Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage
Angesichts der stürmischen Entwicklung, in der sich der Ventilatoren
bau befindet, erwies sich eine eingehende Neubearbeitung und Erweite
rung der ersten Auflage als notwendig.
Die in den letzten Jahren erzielten Verbesserungen des Wirkungs
grades von Ventilatoren sind bemerkenswert, ebenso die Tlttsache, daß
das Radialgebläse den Vorsprung, den das Axialgebläse infolge einsei
tiger Hochzüchtung lange behaupten konnte, schnell einzuholen scheint.
Sind doch schon kleine Radial-Niederdruck-Ventilatoren vorhanden,
die bei einer Antriebsleistung von nur 2 kW einen Gesamtwirkungsgrad
Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage VII
von 89% aufweisen. Bedenkt man, daß in Deutschland weit über
1 Mill. kW an Gebläseleistungen installiert sind, so kann man ermessen,
welche Bedeutung der Wirkungsgradverbesserung zukommt.
Zu lange ist der Ventilator als ein Stiefkind der Technik behandelt
worden und hat sich meist nur dann einer öffentlichen, wissenschaftlichen
Förderung erfreut, wenn militärische Anwendungen in Aussicht standen
(z. B. Aufladegebläse, U.Bootgebläse, Axialgebläse usw.). Unter diesen
Umständen wurde die Hauptentwicklungsarbeit von wenigen Firmen
getragen, die teilweise unter größten Aufwendungen und Opfern eigene
Forschungsarbeiten durchführten und hierdurch zu einer gewissen Zu
rückhaltung in ihren Verlautbarungen gezwungen waren, ein Umstand,
der die Berichterstattung erschwert und den Verfasser zu einer stärkeren
Betonung eigener Arbeiten nötigte.
Neben dem Streben nach höchsten Wirkungsgraden darf bei der
Beurteilung des Ventilatorenbaues das sehr große Anwendungsgebiet der
Belüftung von Gebäuden, Schiffen usw. nicht außer acht gelassen werden.
Hier gilt das absolute Primat, Ventilatoren mit kleinster Geräuschbildung
herzustellen, was leider nicht immer mit Höchstwirkungsgraden ver
einbar ist. So kommt es, daß sich vieh~ Bauarten mit schlechtem Wirkungs
grad sehr zähe halten und einen sehr realen technischen Zweck erfüllen.
Daneben sind viele Anwendungsgebiete, z. B. der Apparatebau vorhanden,
wo der kleinste Platzbedarf, die günstigste Einbaumöglichkeit usw. ent
scheidend sind. Auch diese Aufgaben lassen sich nicht immer mit Höchst
wirkungsgraden lösen. Es wurden aber häufig bemerkenwerte Verbesse
rungen erzielt. Bauarten mit hoher Druckziffer behaupten hier souverän
das Feld. Welche Möglichkeiten hier zur Verfügung stehen, erhellt
aus der Tatsache, daß z. B. die Druckziffern von extremen Querstrom
gebläsen etwa 60mal größer sind als diejenigen von extremen Axialläufern.
Köln, im Februar 1952
Bruno Eck
Inhaltsverzeichnis
Seite
A. Radialgebläse . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Elementare Stromfadentheorie. 1
1. Allgemeine Beziehungen 1
2. Radialer Eintritt . . . . . 8
3. Reaktionsgrad . . . . . . 10
Der Gesamtreaktionsgrad 12
4. Kennlinien bei unendlicher Schaufelzahl 13
5. Grundaufgaben . . . . . . . . . . . 17
6. Einfluß der Kompressibilität auf die Gültigkeit der Berech-
nungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Ir. Genauere rechnerische Behandlung der Schaufelströ-
mung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7. Geschwindigkeitsverteilung im Schaufelkanal . 19
8. Kräfte senkrecht zur Strömungsrichtung . 20
9. Kräfte in Strömungsrichtung . 21
10. Relativwirbel. . . . . . . . . . . . . 23
ll. Gerade Schaufeln. . . . . . . . . . . 24
12. Schaufelkanal gleicher Geschwindigkeitsverteilung . 24
13. Schaufelkanal gleichen Querschnittsdruckes . . . . 25
14. Berechnung von Geschwindigkeits-und Druckverteilung in
einem beliebigen Schaufelkanal . . . 26
IH. Einfluß der endlichen Schaufelzahl . 26
15. Grundsätzliches. . . . . . . . . . 26
16. Graphische Ermittlung der Minderleistung. 28
17. Näherungsberechnung nach STODOLA. . . . 30
18. Genauere rechnerische Ermittlung der Minderleistung 32
Minderleistung bei Gebläsen mit hohen Wirkungsgraden. 35
19. Beeinflussung des Reaktionsgrades . . . . . . . . 37
20. Betrachtung über die wirkliche Schaufelströmung . 38
21. Die Schaufelzahl . . . . . . 46
IV. Gestaltung der Schaufelenden 47
22. Die wirkungslose Schaufel . . 47
23. Berücksichtigung der Schaufelstärke . 49
V. Ähnlichkeitsbeziehungen . 50
24. Kennzahlen . . . . 50
25. Optimalkurven . . . 56
26. Weitere Kenngrößen 57
27. Grundformein. . . . 61
28. Gesamtübersicht über die Eigenschaften der verschiedenen
Gebläsetypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Inhaltsverzeichnis IX
Seite
VI. Verluste ...... . 66
29. Radreibungverluste 67
30. Laufradverluste . . 70
31. Stoßverluste . . . 73
a) Laufradeintritt . 73
b) Leitradverluste . 74
32. Spaltverluste . . 75
33. Leitkanalverluste 78
34. Lagerverluste . . 79
35. Wirkungsgrade . 79
a) Der hydraulische Wirkungsgrad 79
b) Volumetrischer Wirkungsgrad 79
c) Mechanischer Wirkungsgrad. . 80
d) Gesamtwirkungsgrad . . . . . 80
e) Änderung des Gesamtwirkungsgrades durch den Anteil
der mechanischen Verluste bei Drehzahländerung . . . 81
36. Thermische Bestimmung des hydraulischen Wirkungsgra-
des . . . . . . . . . . . . . . . . 82
VII. Günstigste Gestaltung des Laufrades 83
37. Fragestellung. . . . . . . . . . . . 83
38. Günstigste Eintrittsbreite b1 . . . • . 84
39. Günstigster Eintrittsdurchmesser, bester Eintrittschaufel-
winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
40. Einfluß der Eintrittskrümmung auf den Optimalwinkel . 89
41. Optimalberechnung bei Vordrall. . . 90
42. Konische oder parallele Deckscheiben 92
43. Bestimmung der Schaufelform 93
a) Die gerade Schaufel. . . . . . . 93
b) Die Kreisbogenschaufel . . . . . 93
c) Ermittlung aus dem Querschnittsverlauf . 94
d) Graphische Ermittlung der Schaufelform 95
VIII. Betrie bseigenschaften von Radialge bl äsen 100
44. Theoretische Kennlinie als Vergleichsbasis . 100
45. Einfluß der endlichen Schaufelzahl auf die Kennlinie. 101
46. Beeinflussung der Kennlinie durch die Reibung . 101
a) Reibung im Schaufelkanal . . . 101
b) Stoßverluste . . . . . . . . . 102
47. Änderung des Breitenverhältnisses 104
Spaltdruckkennlinie . . . . . . 106
48. Besondere Betrachtung bei kleinen Fördermengen. 107
49. 1J!-Verlauf bei Radialrädern . . . . . . 108
IX. Die Haupttypen von Radialgebläsen HO
50. Hochleistungsgebläse . . . . . . . . HO
51. Über 1 liegende statische Umsetzungsgrade bei Radial-
gebläsen . . . . . . . . 119
52. Staubgebläse . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
53. Doppelseitig ansaugende Gebläse . . . . . . . . 127
54. Gestaltung von Trommelläufern (SIROCCo-Läufer) . 129
a) Laufradbreite 129
b) Schaufelform. . . . . . . . . . . . . . . . 130
x
Inhaltsverzeichnis
Seite
c) Schaufelzahl . . . . . . . . 132
d) Reaktionsgrad . . . . . . . 132
e) Eingehendere Betrachtungen. 133
f) Beschaufelung mit beschleunigten Schaufelkanälen 135
g) Versuchswerte von Trommelläufern. . . . . .. 139
55. Radialrad mit Axialvorläufern . . . . . . . . .. 141
X. Zweimal durchströmte Läufer, Querstromgebläse 144
56. Historische Entwicklung des Querstromgebläses . .. 144
57. Allgemeine Gesetzmäßigkeiten bei zweimal durchströmten
Radialgittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
a) Der Reaktionsgrad w • . . . . . . . . • . . . . . 151
b) Wahl des Durchmesserverhältnisses und des Schaufel-
winkels . . . . . . . . . . . . . . . . 151
58. Die Wirbelbewegung in Inneren des Laufrades. 152
59. Wirbelsteuerung . . . . . . . . . . . . . 155
Die Radströmung bei der Förderung Null. . 159
60. Gestaltung des Diffusors von Querstromgebläsen . 159
61. Theoretische und tatsächliche Kennlinie . . . . 161
62. Kennlinien, Wirkungsgrade, Aufwertung, Anwendungs-
beispiele . . . . . . . . . 162
a) Anwendungsbeispiele . . . . . . . 164
b) Querstromtrommelläufer. . . . . . 167
63. Die Durchströmung von freien Läufern. 168
64. Das Schwingschaufelrad 170
XI. Leitvorrichtungen 172
65. Leitschaufeln. . . 173
66. Austauschwirkung . 175
67. Spiralgehäuse . . . 176
a) Grundsätzliches 176
b) Konstruktion von Spiralen ohne Berücksichtigung der
Reibung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
a) Parallele Seitenwände S. 178. - ß) Parallele Seiten
y)
wände, die breiter als das Laufrad sind S. 179. - Ko
nische Seitenwände S.180. - 15) Rechteckige Quer
schnitte S. 181. - s) Kreisförmiger Querschnitt S. 182.
-~) Innenspirale S. 183. - 'fJ) Axiale Spirale S. 185. -
f}) Schneckenspirale S. 185. - L) Spiralgehäuse für
Axialgebläse S. 186. - ,,) Schneckenförmige Ausbildung
von Spiralgehäusen S. 186. - Ä) Unterteilte Spiralge
häuse S. 187. - {L) Spiralgehäuse mit verstellbarer Zun-
ge S. 188. - v) Spiralgehäuse mit mehreren Abführun·
gen S. 189.-';) Graphische Verfahren S. 192.
c) Exaktes Verfahren ................ 192
d) Näherungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . 194
68. Einfluß der Reibung in Spiralen auf den Gesamtenergie-
umsatz ....................... 195
69. Drallabnahme durch Reibung in Ringräumen und glatten
Leitringen . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
70. Verhalten der Spirale bei Belastungsänderungen . . 201
71. Der Zungenabstand . . . . . . . . . . . . . . 203
72. Radialkraft und Druckverteilung im Spiralgehäuse . 204