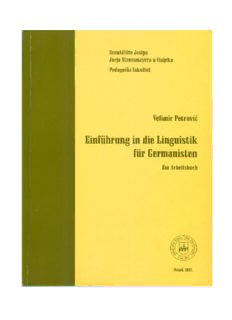Table Of ContentVelimir Petrović / EINFÜHRUNG IN DIE LINGUSTIK
FÜR GERMANISTEN
EIN ARBEITSBUCH
Nakladnik
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pedagoški fakultet
Za nakladnika
Ana PINTARIĆ
Recenzenti
Mario BRDAR
Stanko ŽEPIĆ
Lektor
Anke LUKOSCHAT
Suglasnost Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku br. 17/01
Tisak
Tiskara i knjigovežnica Pedagoškog fakulteta u Osijeku
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 285637
ISBN 953-6456-20-6
ć
Velimir Petrovi
Einführung in die Linguistik
für Germanisten
Ein Arbeitsbuch
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pedagoški fakultet
Osijek, 2001.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort …………………………………………………………….... V
0. Zum Gegenstand der Linguistik…………………………………. 1
1. Sprache – was ist das? …………………………………………... 5
2. Körpersprache: Gesichtsausdruck und Körperzeichen …………. 10
3. Das sprachliche Zeichen ……………………………….………... 12
3.1 Die Merkmale des sprachlichen Zeichens ………………….. 14
3.2 Der Sprachwandel …………………………………………... 19
3.3 Denotative und konnotative Bedeutung ……………………. 25
3.3.1 Bedeutungswandel…………………………………. 26
3.3.1.1 Bedeutungserweiterung ……………………….. 28
3.3.1.2 Bedeutungsverengung …………………………. 29
3.3.1.3 Bedeutungsverbesserung ………………………. 29
3.3.1.4 Bedeutungsverschlechterung ………………….. 29
3.3.2 Kollokation ………………………………………… 29
4. Sprache als Kommunikationsmittel …………………………….. 30
5. Natürliche Sprachen, Fachsprachen und künstliche Sprachen …. 36
5.1 Stilschichten ………………………………………………… 42
5.2 Zur Geschichte der deutschen Nationalsprache …….………. 46
5.3 Die Lautverschiebung ………………………………………. 49
5.4 Nationale Varianten des Deutschen …………………….….. 50
5.4.1 Die Schweizer Sprachvariante …………………..… 50
5.4.2 Die österreichische Sprachvariante ………………… 51
5.5 Deutsche Mundarten ………………………………………... 52
6. Die Einteilung der Sprachen der Welt ………………………….. 61
7. Der Wortschatz …………………………………………………. 66
7.1 Arten der Wörterbücher ……………………………………. 68
7.2 Zur Bereicherung des Wortschatzes ……………………….. 71
7.2.1 Übernahme aus fremden Sprachen ………………… 71
7.2.1.1 Einfache Übernahme ………………………….. 71
7.2.1.2 Lehnbildungen ………………………………… 72
7.2.2 Der Sprachpurismus ……………………….………. 75
8. Zum Begriff Grammatik ………………………………………… 77
8.1 Die normative Grammatik…………………………………… 81
8.2 Die deskriptive Grammatik …………………………………. 81
8.3 Die funktionale Grammatik …...……………………………. 84
8.4 Konstituentenstrukturgrammatik …………………………… 87
8.5 Die generative Transformationsgrammatik ………………… 89
8.6 Die Dependenzgrammatik ………………………………….. 97
V
9. Phonetik und Phonologie ……………………………………….. 105
9.1 Artikulatorische Phonetik …………………………….…….. 105
9.1.1 Bildung der Sprachlaute …………………………… 105
9.1.2 Ermittlung der Sprachlaute durch Segmentierung … 106
9.1.3 Deutsche Laute und ihre Schreibung ………………. 106
9.1.3.1 Klassifizierung der Vokale …………………….. 107
9.1.3.2 Klassifizierung der Konsonanten ……………… 109
I. Nach der Artikulationsstelle ………………. 109
II. Nach der Art des Hindernisses ……………. 109
III. Nach der Stimmhaftigkeit …………….…… 110
9.2 Phonologie ………………………………………………….. 114
9.2.1 Ermittlung der Phoneme …………………………… 115
9.2.1.1 Relation zwischen Phonemen und Graphemen ... 118
9.2.2 Die deutsche Schrift ……………………………….. 120
9.3 Suprasegmentale Merkmale ………………………………… 121
10. Morphologie …………………………………………………….. 123
10.1 Semantische Klassifizierung der Morpheme ……………. 126
11. Semantik ………………………………………………….……. 130
11.1 Lexikalische Hierarchie …………………………………. 132
11.2 Asymmetrie des Sprachzeichens ………………………… 134
11.2.1 Homonymie ………………………………………… 134
11.2.2 Synonymie ………………………………………….. 135
11.2.3 Polysemie …………………………………………... 136
Glossar ………………………………………………………………. 140
Literaturverzeichnis – eine Auswahl ………………………………… 156
Quellenverzeichnis …………………………………………………... 158
VI
Vorwort
Dieses Arbeitsbuch ist aus einem zweisemestrigen Grundkurs
hervorgegangen, der als Pflichtkolleg im 3. und 4. Semester des
Germanistikstudiums an der Pädagogischen Fakultät der Universität Osijek
mit 1 Wochenstunde durchgeführt wird. Sein Ziel ist es, dem Benutzer eine
unentbehrliche Grundlage zu vermitteln, die ihm das Lesen entsprechender
Literatur erleichtern sollte. Die allgemeingültigen sprachlichen Erscheinun-
gen, die kommunikative Funktion der Sprache und von unterschiedlichen
Theorien ausgehende Versuche, Einzelsprachen zu beschreiben, werden am
Beispiel des Deutschen erläutert. Das im Rahmen dieses ersten Einstiegs in
die allgemeine linguistische Problematik erworbene Wissen wird durch
daran anschließende Wahlkurse in Textlinguistik und Sprechakttheorie
erweitert.
Das Theoretische wird von einem reichhaltigen Übungsangebot
begleitet. Damit wird dem Studierenden die Möglichkeit gegeben, die
erworbenen Kenntnisse bei der Lösung unterschiedlicher Aufgaben zu
festigen. Zur Festigung des Erworbenen soll auch das hinzugefügte Glossar
dienen.
Das Literaturverzeichnis enthält nur eine Auswahl von vielen
nützlichen Werken. Bei seiner Zusammenstellung wurde darauf geachtet,
dass die darin angeführten Einführungswerke die sprachliche Kompetenz des
Studierenden, der kein Muttersprachler des Deutschen ist, nicht zu sehr
belasten. Der sich für die Sprache, ihr Funktionieren und die Beschreibung
der Sprachsysteme interessierende Benutzer wird bei der Lektüre der
ausgewählten Bücher weitere Anregungen finden.
Osijek, im Januar 2001 Velimir Petrović
VII
0. Zum Gegenstand der Linguistik
0.1 Das Wort Linguistik führt auf das lateinische Wort lingua ’Spra-
che’ zurück. Es wird heute in deutschsprachiger Fachliteratur meist so
umfassend gebraucht wie der Begriff linguistics in englischen und linguis-
tique in französischen Texten. Linguistik und Sprachwissenschaft gelten
also als Synonyme, was Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre nicht der
Fall war. Damals wurde unter diesem Begriff – im Unterschied zu der
traditionellen, d. h. diachronischen Sprachwissenschaft – die sogenannte
moderne, synchronisch orientierte Sprachwissenschaft verstanden.
0.2 Gegenstand der Linguistik ist die menschliche Sprache, vor allem
die Beschreibung ihrer inneren Struktur und kommunikativen Funktion.
Das tut sie, indem sie als empirische und zugleich theoretische Wissen-
schaft den Gebrauch der Sprache beobachtet, Belege sammelt, sie unter-
sucht und auf Grund einer bestimmten Theorie zu erklären versucht.
0.3 Je nachdem, unter welchem Aspekt sprachliche Erscheinungen
beobachtet und beschrieben werden und ob dabei die Sprache als Ganzes
oder in ihren Teilsystemen als Untersuchungs- und Beschreibungsobjekt
fungiert, unterscheidet man mehrere Arten bzw. Teildisziplinen der
Linguistik. Hier nur einige mit Angabe des Hauptziels:
• Allgemeine Linguistik untersucht und beschreibt vor allem das
Allgemeingültige in allen natürlichen Sprachen, um zu erklären, was eine
natürliche Sprache ist, wie sie funktioniert und welchen Einfluss die
Gesellschaft auf sie ausübt.
• Angewandte Linguistik erforscht die Anwendungsmöglichkeiten
linguistischer Erkenntnisse und Methoden im Bereich der Sprachdidaktik,
Übersetzungstechnik, Werbung, Computerlinguistik, Sprechwissenschaft,
der linguistischen Stilistik.
• Computerlinguistik hat zum Ziel: maschinelle Verarbeitung und
Beschreibung, Dokumentierung sprachlichen Materials mit elektronischen
Mitteln, z. B. mit Hilfe der maschinellen Übersetzung.
• Deskriptive Linguistik wird durch die positivistisch-mechanistische
Auffassung der Sprachbeschreibung gekennzeichnet. Als Hauptziel der
Sprachwissenschaft betrachtet sie das Auffinden der Grammatik einer
Sprache aus einem gegebenen Korpus von Sätzen, schließt aber die
Untersuchung der Bedeutung aus. So reduziert sie den Gegenstands- und
Aufgabenbereich der Sprachwissenschaft auf die Segmentierung und
1
Klassifizierung der akustisch oder graphisch gegebenen sprachlichen
Einheiten auf Grund ihrer Distribution und Austauschbarkeit in festgelegter
Serie von Prozeduren. Positive Ergebnisse der deskriptiven Linguistik sind
vor allem die Distributions- und Konstituentenanalyse sowie das Substitu-
tionsverfahren.
• Diachronische, dynamische od. historische Linguistik untersucht
eine Sprache durch den Vergleich der historischen Entwicklung ihrer
Einzelelemente oder durch den Vergleich ihrer Systeme oder Teilsysteme
in verschiedenen Epochen ihrer Existenz.
• Ethnolinguistik (auch anthropologische Linguistik genannt) er-
forscht die Beziehungen zwischen Sprache und Kultur. Sie interessiert sich
besonders für die Sprachen „primitiver“ Kulturen.
• Feldlinguistik beschäftigt sich mit dialektologischen, ethno- und
soziolinguistischen Aspekten von noch nicht verschrifteten Sprachen.
Dabei geht sie von einem durch Informantenbefragung gewonnenen
Korpus aus.
• Interlinguistik erforscht künstliche Sprachen (Welthilfssprachen)
auf ihre Verwendbarkeit hin. Die Welthilfssprachen wie z. B. Esperanto
sind auf Grund von universellen Eigenschaften konstruiert, die durch
umfassenden Vergleich bekannter Sprachen aufgefunden sind.
• Kontrastive Linguistik hat zum Ziel Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen zwei oder mehr Sprachen auf allen Sprachebenen
festzustellen, indem sie ihre phonetischen, phonologischen, morphologi-
schen, syntaktischen, semantischen und lexikalischen Eigenschaften
miteinander systematisch vergleicht. Ergenbisse der kontrastiven Unter-
suchungen sind u. a. kontrastive Grammatiken, in denen gewöhnlich je
zwei Sprachen kontrastiv beschrieben werden.
• Patholinguistik (Sprachpathologie) untersucht sprachlich abnormes
Verhalten, das sich vor allem in Form von Aphasie ( = verschiedene Stö-
rungen der Sprechfähigkeit und des Sprachverständnisses) und Agraphie (=
Verlust des Schreibvermögens) äußert.
• Pragmalinguistik ist soziologisch und psychologisch orientiert. Sie
begreift die Sprache als Sonderfall gesellschaftlichen Handelns und
versucht sprachliche Zeichen und daraus entstandene Konstruktionen in
Verbindung mit kommunikativ relevanten Faktoren wie Intention, Bezie-
hung zum Gesprächspartner, situativer Kontext, psychische Verfassung des
Sprechers/Hörers usw. im Sprachkommunikationsprozess zu beschreiben.
• Psycholinguistik beschäftigt sich mit den psychologischen Grund-
lagen der Sprache und des Sprechens, erforscht die Rolle psychologischer
Faktoren bei dem Spracherwerb, bei der Verwendung und Perzeption der
2
Sprache im Kommunikationsprozess sowie bei unterschiedlichen Sprach-
störungen und dem Sprachverlust, beschreibt die Beziehungen zwischen
Sprechen und Denken.
• Soziolinguistik untersucht u. a. die soziale Bedingtheit des aktuel-
len Sprachverhaltens, den Sprachgebrauch einzelner Sozialschichten, durch
Gruppensprachen verursachte Kommunikationsbarrieren, Möglichkeiten
einer Nivellierung der sozial bedingten Unterschiede in der Beherrschung
der Standardsprache.
• Synchronische Linguistik hat zum Ziel, sprachliche Erscheinungen
in einem bestimmten Zeitraum zu untersuchen und zu beschreiben, ohne
irgendwelche Vergleiche mit früheren oder späteren Entwicklungsstadien
zu ziehen.
• Textlinguistik befasst sich mit dem Aufbau und den inneren
Zusammenhängen von Texten.
0.4 Zu den Hauptgebieten der Linguistik gehören: Phonetik, Phono-
logie, Morphologie, Syntax, Semantik und Lexikologie. Ihr Untersu-
chungsgegenstand sind Teilsysteme des jeweiligen Sprachsystems, die
sowohl synchronisch als auch diachronisch untersucht und beschrieben
werden können, wie es im folgenden von Ullmann (1972: 36) übernom-
menen, teilweise veränderten dreidimensionalen Diagramm gezeigt wird:
c
Phonetik/Phonologie Stadium c
b
Lexikologie Stadium b
a
Syntax Stadium a
Morpho- Seman-
logie tik
Synchronische Untersuchung: Stadium a oder b oder c ohne Vergleich
Diachronische Untersuchung: Stadium a und b und c im Vergleich
Für die Phonetik bzw. Phonologie ist nur ein Block im Diagramm vor-
gesehen, weil ihr Untersuchungsgegenstand sprachliche Zeichen sind, die
nur eine bestimmte Form, aber keine Bedeutung haben. Phonetik unter-
3
Description:VII. Vorwort. Dieses Arbeitsbuch ist aus einem zweisemestrigen Grundkurs .. Unter dem Begriff das sprachliche Zeichen wird meist eine intentional.