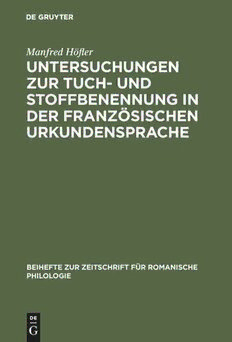Table Of ContentBEIHEFTE ZUR
ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
BEGRÜNDET VON GUSTAV GRÖBER
FORTGEFÜHRT VON WALTHER VON WARTBURG
HERAUSGEGEBEN VON KURT BALDINGER
II. HEFT
4
Manfred Höfler
Untersuchungen
zur Tuch- und Stoffbenennung in der
französischen Urkundensprache
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1967
Untersuchungen
zur Tuch- und Stofibenennung in der
französischen Urkundensprache
Vom Ortsnamen zum Appellativum
von
Manfred Höfler
MAX NIEMEYER VERLAG TÜBINGEN
1967
Die vorliegende Arbeit wurde 1965 von der Philosophischen Fakultät
der Universität Heidelberg als Dissertation angenommen
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
© Max Niemeyer Verlag Tübingen 1967
Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany
Satz und Druck von Poppe Sc Neumann, Graph. Betrieb, Konstanz
Einband von Heinr. Kodi» Tübingen
Vorwort
Die vorliegende Untersuchung verdankt ihr Entstehen einer Anregung meines
verehrten Lehrers, Herrn Prof. Kurt Baldinger, der schon vor Jahren meine
Aufmerksamkeit auf das noch weitgehend unerforschte Gebiet der franzö-
sischen Textilterminologie lenkte. Wertvolle Hinweise steuerte auch Herr
Prof. Bodo Müller bei. Ihm und allen meinen akademischen Lehrern sei an
dieser Stelle mein aufrichtiger Dank ausgesprochen. Besonders verpflichtet
bin ich Herrn Prof. Walther von Wartburg für die Bereitstellung der noch
unveröffentlichten Materialien des Französischen Etymologischen Wörter-
buchs sowie Herrn Robert Harsch-Niemeyer für die verständnisvolle ver-
legerische Betreuung. Danken möchte ich auch Frau Gisela Möller-Pantleon
für die mühsame Arbeit des Korrekturenlesens.
Vielfältigen Dank schulde ich Herrn Prof. Kurt Baldinger. Er hat mir die
umfangreichen Materialien seines in Vorbereitung befindlichen onomasio-
logischen Wörterbuchs der altgaskognisdien Urkundensprache zur Verfügung
gestellt und meine Arbeit in die Reihe der von ihm herausgegebenen Beihefte
zur Zeitschrift für romanische Philologie aufgenommen. Vor allem aber hat
er in mir das Verständnis für linguistische Fragestellungen geweckt, mich stets
mit seiner nie versagenden Hilfe begleitet und so das Zustandekommen dieser
Arbeit überhaupt erst ermöglicht.
Heidelberg, im Juli 1967 Manfred Höfler
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG i
ERSTER TEIL
FRANZÖSISCHE STOFFBEZEICHNUNGEN
1. Flandern und Niederlande 4
2. England 33
3. Nordfrankreich 48
4. Bretagne 67
5. Südfrankreich 79
6. Pyrenäenhalbinsel 83
7. Orient 87
8. Italien 105
9. Deutschland 110
ZWEITER TEIL
VOM ORTSNAMEN ZUM APPELLATIVUM
EIN PROBLEM DER WORTBILD UNG S LE HR E
1.Die Entwicklung vom Ortsnamen zum Appellativum . . . . 116
2. Der periphrastische Typus 121
3. Entlehnung oder eigenständige Bildung? 124
4. Die Verkürzung des periphrastischen Typus 127
5. Das Problem der Lexikalisierung 128
6. Lexikalisierung des periphrastischen Typus 133
7. Zusammenfassung 136
LITERATURVERZEICHNIS 137
ORTSNAMENREGISTER 151
WORTREGISTER 152
Einleitung
Die Textilindustrie ist einer der bedeutendsten Zweige der Wirtschafts-
geschichte des Mittelalters. Inventare und Testamente, Rechnungsbücher und
Zolltarife sowie die zahlreichen uns überlieferten Statuten zeugen in gleicher
Weise von der besonderen Beachtung, die diesem zentralen Lebensbereich zu
allen Zeiten geschenkt wurde. So ist auch die Literatur zu diesem Fragen-
komplex reich an Arbeiten kulturgeschichtlicher wie sprachhistorischer Art.
Schon früh entwickelte sich in Frankreich und den daran anschließenden
Gebieten Flanderns eine Textilindustrie, die sehr rasch über die Grenzen
hinaus zu internationaler Bedeutung gelangte. Der grundlegende sprach-
geschichtliche Beitrag zur flandrischen Tuchfabrikation ist das dreibändige
Werk von GUY DE POERCK, La draperie médiévale en Flandre et en Artois.
Technique et terminologie, Brugge 19$ i, in dem de Poerck das gesamte fach-
sprachliche Vokabular der flandrischen Textilindustrie des Mittelalters unter-
sucht, wobei neben dem Altfranzösischen auch das Flämische Berücksich-
tigung findet. Im Gegensatz dazu beschränkt sich KURT ZANGGER in seiner
1945 erschienenen Zürcher Dissertation Contribution à la terminologie des
tissus en ancien français, Bienne 1945 auf die Behandlung einer Reihe alt-
französischer Stoff- (meist Tuch-)bezeichnungen, wobei er den geographi-
schen Rahmen weiter als de Poerck spannt, indem er neben altfranzösischen
und altprovenzalischen Stoffbezeichnungen auch die italienischen, spanischen,
deutschen und mittellateinischen Entsprechungen untersucht. Doch abgesehen
von der oft recht zufälligen Auswahl der behandelten Termini geht auch
seine Darstellung im wesentlichen nicht über eine reich dokumentierte Ma-
terialsammlung hinaus1. Daneben bestehen zahlreiche vorwiegend etymo-
logisch orientierte kleinere Arbeiten über einzelne Stoffbezeichnungen, von
denen vor allem die Untersuchung von WECKERLIN ZU fr. écarlate durch die
geschickte Verbindung von Sach- und Wortgeschichte besondere Beachtung
verdient2.
Doch beschränkt sich die mittelalterliche Textilindustrie keineswegs auf
die gewiß im Vordergrund stehende Tuchfabrikation Flanderns. Ohne des-
1 Cf. auch die Kritik von Carlo Consiglio in RFE 30,171-176. - Nicht eingesehen
wurde die noch unveröffentlichte Dissertation vonNANNY v. SCHULTHESS-ULRICH,
Romanische und orientalische Gewebebezeichnungen, Diss. Zürich 1957.
2 J.-B. Weckerlin, Le drap 'escaríate' au moyen âge. Essai sur l'étymologie et la
signification du mot écarlate et notes techniques sur la fabrication de ce drap de
laine au moyen âge, Lyon 1905.
I
sen Bedeutung zu erreichen, ist auch Paris ein wichtiges Zentrum der Tuch-
industrie und zählt zu den villes drapantes, die in der Hanse von London
zusammengeschlossen sind3. Ein Blick auf die Rôles de la Taille von 1292
und 1300 genügt, um ihre hervorragende Stellung innerhalb der gesamten
Industrie und des Handels jener Zeit aufzuzeigen. 1292 finden wir in Paris
unter den bedeutendsten Berufsgruppen nicht weniger als 14 brodeeurs und
broderesses, 19 drapiers (marchands de draps), 8 fileresses de soie, 24 fou-
lons, ij teinturiers, 11 teliers (tisserands de toiles), 82 tisserands und tisse-
randes sowie 20 tondeurs. In der Steuerrolle von 1300 erhöhen sich diese
Zahlen auf 23 brodeurs, 56 drapiers, 36 fileresses de soie, 83 foulons, 33
teinturiers, 9 tisserands de toiles, 360 tisserands und 3 6 tondeurs. Neu hinzu
kommen im Jahr 1300 noch 46 ouvriers und ouvrières de soie4. Das gleiche
Bild ergibt sich 1313, wo die Textilarbeiter gleichfalls den größten Anteil
aller Berufsgruppen stellen5. Die tisserands und drapiers beschränken sich
nicht auf die Herstellung der Stoffe, in ihren Händen liegt auch der Handel
auf den großen Märkten Europas. So werden Tuche aus Paris im Dit du
Lendit rimé6 aus dem 14. Jh. ebenso wie auf den Märkten der Champagne
erwähnt7. Im Gegensatz dazu ist der Handel mit Seidenstoffen ein Privileg
der merciers. Nach ihren ersten Statuten aus dem Jahr 1324 scheint ihre
Aufgabe zunächst nur im Handel mit Seide und Seidenstoffen zu liegen,
doch kommen bald auch Woll- und Baumwollstoffe hinzu, die sie in Paris
verkaufen8. Während die Tuche zu jener Zeit vorwiegend aus Flandern
kamen, wurden die Seidenstoffe vor allem aus Italien und dem Orient im-
portiert9. Zum Teil wurde die Seide aber auch in Ballen aus dem Orient
geliefert und erst in Frankreich zu Stoffen verarbeitet10. Doch konnte sich
dieser Zweig der Textilherstellung erst sehr viel später gegen das starke
Obergewicht des direkten Imports behaupten.
In der vorliegenden Untersuchung soll nur ein kleiner Ausschnitt aus dem
weiten Gebiet der französischen Stoffbezeichnungen11 dargestellt werden.
Bei der Auswahl des zu berücksichtigenden Wortmaterials haben wir uns
von folgenden Gesichtspunkten leiten lassen. Zum einen beschränken wir
uns ebenso wie Zangger und de Poerck auf nichtliterarische Texte12, zum
3 FagniezEt i;jf.; allerdings fehlt Paris in der Liste der 22 villes drapieres der
Hanse von London aus der Mitte des 13. Jhs., abgedruckt bei FagniezDoc i,20jf.
4 Nach FagniezEt jfl. 5 Ib. 20.
6 FagniezDoc 2,i73ff. 7 FagniezEt 20.
8 S. dazu die Statuten der merciers in LespMet 2,232-285.
9 S. dazu besonders MichEt passim.
10 S. dazu EBoileau 66S.; LespMet 2,289s.
11 Unter der Bezeichnung 'Stoff' werden im folgenden ausschließlich Gewebe ver-
standen, während Wirkwaren ebenso wie Spitzen unberücksichtigt bleiben.
12 Doch werden die uns aus Wörterbüchern und der Sekundärliteratur zugäng-
lichen Belege aus der Literatursprache, soweit sie unserer Fragestellung förderlich
sind, stets herangezogen werden. Auf eine systematische Exzerption literarischer
Texte wurde jedodi bewußt verzichtet.
2