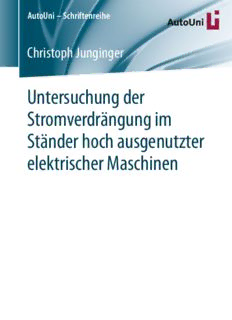Table Of ContentAutoUni – Schriftenreihe
Christoph Junginger
Untersuchung der
Stromverdrängung im
Ständer hoch ausgenutzter
elektrischer Maschinen
AutoUni – Schriftenreihe
Band 96
Herausgegeben von/Edited by
Volkswagen Aktiengesellschaft
AutoUni
Die Volkswagen AutoUni bietet Wissenschaftlern und Promovierenden des Volks
wagen Konzerns die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse in Form von Mono
graphien und Dissertationen im Rahmen der „AutoUni Schriftenreihe“ kostenfrei zu
veröffentlichen. Die AutoUni ist eine international tätige wissenschaftliche Einrich
tung des Konzerns, die durch Forschung und Lehre aktuelles mobilitätsbezogenes
Wissen auf Hochschulniveau erzeugt und vermittelt.
Die neun Institute der AutoUni decken das Fachwissen der unterschiedlichen
Geschäftsbereiche ab, welches für den Erfolg des Volkswagen Konzerns unabding
bar ist. Im Fokus steht dabei die Schaffung und Verankerung von neuem Wissen und
die Förderung des Wissensaustausches. Zusätzlich zu der fachlichen Weiterbildung
und Vertiefung von Kompetenzen der Konzernangehörigen, fördert und unterstützt
die AutoUni als Partner die Doktorandinnen und Doktoranden von Volkswagen
auf ihrem Weg zu einer erfolgreichen Promotion durch vielfältige Angebote – die
Veröffentlichung der Dissertationen ist eines davon. Über die Veröffentlichung in der
AutoUni Schriftenreihe werden die Resultate nicht nur für alle Konzernangehörigen,
sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich.
The Volkswagen AutoUni offers scientists and PhD students of the Volkswagen
Group the opportunity to publish their scientific results as monographs or
doctor’s theses within the “AutoUni Schriftenreihe” free of cost. The AutoUni is an
international scientifc educational institution of the Volkswagen Group Academy,
which produces and disseminates current mobilityrelated knowledge through its
research and tailormade further education courses. The AutoUni‘s nine institutes
cover the expertise of the different business units, which is indispensable for the
success of the Volkswagen Group. The focus lies on the creation, anchorage and
transfer of knew knowledge.
In addition to the professional expert training and the development of specialized
skills and knowledge of the Volkswagen Group members, the AutoUni supports and
accompanies the PhD students on their way to successful graduation through a
variety of offerings. The publication of the doctor’s theses is one of such offers. The
publication within the AutoUni Schriftenreihe makes the results accessible to all
Volkswagen Group members as well as to the public.
Herausgegeben von/Edited by
Volkswagen Aktiengesellschaft
AutoUni
Brieffach 1231
D38436 Wolfsburg
http://www.autouni.de
Christoph Junginger
Untersuchung der
Stromverdrängung
im Ständer hoch
ausgenutzter
elektrischer Maschinen
Christoph Junginger
Wolfsburg, Deutschland
Zugl.: Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2016
Die Ergebnisse, Meinungen und Schlüsse der im Rahmen der AutoUni – Schriftenreihe
veröffentlichten Doktorarbeiten sind allein die der Doktorandinnen und Doktoranden.
AutoUni – Schriftenreihe
ISBN 9783658170066 ISBN 9783658170073 (eBook)
DOI 10.1007/9783658170073
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen und MarkenschutzGesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Die Anschrift der Gesellschaft ist: AbrahamLincolnStr. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Vorwort
Die Arbeit in der Entwicklung E-Antriebe in Kassel hat mir viel Freude bereitet. Ich
konnte dort in einer spannenden Phase viel von meinen aufgeschlossenen und freundli-
chen Kollegen lernen.
Besonderen Dank schulde ich Prof. Dr. Bernd Ponick, der sich bereit erklärt hat, mein
Promotionsvorhaben zu betreuen. Er trug durch zahlreiche fachliche Diskussionen zum
Gelingen dieser Arbeit bei, gab mir wichtige Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten
und ermöglichte mir diese für mich wichtige Erfahrung.
Dr. Gerd Stöhr hat mich während meines Promotionsvorhabens hervorragend betreut
und mir den notwendigen Freiraum für eine erfolgreiche Umsetzung eingeräumt. Für die
Lösung auftretender Probleme hat er schnell und unkompliziert gesorgt. Darüber hinaus
hatte ich durch ihn die Gelegenheit, Teile der in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse auf
internationalen Konferenzen vorzustellen und zu diskutieren. Daran durfte ich wachsen.
Herrn Prof. Dr.-Ing. Andreas Möckel danke ich für das der Arbeit entgegengebrachte
Interesse und die Übernahme des Koreferats. Des Weiteren danke ich Prof. Dr.-Ing. Axel
Mertens für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission.
Zuletzt bedanke ich mich noch bei meiner gesamten Familie, die mich immer unterstützt.
Auch bei meinem Promotionsvorhaben stand sie mir mit Rat und Tat zur Seite und hat mir
den Rücken frei gehalten.
Allen Genannten und auch allen anderen Kollegen, mit denen ich während meines Promo-
tionsvorhabens zu tun hatte, danke ich ganz herzlich für die vielen wertvollen Begegnun-
gen und Einblicke sowie für die Unterstützung, die sie mir gewährt haben.
Christoph Junginger
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ......................................................................................... IX
Tabellenverzeichnis ............................................................................................. XV
Formelzeichenverzeichnis .............................................................................. XVII
1 Einleitung ............................................................................................................1
1.1 Motivation und Zielsetzung ........................................................................... 1
1.2 Aufbau der Arbeit ......................................................................................... 2
1.3 Stand der Technik ......................................................................................... 4
1.3.1 Chronologische Darstellung ................................................................ 4
1.3.2 Sachbezogene Darstellung ................................................................. 10
2 Grundlagen .......................................................................................................13
2.1 Stromverdrängung....................................................................................... 13
2.1.1 Verhältnisse ohne Stromverdrängung ................................................. 13
2.1.2 Maxwell-Gleichungen ....................................................................... 14
2.1.3 Eigenschaften des magnetischen Kreises ............................................ 15
2.1.4 Analytische Berechnung.................................................................... 17
2.1.5 Begriffserklärungen und -abgrenzungen zur Stromverdrängung .......... 19
2.2 Permanenterregte Synchronmaschinen ......................................................... 20
2.2.1 Einsatz als Traktionsantrieb in automobilen Hybridantrieben .............. 21
2.2.2 Verlustbetrachtung ............................................................................ 22
2.2.3 Einflüsse auf den Polradwinkel .......................................................... 22
2.2.4 Wickelschema .................................................................................. 25
2.2.5 Kupferfüllfaktor ................................................................................ 25
2.3 Finite-Elemente-Berechnung ....................................................................... 26
3 Vergleich des Widerstandserhöhungsfaktors .............................................29
3.1 Für den Vergleich verwendete E-Maschine .................................................. 29
3.2 Analytische Bestimmung ............................................................................. 31
3.3 Bestimmung mittels Finite-Elemente-Methode ............................................. 33
3.4 Messungen auf dem Prüfstand ..................................................................... 35
3.5 Ergebnisse .................................................................................................. 38
3.6 Einfluss des Permanentmagnetfelds ............................................................. 41
4 Voruntersuchung zur Abweichung des analytischen Verfahrens ...........43
4.1 Vorüberlegungen ........................................................................................ 43
4.2 Untersuchungsmethode und Finite-Elemente-Modell .................................... 45
4.3 Durchgeführte Voruntersuchungen .............................................................. 47
4.3.1 Betrachtung des Nutstreufelds ........................................................... 47
4.3.2 Abgleich des Widerstandserhöhungsfaktors ....................................... 48
4.3.3 Einfluss der Nuttiefe auf das Nutstreufeld .......................................... 50
4.3.4 Einfluss der Nuttiefe auf den Widerstanderhöhungsfaktor ................... 52
4.3.5 Einfluss der Nuthöhe und -breite auf das Nutfeld................................ 53
VIII Inhaltsverzeichnis
4.4 Erkenntnisse aus Voruntersuchungen ........................................................... 54
5 Magnetische Sättigung ....................................................................................55
5.1 Grundlegende Zusammenhänge ................................................................... 55
5.1.1 Verminderung der Querfeldkomponente ............................................ 56
5.1.2 Zusätzliche Längsfeldkomponente durch Entlastung ........................... 56
5.2 Untersuchung anhand von Finite-Elemente-Rechnungen............................... 58
5.2.1 Modifikation des Grundmodells......................................................... 59
5.2.2 Mit Finite-Elemente-Rechnungen durchgeführte Untersuchungen ....... 59
5.2.3 E-Maschine mit gegossenen Spulen ................................................... 69
5.3 Ableitung analytischer Nährung ................................................................... 71
5.3.1 Verminderung der Querfeldkomponente ............................................ 72
5.3.2 Zahnentlastungsfeld – Entstehen einer Längsfeldkomponente ............. 75
5.4 Zusammenfassung des Kapitels ................................................................... 81
6 Phasenverschobene Spulenströme in einer Nut ..........................................83
6.1 Vorüberlegungen ........................................................................................ 83
6.2 Betrachtung mittels Finite-Elemente-Rechnungen ........................................ 85
6.2.1 Einfluss auf das Nutfeld .................................................................... 86
6.2.2 Einfluss auf die Stromverdrängung .................................................... 87
6.2.3 E-Maschine mit gegossenen Spulen ................................................... 90
6.3 Ableitung analytischer Erkenntnisse ............................................................ 91
7 Wechselwirkung mit dem Luftspaltfeld .......................................................97
7.1 Einfluss des Feldschwächbereichs und der Schrägung................................... 97
7.2 Einfluss des Konstantflussbereichs und der Schrägung................................ 102
7.3 Drehmomentbildung und Zusammenfassung .............................................. 107
8 Schlussbetrachtung....................................................................................... 109
9 Literaturverzeichnis ..................................................................................... 111
Anhang ................................................................................................................. 115
Anhang A: Widerstandsbestimmung gegossener Spulen ....................................... 115
Anhang B: Messunsicherheit der kr-Faktor-Bestimmung ....................................... 116
Anhang C: Bestimmung der Magnetverluste mittels 3D-FEM ............................... 121
Anhang D: Ermittlung der Reib- und Eisenverluste ............................................... 122
Anhang E: Einfluss des Nuthöhe-zu-Nutbreite-Verhältnisses auf das Nutfeld......... 124
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1-1: Aufbau der Arbeit .................................................................................... 3
Abb. 2-1: Der analytisch geschlossenenen Berechnung der Stromverdrängung
zugrunde liegendes Modell einer Nutteilung............................................ 18
Abb. 2-2: Beispiel eines Drehzahl-Drehmomenten-Kennfelds im motorischen
Bereich mit Spitzenmoment- und Dauermoment-Kennlinie sowie dem
NEFZ-relevanten Bereich ....................................................................... 21
Abb. 2-3: Entstehung des resultierenden Moments in Abhängikeit vom
Polradwinkel bei Existenz eines Reluktanzmomentanteils ........................ 23
Abb. 2-4: Gestaffelter Rotor mit transparentem Blechpaket ..................................... 24
Abb. 2-5: Mesh des 2D-Finite-Elemente-Modells der E-Maschine mit gegossenen
Spulen ................................................................................................... 26
Abb. 3-1: Schnitt durch den Stator ......................................................................... 29
Abb. 3-2: Hybridmodul ......................................................................................... 30
Abb. 3-3: Stator im Kühlmantel ............................................................................. 30
Abb. 3-4: Verlauf der Hilfsfunktionen φ(β) und ψ(β) .............................................. 32
Abb. 3-5: Geometrie des Modells der elektrischen Maschine mit gegossenen
Spulen ................................................................................................... 33
Abb. 3-6: Prüfstandsaufbau ................................................................................... 35
Abb. 3-7: Beispiel der am Prüfstand ermittelten Daten ............................................ 36
Abb. 3-8: Gegenüberstellung des auf drei Arten ermittelten
Widerstandserhöhungsfaktors der Versuchsmaschine .............................. 39
Abb. 3-9: Verlauf und Aufgliederung der Verluste.................................................. 40
Abb. 3-10: Anteil der Verlustarten aus dem Prüfstandsversuch an den
Gesamtverlusten .................................................................................... 40
Abb. 3-11: Gegenüberstellung von k-Verläufen in den Leitern 1 bis 14 (siehe
r
Abbildung 4-3) mit und ohne Permanentmagnete bei einer Frequenz
von 467 Hz und einem Strangstrom von 419 A........................................ 41
Abb. 4-1: Vergleich der magnetischen Flussdichte in Längsrichtung im Zahn und
in der Nut .............................................................................................. 44
Abb. 4-2: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Nutfelds als reines Nutquerfeld .......... 44
Abb. 4-3: Übersicht über das Finite-Elemente-Grundmodell ................................... 45
Abb. 4-4: Exemplarische Auswertung der magnetischen Flussdichte auf der in
Abbildung 4-3 gezeigten Linie zur Betrachtung des Querfelds ................. 46
Abb. 4-5: Veränderung des maximalen Querfeldwerts mit dem Strom ..................... 47
Abb. 4-6: Veränderung der maximalen Längsfeldwerte mit dem Strom ................... 48
X Abbildungsverzeichnis
Abb. 4-7: Abgleich des Widerstandserhöhungsfaktors bei ähnlichen
Randbedingungen .................................................................................. 49
Abb. 4-8: Widerstandserhöhungsfaktor für verschiedene eingespeiste Ströme .......... 50
Abb. 4-9: Magnetische Flussdichten in Längsrichtung in Abhängigkeit von der
Nuttiefe ................................................................................................. 51
Abb. 4-10: Magnetische Flusdichte in Längsrichtung an der Nutöffnung in
Abhängigkeit von der Distanz des obersten Leiters zur Nutöffnung. ......... 51
Abb. 4-11: Widerstandserhöhungsfaktor k im obersten Leiter für eine Variation der
r
Leiterbreite bei konstantem Leiterbreiten-zu-Nutbreiten-Verhältnis und
konstanter Zahnbreite ............................................................................. 52
Abb. 4-12: Längskomponente der magnetischen Flussdichte in der Nutmitte für
verschiedene Nuthöhe-zu-Nutbreite-Verhältnisse .................................... 53
Abb. 5-1: Zusammenhang der magnetischen Feldstärke und der magnetischen
Polarisation für das verwendete NO30-Elektroblech von C.D. Wälzholz ... 55
Abb. 5-2: Magnetische Flussdichte in Längsrichtung am Nutgrund (vergleiche
Abbildung 5-4) mit typischer Zahnentlastung durch magnetische
Sättigung der Zähne bei einer Zahninduktion von 2,14 T ......................... 57
Abb. 5-3: Magnetische Flussdichte in Querrichtung an der Zahnflanke (vergleiche
Abbildung 5-4 und Abbildung 4-4) mit Jochentlastung bei magnetischer
Sättigung des Jochs ................................................................................ 58
Abb. 5-4: Erweitertes und angepasstes Finite-Elemente-Grundmodell ..................... 59
Abb. 5-5: Stromverdrängungsverläufe bei magnetischer Sättigung (B=2,67 T) von
unterschiedlichen Eisenkreisabschnitten .................................................. 60
Abb. 5-6: Auswirkung der magnetischen Sättigung auf die magnetische
Flussdichteverteilung in der Nut und im Zahn ......................................... 63
Abb. 5-7: Magnetische Flussdichteverteilung in Längsrichtung an der Nutöffnung... 64
Abb. 5-8: Verlauf des Widerstandserhöhungsfaktors über die Leiterlagen für
unterschiedlich hohe Ströme in den Leitern ............................................. 64
Abb. 5-9: Anstieg des mittleren Widerstandserhöhungsfaktors aufgrund der
zunehmenden Sättigung des Eisenkreises ................................................ 65
Abb. 5-10: Betrachtung der Steigung von magnetischer Flussdichte in Längs- und
Querrichtung als Ursache des sich mit dem Strom ändernden mittleren
kr-Werts................................................................................................. 66
Abb. 5-11: Hochkantleiteranordnung ....................................................................... 67
Abb. 5-12: Gegenüberstellung der k-Verläufe bei hochkant- und bei querliegender
r
Ausrichtung der Leiter bei unterschiedlicher magnetischer Sättigung des
Eisenkreises ........................................................................................... 67
Abb. 5-13: Gegenüberstellung des mittleren k-Verlaufs für hochkant- und
r
querliegende Ausrichtung der Leiter bei unterschiedlicher magnetischer
Sättigung des Eisenkreises...................................................................... 68
Description:Christoph Junginger zeigt, dass das etablierte, über hundert Jahre alte, analytische Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Stromverdrängung mit seiner Annahme eines reinen Nutquerfeldes für hoch ausgenutzte elektrische Maschinen mit flachen Massivleitern nicht ausreicht. Der Autor legt dar, das