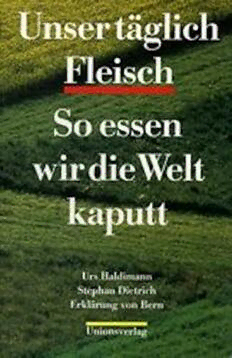Table Of ContentInhalt
Der masslose Appetit nach Fleisch 9 Liebe Leserin, lieber Leser 13
Vom Köfferlimimi zur genmanipulierten »Kuh 2000«
Zehntausendfache Vaterschaft 17
Erbfehler aus dem Versandhandel 20
Embryos zerschneiden und vervielfältigen 21
Mehr Fleisch und Milch dank Gentechnologie 23
Resistenzgene statt bessere Tierhaltung 25
Patentieren und kassieren 27
Medikamente aus der Pharma-Kuh? 29
Der Mensch - Hyäne, Allesfresser oder Vegetarier? 32
Güggelifriedhof beim Amphitheater 34
Die fetteste Gans ins Kloster 36
Schweizerkäse für die Seefahrer 37
Wurstsuppe fürs Proletariat 39
Was steckt im Fleisch? 40
Ist Fleisch gesund? 41
Vegetarier sind gesünder 44
Verzicht auf Fleisch aus ethischen Gründen? 45
Von der Wildsau zum Fabrikschwein 52 »Schweine, die den Fremden
bewillkommnen« 55 Weniger als zehn Sekunden pro Schwein und Tag
57
Zutritt verboten 58
Schneller fett dank Anti-Stress-Futter 59
Kastration und Stress im Schweinestall 60
Emma und andere Computer 62
Alternativen wären vorhanden 64
Das Ticrschutzgesetz — Theorie und Wirklichkeit 66
Ein Schweine-Freund macht sich unbeliebt 69
Doping im Stall 73
Mehr Fleisch dank Antibiotika 74
Schwarze, graue und grüne Märkte 76
Enzyme fürs Ferkel — Frostschutz für die Kuh 78
Hormone: Männer mit Brüsten 80
Psychodrogen: Vor der Prüfung ein Schnitzel 82
Lebcnsmittelkontrolle: Zufallstreffer ohne Beweiskraft 84
Hungrige Menschen — satte Schweine 87
Riesige Verluste durch »Veredelung« 89
Hungergeschenke 92
Fleischkonsum fördert Sozialprestige 94
Indiens Heilige Kühe 97
Methangas in die Luft — Jauche ins Trinkwasser 101
Viehwirtschaft belastet Umwelt 103
Steakproduktion vernichtet tropischen Rcgcnwald 104
Monokulturen fördern Bodenerosion 106
Tote Fische im Güllenland 108
Nitrate und Pestizide im Trinkwasser 110
Zuviel Erdöl steckt im Steak 112
Schwein und Rind als Düngerlieferanten 119
Filet für die Reichen - Ragout für die Armen 125 Fette Margen auf
mageren Nierstücken 128 Zunehmender Fleischtourismus 130 Der
internationale Fleischhandel: Legal und illegal 132 Wo
Rindfleischberge sich erheben 134
Güggeli do Brasil 137
Vom Schweinestall ins Schlachthaus — und zurück 144
»Spezialznüniwurst« aus Schweinekopf 146
Wertloses Fett 148
Kalb frisst Rind, Sau frisst Sau 150
Grenzüb erschreitender Kadaver-Tourismus 151
Dem Metzger in den Wurstkessel geschaut 154
Kalbsbratwurst vom Schwein 154
Wasserwurst mit Fett 156
Grillwürste mit Krebsverdacht 157
Wurst am Knochen 158
Schweinefleisch: jetzt ranzig statt wässrig? 158
Weisses Kalbfleisch: Mehrpreis für schlechte Haltung 161
Tiefgefroren-aufgetaut-tiefgefroren-aufgetaut 162
Salmonellen, Listerien, Cadmium & Co. 163
Bauern im Clinch: Etwas Neues anfangen oder aufhören 167
Anhang
Der grosse Fleischmarkensalat 182
Die Markenflcischprogramme im Uberblick 188
Weniger Fleisch — Zum Nutzen von Mensch, Tier und
Umwelt 193
Forderungen und Vorschläge an Bund und Kantone 193 Vorschläge
und Forderungen an den Handel 198 Tips für Konsumentinnen und
Konsumenten 198
Adressen 201
Die Herausgeberin 211
Der masslose Appetit nach
Fleisch
Vorwort
Iii letzter Zeit bin ich immer wieder Leuten begegnet, die mir unverhofft
erzählten, dass sie »jetzt weniger«, »selten« oder »gar kein« Fleisch
mehr essen würden. Meist geben sie gesundheidiche Gründe an für die
Einschränkung oder den Verzicht. Die einen plagt der erhöhte Blutdruck,
die andern klagen über Rheuma, Schlafstörungen, Arthritis,
Herzerkrankungen bis hin zum Darmkrebs. Und langsam beginnt sich
ein neuer Trend abzuzeichnen: Es gehört zunehmend zum guten Ton
ökologisch bewusster Zeitgenossinnen und -genossen, den
Fleischkonsum einzudämmen. Denn unser täglich Fleisch, bisher
Symbol von Wohlstand und gutem Leben, ist mitschuldig am
Energieverschleiss, an der Um- weltzerstörung und am Hunger in der
Welt.
Eigentlich müsste die Nahrungsmittelversorgung unsere Le-
bensgrundlagen nicht bedrohen. Gegenwärtig verfügt jede Region der
Erde über den notwendigen Boden oder über die Kaufkraft, um ihre
Bevölkerung hinreichend zu ernähren. Es sind die Wurst auf unserem
Brot und das saftige Kotelett auf dem Teller, welche riesige Landflächcn
für Viehweiden oder zum Anbau von Futtermitteln erfordern. In
Lateinamerika und im südlichen Afrika werden Quadratkilometer über
Quadratkilometer fruchtbaren Landes als Viehweiden genutzt. In
Brasilien wird die Hälfte des Getreides als Viehfutter verkauft, während
die Mehrheit der ländlichen Armen an Mangelernährung leidet. Soja
stillt den Fleischhunger der einheimischen Elite oder der ausländischen
Futtermittclimporteure, nicht aber den Hunger dfcr Menschen in
Brasilien. Über ein Drittel der weltweiten Getreideproduktion landet in
den Futtertrögen der Rinder, Schweine und Hühner. Wenn in der
landwirtschafdichen Produktion weltweit ein Wandel möglich wäre,
wenn statt Futtermitteln direkt Nahrungsmittel zum menschlichen
Konsum angebaut würden, könnte zusätzlich mindestens eine Milliarde
Menschen ernährt werden.
Diese Zusammenhänge sind nicht neu. 1975 hatte die Erklärung von
Bern zur Aktion »Weniger Fleisch für uns ■ mehr Getreide für die Dritte
Welt« aufgerufen. Angeprangert wurden vor allem die
Futtermittelimporte aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Kritik
kann im umstrittenen und viel zitierten Satz »Das Vieh der Reichen frisst
das Essen der Armen« zusammengefasst werden. Inzwischen sind die
Futtcrmittelimportc drastisch zurückgegangen. Schweizer Kühe,
Schweine und Hühner fressen nicht mehr Soja, Maniok oder Gertreide
aus dem Süden, sondern unser eigenes »überschüssiges« Getreide.
Jährlich werden um die lOO'OOO Tonnen Brotgetreide zu Futter
deklassiert.
Nach wie vor aktuell ist die These vom Energieverschleiss durch
Fleischproduktion. Bei der Umwandlung von pflanzlichen
Nahrungsmitteln in Fleisch, Milch oder Eier gehen im Schnitt dreiviertel
der Kalorien verloren. Der masslose Appetit nach Fleisch in den
nördlichen Industrieländern ist eine Form von verschwenderischem
Konsum, der den Kampf um die begrenzten Ressourcen verschärft. Es ist
ein Viertel der Menschheit, dasjenige im Norden, welches über drei
Viertel der weltweiten Ressourcen verschleudert. Es ist ein Viertel, das
im Überkonsum schwelgt und einen verschwenderischen Lebensstil
pflegt, der weder im Norden aufrechterhalten noch im Süden
übernommen werden kann, ohne letztlich die Zukunft der Menschheit zu
gefährden.
Die Erde hat Grenzen. Zunehmende Umweltkatastrophen warnen
vor dem drohenden Kollaps des Ökosystems. Spätestens seit dem
Umweltgipfel in Rio im Juni 1992 haben ökologische Fragen ihr
Ghettodascin verlassen und sind zu einem öffentlich anerkannten und
diskutierten Problem geworden. Bisher haben überdüngte Seen und
Jauchetourismus in der Schwciz oder die Abholzung des Regenwaides in
Lateinamerika sporadisch für Schlagzeilen gesorgt. Allmählich aber wird
uns bewusst, dass die Fleischproduktion für den satten Norden nicht nur
einzelne Regionen bedroht, sondern dass wir alle die ökologischen Schä-
den spüren werden. Wenn Wälder abgebrannt werden, um Rinderweiden
zu schaffen, werden Riesenmengen von Kohlendioxyd in der
Atmosphäre freigesetzt. Energieintensive Tierfabriken in den
Industriestaaten sind verantwortlich für den Verbrauch grosser Mengen
fossiler Energie. Chemische Düngemittel, beim Futtermittelanbau
grosszügig eingesetzt, lassen Lachgas frei, ein weiteres Treibhausgas.
Zudem produzieren Rinder, Büffel, Schafe und Kamele beim
Wiederkäuen und Verdauen Tonnen von Methan, einem der
gefährlichsten Treibhausgase. Das tägliche Fleisch und die Wurst der
Wohlhabenden in den nördlichen Industrieländern tragen somit zur
weltweiten Klimaveränderung bei, deren katastrophale Folgen heute erst
erahnt werden können.
Das vorliegende Buch greift die ökologischen, entwicklungs-
politischen, gesundheitlichen, landwirtschafts- und konsumenten-
politischen Aspekte unseres Fleischkonsums auf. Es will Ihnen dabei
nicht den Appetit verderben, sondern zum Nachdenken, Diskutieren und
Handeln anregen. Die Erklärung von Bern möchte Sie ermutigen,
weniger Fleisch zu essen, nicht nur Ihnen selbst und Ihrer Gesundheit
zuliebe, sondern vor allem zugunsten der Umwelt und der Menschen in
der Dritten Welt. Im April 1992 lancierte die »Beyond Beef Coalition«,
ein breiter Bund von Umwelt-, Konsumenten-, Tierschutz-, Bauern- und
entwicklungspolitischen Organisationen aus 16 Ländern rund um die
Erde, eine Kampagne wider den übermässigen Fleischkonsum und die
Zerstörung unserer Umwelt. Erklärtes gemeinsames Ziel ist die
Reduktion des Fleischkonsums um die Hälfte.
Eine Drosselung des energicverschleissendcn Konsums allein reicht
nicht aus zur Rettung unserer Erde. Was wir brauchen und wofür wir uns
einsetzen, ist eine naturnahe Agrarpolitik, gerech-
1
1
tere Handelsbeziehungen und Schuldenstreichung — letztlich ein neues
Wirtschafts- und Konsummodell, das auf der Achtung vor dem Menschen
und der Natur beruht.
Helen Zweifel
Erklärung von Bern
Liebe Leserin, lieber Leser
Manchmal hat uns die Arbeit an diesem Buch den Appetit auf Cervelat,
Schweinehals und Pouletschenkel verschlagen. Vegetarier sind wir aber
nicht geworden. Zwar verzichten wir gerne auf Schnitzel von
Schweinen, die mit Kraftfutter und Antibiotika vollgestopft wurden. Und
auch die industriell produzierten und am Fliessband abgeschlachteten
Masthähnchen mögen wir nicht mehr. Doch das ist nur die eine Seite der
»Fleischproduktion«.
Eine Schweiz ohne Kühe können wir uns nicht vorstellen. Das liebe
Vieh verwandelt auf ökologisch sinnvolle Weise Gras in Milch und
Fleisch. Und Schweine sind traditionell nützliche Ab- fallverwerter.
Dürften sie regelmässig im Freien herumspringen, sich artgemäss in
einer Pfütze suhlen oder in der Sonne dösen, wären an ihrem Lebensende
Speck und Schinken nicht zu verschmähen. Doch wo trifft man
heutzutage schon eine glückliche Freilandsau?
Unser persönliches Fleischrezept lautet: Weniger, aber besser. Mit
besser meinen wir nicht zarte Steaks von lateinamerikanischen Rindern,
deren Weidegründe den tropischen Regenwald verdrängen. Besser
heisst: artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft, Nutzung
des heimischen Futters. Wenn wir etwas weniger Fleisch essen, können
wir den Bauern dafür einen besseren Preis bezahlen.
Viele Landwirte fühlen - sich heute als Prügelknaben der Nation.
Unterstützt durch staatliche Subventionen haben sie in den vergangenen
Jahrzehnten die Flcischproduktion rationalisiert. Immer mehr Schweine
und Hühner wurden eingepfercht und
mit Kraftfutter und allerlei Hilfsstoffen zu maximalen Mastleistungen
angetrieben. Jetzt werden die Tierhalter Opfer ihres eigenen Erfolgs.
Konsumentinnen und Konsumenten zeigen weniger Appetit auf Fleisch aus
Intensivmast und Tierfabriken. Die Marktpreise sinken öfter unter die
Produktionskosten. Mit der bevorstehenden Öffnung der Grenzen
(Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen GATT, Europäische
Gemeinschaft EG) wird die Konkurrenz für die Schweizer Bauern noch
härter.
Die aktuelle Krise der Landwirtschaft ist auch eine Chance. Mit
gezielten Direktzahlungen könnte der 13und einer besseren und
umweltschonenderen Tierhaltung zum Durchbruch verhelfen. Qualitativ
gutes Fleisch ohne chemischc P-oickstände könnte ein Schweizer
Markenzeichen werden.
Wer gelegentlich cm Stück Fleisch mag, soll dies ohne schlechtes
Gewissen gemessen dürfen. Fleisch von fidelen Schweinen, Weiderindern
und zufrieden gackernden Hühnern schmeckt garantiert besser als das
normierte Kotelett aus der Tierfabrik.
Urs Haldimann
Stephan Dietrich
Vom Köfferlimuni zur
genmanipulierten »Kuh 2000«
Die gute alte Zweinutzungskuh, die wiederkäuend Gras in Milch verwandelt
und zum Schluss als Suppenfleisch und Gulasch verzehrt wird, hat bald
ausgedient. Der Markt ruft nach Spezialisierung: Kühe mit höchster
Milchleistung und Mastbullen, die in kurzer Zeit viel zartes Fleisch ansetzen.
Nur noch die tüchtigsten Stiere kommen als Samenspender in Frage.
Embryonen von Spitzenkühen werden im Labor geteilt, tiefgefroren oder durch
»minderwertige« Leihmütter ausgetragen. Genetiker versuchen, direkt ins
Erbgut der Tiere einzugreifen: Erbfehler, die durch die künstliche Besamung9
zum Teil weltweit verbreitet wurden, sollen mit Gensonden identifiziert und
deren Träger ausgemerzt werden. Sobald es gelingt, einzelne Gene gezielt ins
Erbgut der Kühe einzufügen, können Menge und Beschaffenheit von Milch und
Fleisch verändert werden. Mäuse, die in ihrer Milch menschliche Hormone
absondern, sind schon Wirklichkeit. Grössere Schwierigkeiten bereitet das
Projekt »Phar- ma-Kuh«. Dennoch drängt die agrochemische Industrie jetzt
auf den Patentschutz für gen manipulierte Tiere.
Wann ist die Kuh genetisch ausgereizt? Wenn sie im Jahr 20'000 Kilo
Milch gibt? Wenn sie trotz Besamung mit dem Sperma eines Superbullen
unfruchtbar bleibt? Wenn sie an einem heissen Sommertag bei der
kleinsten Anstrengung tot umfällt? »Die moderne Milchkuh ist
anspruchsvoll geworden«, sagt Urs Holzmann vom Schweizerischen
Verband für künstliche Besamung (SVKB).1 »Wie ein Spitzensportler
braucht sie eine gute Betreuung und die richtige Ernährung.« Während der
zehnmonatigen Laktationsperiode nach dem Abkalben und der zwei
Monate dauernden milch- losen Galtzeit vor der Geburt des nächsten
Kalbes verändern sich Stoffwechsel und Nahrungsbedarf ständig. Nebst
Gras oder Heu braucht sie eine ausgeklügelte Mischung von Kraftfutter.
Holzmann: »Viele Landwirte haben zuwenig Zeit, um ihre Kühe genau zu
beobachten. So erkennen sie nicht, wenn eine Kuh wegen falscher
Fütterung oder anderer Umgebungseinflüsse unter Stress gerät.« Genetisch
bedingt reagieren die Milchkühe wie Tiere in freier Wildbahn bei
Nahrungsmangel: Sie hören auf, Nachwuchs in die Welt zu setzen. Sie
zehren von den körpereigenen Reserven. Bis zum Schluss aber geben sie
Milch, denn dies dient gemäss ihren Anlagen der Arterhaltung. Die
einseitige Zucht der Kühe auf Milchleistung kann bei Fehlernährung oder
Krankheit fatale Folgen zeigen. Die deutsche Tierärztin Anita Idcl
berichtet, dass »objektiv kranke Tiere, zum Beispiel Kühe mit 40 Grad
Fieber, immer noch 20 bis 30 Liter Milch am Tag geben. Sie können den
>Milchhahn nicht zudrehen<. Sie sind durch die Hochleistungszucht
genetisch zur Leistung gezwungen.«2
Für die Schweizerinnen und Schweizer ist die Kuh seit Jahrhunderten
das ideale Nutztier. Als unermüdliche Wiederkäuerin verwandelt sie für
Menschen ungeniessbarcs Gras und Heu in das hochwertige
Nahrungsmittel Milch. Am. Ende ihres Lebens füllt sie uns noch die