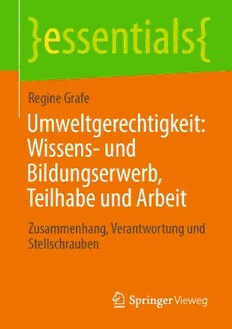Table Of ContentRegine Grafe
Umweltgerechtigkeit:
Wissens- und
Bildungserwerb,
Teilhabe und Arbeit
Zusammenhang, Verantwortung und
Stellschrauben
essentials
essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen,
worauf es als „State-of-the-Art“ in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der
Praxis ankommt. essentials informieren schnell, unkompliziert und verständlich
• als Einführung in ein aktuelles Thema aus Ihrem Fachgebiet
• als Einstieg in ein für Sie noch unbekanntes Themenfeld
• als Einblick, um zum Thema mitreden zu können
Die Bücher in elektronischer und gedruckter Form bringen das Expertenwissen
von Springer-Fachautoren kompakt zur Darstellung. Sie sind besonders für die
Nutzung als eBook auf Tablet-PCs, eBook-Readern und Smartphones geeignet.
essentials: Wissensbausteine aus den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissen-
schaften, aus Technik und Naturwissenschaften sowie aus Medizin, Psychologie
und Gesundheitsberufen. Von renommierten Autoren aller Springer-Verlagsmarken.
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/13088
Regine Grafe
Umweltgerechtigkeit:
Wissens- und
Bildungserwerb,
Teilhabe und Arbeit
Zusammenhang, Verantwortung und
Stellschrauben
Regine Grafe
Ludwigsfelde, Deutschland
ISSN 2197-6708 ISSN 2197-6716 (electronic)
essentials
ISBN 978-3-658-32097-3 ISBN 978-3-658-32098-0 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32098-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung
der Verlage. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen
etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die
Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des
Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und
Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt
sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt
im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten
und Institutionsadressen neutral.
Planung/Lektorat: Daniel Fröhlich
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Was Sie in diesem essential finden können
• Darstellung der Zusammenhänge von Bildung und Sozialisation und deren
Einfluss auf Teilhabe in einer zunehmend pluralen Gesellschaft
• Einen Einblick in die Zusammenhänge von antizipatorischer, formaler-
und non-formaler Bildung auf die Chancengleichheit beim Wissens- und
Befähigungserwerb
• Eine differenzierte Betrachtung des Umgang mit den Begriffen Wissen und
Bildung
• Einen Ausblick auf die rasante Veränderung der Arbeitswelt und der damit
sich ändernden Arbeitsmodelle
• Eine differenzierte Darstellung von Wissensgesellschaft und Informations-
gesellschaft
V
Inhaltsverzeichnis
1 Sozialraumbezogene Umweltgerechtigkeit ....................... 1
1.1 Reflexionen zum Begriff Gerechtigkeit ....................... 1
1.2 Reflexionen zum Begriff einer ganzheitlichen
Umweltgerechtigkeit ..................................... 7
2 Umweltgerechtigkeit: Sozialisation, Bildung und Teilhabe .......... 11
2.1 Reflexionen zu den Begriffen Wissen und Bildung .............. 16
2.2 Sozialisation und Bildungserwerb ........................... 27
2.3 Reflexionen zu Teilhabe an Wissen und Bildung ................ 31
3 Umweltgerechtigkeitsansatz und Arbeitsumwelt
als sozialer Raum ........................................... 39
3.1 Zukunftsfähige Wissens- und Bildungsvermittlung .............. 40
3.2 Die Arbeitswelt von morgen im Spannungsfeld von
Digitalisierung und demografischem Wandel .................. 43
4 Zusammenfassung und Option ................................ 47
Quellenverzeichnis ............................................. 51
VII
1
Sozialraumbezogene
Umweltgerechtigkeit
1.1 R eflexionen zum Begriff Gerechtigkeit
Recht und Gerechtigkeit „Recht und Gerechtigkeit sind nicht deckungsgleich.
Während beim eigenen Gerechtigkeitsverständnis ein moralisches Subjekt selbst
entscheidet, was es aufgrund bestimmter Prinzipien als gerecht annehmen möchte,
ist das Recht gesetzt. Recht gilt“. (Funke 2017)
Das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit wird in vielen sozialen Beziehungen
aber auch in vorstrukturierten Systemen infrage gestellt. Es begegnet sich Rechts-
empfinden und gesetzte Recht, wobei letzteres häufig als ungerecht empfunden
wird. Recht und Gerechtigkeit sind in vielen Bereichen des Lebens und dessen
Umweltbeziehungen strapazierte Begriffe. Nicht immer sind sie im Diskurs um
eine Sache oder Sachlage wirklich zielführend. Bereits in der Antike haben sich
die allseits bekannten Philosophen wie Platon1 oder Aristoteles2 mit dem Begriff
der Gerechtigkeit und deren Bedeutung für das Miteinander in der mensch-
lichen Gesellschaft befasst, ohne eine abschließende Definition dafür zu finden.
Die Splittung von Gerechtigkeit in verschiedene Ordnungssysteme wie soziale
Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Zugangsgerechtigkeit, Energiegerechtig-
keit, Umweltgerechtigkeit und weitere hat zwar Wirkungsfelder aufzeigen können
aber es nicht vermocht, eine allgemeingültige Beschreibung des Umgangs und
der Bewertung von gerecht und Gerechtigkeit und damit von ungerecht und
Ungerechtigkeit zu formulieren. Die Fokussierung des Gerechtigkeitsansatzes
1Platon (428/427 v. Chr. bis 348/347 v. Chr.): griechischer Philosoph.
2Aristoteles (384 v. Chr. bis 322 v. Chr.): griechischer Philosoph.
© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden 1
GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
R. Grafe, Umweltgerechtigkeit: Wissens- und Bildungserwerb, Teilhabe und
Arbeit, essentials, https://doi.org/10.1007/978-3-658-32098-0_1
2 1 Sozialraumbezogene Umweltgerechtigkeit
Zugangsgerechtigkeit
Gerechtigkeit für
Bildungsgerechtigkeit Wissens- und
Befähigungserwerb
Geschlechtergerechtigkeit Chancengleichheit Leistungsgrechtigkeit
Gesundheitsgerechtigkeit Generationsgerechtigkeit
Generationsgerechtigkeit
Abb. 1.1 Chancengleichheit und Gerechtigkeitsansätze – eine Auswahl. (Nach Hradil
2016)
auf soziale Bedingungen und Zustände, der ein ausgewogenes empathisches
wenn auch abstraktes Modell von Gerechtigkeit umfasst, ist auf eine moralisch
begründete Verteilung von Ressourcen, Gütern, Lasten und Beschwernissen
gerichtet (vgl. Abb. 1.1). Derartige Ansätze sind bereits in den Schriften früh-
christlicher Bewegungen bis hin zu den Theorien der utopischen Sozialisten zu
finden (Hautmann 2002).
Während das normative Recht für alle gilt, wird Gerechtigkeit in ver-
schiedenen sozialen Strukturen unterschiedlich empfunden. Der Grund dafür
liegt darin, das Gerechtigkeitsempfinden von der Sozialisation der Menschen
abhängig ist, weil die Lebensumwelt maßgeblichen Einfluss auf das Gerechtig-
keitsempfinden hat, welches durch antizipieren von Gewohnheiten und Lebens-
umständen in unterschiedlichen sozialen Räumen entsteht. Prägend sind dabei die
Sozialisierung in der Familie, in der dörflichen oder städtischen Gemeinschaft,
einer Religionsgemeinschaft oder auch der Bildungs- und Arbeitswelt, sozusagen
der jeweiligen Lebensumwelt. Unterschiedliche Sozialisierungsphasen führen
dazu, dass Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterschiedlich bewertet werden. Je
heterogener eine Gesellschaft im Sinne einer Sozietät ist, desto komplexer wird
1.1 Reflexionen zum Begriff Gerechtigkeit 3
These A:
These B:
Übereinkunft im
Bestimmung über soziale
Zusammenleben über
und rechtliche Normen
Sitten/Gebräuche
Gerechtigkeitsansätze
These C: These D:
Bestimmung durch guten oder Bestimmung über die Folgen
schlechten Willen von Handlungen
Abb. 1.2 Ausgewählte philosophische Thesen zum Gerechtigkeitsbegriff – ein Überblick
(vereinfacht nach Funke 2017)
der Gerechtigkeitsbegriff reflektiert und umso anspruchsvoller formuliert. Die
Kumulation von verschiedenen willkürlich ausgewählten philosophischen Thesen
zu Gerechtigkeit, in der Abbildung als A, B, C, und D geordnet, zeigt, dass die
Quintessenz der Vision Gerechtigkeit sich in einer Pluralität von normiertem
Recht und Rechtsempfinden wiederfindet (vgl. Abb. 1.2).
Häufig wird die Schnittstelle zum Rechtsbegriff als verpflichtend gesetztes
Recht in den Gerechtigkeitsbegriff einbezogen. Gerechtigkeit und Chancengleich-
heit werden häufig gleichbedeutend verwendet. Sie stehen gleichwohl in einem
unmittelbaren Zusammenhang, der auch die Begriffe Grundrecht bzw. Grund-
rechte impliziert.
u Grundrechte sind grundlegende Freiheits- und Gleichheitsrechte,
die der Staat Individuen zugesteht. Sie verpflichten den Staat und
berechtigen Private.
Grundrechte stellen einen verbindlichen Rechtsrahmen für die Nutzung von
Normen, der das gesellschaftliche Leben organisiert, dar. So gibt es verschiedene
disziplinbezogene Grundrechte, wie Recht auf freie Entfaltung der Persönlich-