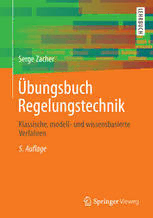Table Of ContentSerge Zacher
Übungsbuch
Regelungstechnik
Klassische, modell- und wissensbasierte
Verfahren
5. Auflage
Übungsbuch Regelungstechnik
Serge Zacher
Übungsbuch
Regelungstechnik
Klassische, modell- und wissensbasierte
Verfahren
5., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Mit 340 Abbildungen, 105 Aufgaben mit Lösungen
und 42 MATLAB-Simulationen
SergeZacher
Wiesbaden,Deutschland
ISBN978-3-658-03382-8 ISBN978-3-658-03383-5(eBook)
DOI10.1007/978-3-658-03383-5
DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschenNationalbibliografie;de-
tailliertebibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.d-nb.deabrufbar.
SpringerVieweg
DieerstenbeidenAuflagenerschienenunterdemTitel„MusteraufgabenRegelungstechnik”imEigenverlag
desAutors.
©SpringerFachmedienWiesbaden2007,2010,2014
DasWerkeinschließlichallerseinerTeileisturheberrechtlichgeschützt.JedeVerwertung,dienichtaus-
drücklichvomUrheberrechtsgesetzzugelassenist,bedarfdervorherigenZustimmungdesVerlags.Dasgilt
insbesonderefürVervielfältigungen,Bearbeitungen,Übersetzungen,MikroverfilmungenunddieEinspei-
cherungundVerarbeitunginelektronischenSystemen.
DieWiedergabevonGebrauchsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungenusw.indiesemWerkbe-
rechtigtauchohnebesondereKennzeichnungnichtzuderAnnahme,dasssolcheNamenimSinneder
Warenzeichen-undMarkenschutz-Gesetzgebungalsfreizubetrachtenwärenunddahervonjedermann
benutztwerdendürften.
GedrucktaufsäurefreiemundchlorfreigebleichtemPapier.
Springer ViewegisteineMarkevon SpringerDE.Springer DEistTeilderFachverlagsgruppeSpringer
Science+BusinessMedia
www.springer-vieweg.de
V
Vorwort zur 5. Auflage
Seit 2005 sind rund 40 Lehrbücher über Regelungstechnik in der deutschsprachigen Lite-
ratur erschienen. Fast alle technischen Verlage, darunter auch BoD (Books on Demand)
und kleine Eigenverlage, haben dafür ihre Beiträge geleistet. Neben den überarbeiteten
Auflagen von etablierten Titeln sind die Erstauflagen von neuen Autoren zu finden.
Die Liste von Büchern mit Aufgabensammlungen der Regelungstechnik ist dagegen sehr
kurz. Seit 2005 sind nur zwei Bücher mit Übungsaufgaben bekannt. Das sind die 2. Auf-
lage des Buches "Test- und Prüfungsaufgaben Regelungstechnik" von Alexander Wein-
mann (Verlag Springer Wien New York, 2. Auflage, 2007) und das vorliegende Übungs-
buch. Man soll dazu auch die Bücher von Hilmar Jaschek und Walter Schwinn (Verlag
Oldenbourg, München, 7. Auflage, 2002), von Leonard Schnieder (Verlag Vieweg,
Wiesbaden 1992), von Hans Peter Jörgl (Verlag Oldenbourg, Band 1, 1995 und Band 2,
1998) zählen, aber das ist alles.
Das Interesse der Studierenden für Aufgabensammlungen, insbesondere der Studierenden
der dualen Studiengänge, ist jedoch nicht weniger als für Lehrbüchern mit theoretischen
Grundlagen. Ein Argument dafür ist die Tatsache, dass nach der dritten Auflage in Jahr
2007 und der vierten Auflage in Jahr 2010 nun die fünfte Auflage der vorliegenden Auf-
gabensammlung erscheint. Zu jeder neuen Auflage wurde das Buch übergearbeitet und
mit neuen Kapiteln ergänzt:
(cid:121) In der 3. Auflage wurden die Aufgaben zur Zustands- und Mehrgrößenregelung, zur
adaptiven und nichtlinearen Regelung behandelt.
(cid:121) In der 4. Auflage wurden zu jedem Kapitel kurze theoretische Hinweise zur Lösung
von Muster-Aufgaben eingeführt.
(cid:121) In der vorliegenden 5. Auflage wurden die Aufgaben von Kapiteln "Adaptive Rege-
lung" und "Digitale Regelung" überarbeitet.
Inzwischen wurde auch der Verlag Vieweg+Teubner umstrukturiert, so dass das Übungs-
buch nun im Springer Vieweg Verlag erscheint. An diese Stelle möchte ich den beteilig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags, insbesondere dem Cheflektor Elektro-
technik/ IT/ Informatik, Herrn Reinhard Dapper, und der Editorial-Assistentin, Frau And-
rea Brossler, für die stets gute und jederzeit konstruktive Zusammenarbeit sowie für die
Anregungen und Unterstützung bei Buchpublikationen herzlich danken.
Und noch ein Argument, der das Interesse der Leserschaft für das vorliegende Übungs-
buch erklären kann, heißt "Regelungstechnik für Ingenieure". Dieses durchaus erfolgrei-
che Lehrbuch wurde vom Professor Dr.-Ing. Manfred Reuter im Jahr 1972 verfasst, dann
seit 2002 unter meiner Teilnahme überarbeitet und aktualisiert. Die Aufgaben des vorlie-
gendes Übungsbuches sind an "Regelungstechnik für Ingenieure" angepasst, so dass beide
Bücher sich gegenseitig ergänzen.
Das Übungsbuch beinhaltet klausurrelevante Muster-Aufgaben mit Lösungen, die ich
während meiner, nun mehr als zwanzigjährigen Lehrtätigkeit an Hochschulen angeboten
VI Vorwort zur 5. Auflage
habe. Somit soll das Buch den Studierenden helfen, Lehrinhalte besser zu verstehen und
Sicherheit für eine bevorstehende Prüfung verschaffen.
Die Aufgaben sind nach dem Schwierigkeitsgrad in fünf Kategorien von der einfachsten
Stufe (cid:77) bis zur höchsten Stufe (cid:77)(cid:78)(cid:79)(cid:80)(cid:81) eingeteilt. Bei allen Aufgaben sind die Lö-
sungsschritte lückenlos angegeben, die Lösungen sind teilweise mit MATLAB/Simulink,
einem etablierten Software-Tool von The Math Works Inc., unterstützt.
Die Formelsammlung sowie einige Lösungen des Übungsbuches sind mit HTML pro-
grammiert, mit Flash MX animiert und im Internet auf den Verlags- und/oder Autoren-
Webseiten online ausgestellt:
http://www.springer.com/springer+vieweg www.szacher.de
Dort findet man auch die Zusatzmaterialien, mit denen das Buch ständig aktualisiert wird.
Somit eignet sich das Buch zum Selbststudium bzw. zum E-Learning, was mit dem Über-
gang zu kürzeren Studienzeiten der Bachelor- und Master-Studiengänge besondere Be-
deutung gewinnt. Da das Übungsbuch heute auch als e-book in Bibliotheken zugänglich
ist, kann man durch die online-Formelsammlung schell navigieren.
Die Aufgaben sind hauptsächlich für Studenten der Elektrotechnik, des Maschinenbaus
bzw. der Mechatronik geeignet. Bei der Gestaltung von Lösungswegen wurden auch die
Probleme der mathematischen Behandlung von Regelkreisen berücksichtigt, die häufig
bei Studenten der dualen Studiengängen, d. h. bei berufsintegrierten ingenieurtechnischen
Studiengängen wie BIS und KIS auftreten.
Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass in meinen bisher verfassten Büchern
neben Lehrinhalten immer auch ein innovatives Verfahren beschrieben wurde. Das sind:
(cid:121) Antineuronen im Buch „Neuronale Netze für Ingenieure“ (1998)
(cid:121) Irrationale Laplace-Operatoren in „Automatisierungstechnik Aufgaben“ (1998)
(cid:121) Softwareagenten und SPS mit neuronale Netzen im Buch „SPS-Programmierung mit
Funktionsbausteinsprache“(2000)
(cid:121) Fuzzy- und Neuro-Trial Regler im Buch „Duale Regelungstechnik“ (2003)
Auch das vorliegende Buch ist keine Ausnahme in diesem Sinne: in der Aufgabe 11.5 ist
die neue Option der PFC-Regelung, so genannte SPFC-Regelung (Simplified Predictive
Functional Control), angeboten.
Wiesbaden, im August 2013 Serge Zacher
VII
Inhaltsverzeichnis
Formelzeichen...................................................................................................................X
Hinweise Aufgaben Lösungen
1 Linearisierung.....................................................................1
1.1 Dynamisches und statisches Verhalten.........................................6..................119
1.2 Statische Kennlinie.......................................................................6..................120
1.3 Statisches Kennlinienfeld.............................................................7..................120
1.4 Grafische Linearisierung..............................................................7..................121
1.5 Analytische Linearisierung...........................................................7..................121
1.6 Analytische und grafische Linearisierung.....................................8..................122
1.7 Linearisierung und Wirkungsplan.................................................9..................123
1.8 Maximaler Proportionalbeiwert....................................................9..................124
1.9 Arbeitspunkt...............................................................................10..................124
1.10 Wechsel des Arbeitspunktes.......................................................10..................125
1.11 Werte im Beharrungszustand......................................................10..................125
2 Regelkreisverhalten...........................................................11
2.1 Statisches Verhalten (1)..............................................................14..................126
2.2 Statisches Verhalten (2)..............................................................14..................127
2.3 Beharrungszustand......................................................................15..................128
2.4 Bleibende Regeldifferenz und Regelfaktor.................................15..................128
2.5 Regelfaktor.................................................................................15..................128
2.6 Parallelschaltung.........................................................................16..................129
2.7 Reihen- und Kreisschaltung........................................................16..................130
2.8 Wirkungsplan und Sprungantwort..............................................16..................131
2.9 Windkraftanlage.........................................................................17..................132
2.10 Bleibende Regeldifferenz..........................................................18..................133
2.11 Übertragungsfunktion einer Festplatte.......................................18..................133
3 Stabilität.............................................................................19
3.1 Hurwitz-Stabilitätskriterium (1)..................................................26..................135
3.2 Hurwitz-Stabilitätskriterium (2)..................................................26..................135
3.3 Nyquist-Stabilitätskriterium (1)..................................................27..................136
3.4 Nyquist-Stabilitätskriterium (2)..................................................27..................138
3.5 Nyquist-Stabilitätskriterium (3)..................................................28..................139
3.6 Phasenreserve (1).......................................................................29..................140
3.7 Phasenreserve (2).......................................................................29..................140
3.8 Phasenreserve (3).......................................................................30..................143
3.9 Stabile und instabile Strecken.....................................................31..................144
3.10 Instabile Strecke 1. Ordnung......................................................31..................145
3.11 Kabelbruch im Stellungsregelkreis.............................................32..................146
3.12 Instabile Strecke 2. Ordnung......................................................32..................147
VIII Inhaltsverzeichnis
Hinweise Aufgaben Lösungen
4 Reglereinstellung...............................................................33
4.1 Betragsoptimum..........................................................................39..................151
4.2 Symmetrisches Optimum.............................................................39..................151
4.3 Optimale Reglereinstellung (1)....................................................39..................153
4.4 Optimale Reglereinstellung (2)....................................................40..................153
4.5 Positionsregelung einer Roboterhand..........................................40..................154
4.6 Optimale Reglereinstellung (3)....................................................41..................154
4.7 Füllstandsregelung (1).................................................................41..................155
4.8 Füllstandsregelung (2).................................................................42..................156
4.9 Werkzeugmaschine......................................................................44..................158
5 Kaskadenregelung.............................................................47
5.1 Kaskadenregelung (1)..................................................................51..................162
5.2 Kaskadenregelung (2)..................................................................52..................163
5.3 Kaskadenregelung (3)..................................................................52..................165
5.4 Lageregelung...............................................................................53..................166
5.5 Reaktor mit Wärmeaustauscher...................................................54..................167
5.6 Override-Regelung......................................................................54..................169
6 Mehrgrößenregelung........................................................55
6.1 Molekularfilter.............................................................................67..................171
6.2 Zwei-Tank-System......................................................................68..................172
6.3 Stabilität......................................................................................68..................177
6.4 Diagonalregler.............................................................................69..................179
6.5 Entkopplungsregler (1)................................................................69..................182
6.6 Entkopplungsregler (2)................................................................70..................183
7 Zustandsregelung..............................................................71
7.1 Regelung einer Doppel-I-Strecke................................................77..................186
7.2 Zustandsrückführung...................................................................77..................188
7.3 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit..............................................77..................189
7.4 Zustandsbeobachter.....................................................................78..................190
7.5 Polverschiebung..........................................................................78..................193
7.6 Optimale LQ-Regelung...............................................................78..................194
8 Adaptive Regelung............................................................79
8.1 Identifikation...............................................................................82..................195
8.2 SLE-Methode..............................................................................83..................197
8.3 RLS-Methode..............................................................................83..................199
8.4 LMS-Methode.............................................................................84..................201
8.5 Adaptiver Zustandsregler............................................................84..................204
9 Nichtlineare und unstetige Glieder..................................85
9.1 Zweipunktregler ohne Schaltdifferenz.........................................88..................206
9.2 Zweipunktregler mit Grundlast....................................................88..................208
9.3 Temperaturregelung....................................................................89..................209
9.4 Digitaler Zweipunktregler...........................................................93..................213
9.5 Regelkreis mit einer Sättigung.....................................................94..................214
Inhaltsverzeichnis IX
Hinweise Aufgaben Lösungen
10 Digitale Regelung............................................................95
10.1 Quasikontinuierliche Regelung (1) ..........................................97..................216
10.2 Quasikontinuierliche Regelung (2) ..........................................97..................218
10.3 Digitalisierung (1)....................................................................98..................219
10.4 Digitalisierung (2)....................................................................98..................222
10.5 Differenzengleichung...............................................................99..................225
10.6 Differenzengleichung und Stabilität.........................................99..................227
10.7 z-Übertragungsfunktion............................................................99..................228
10.8 z-Übertragungsfunktion und Stabilität....................................100..................228
11 Modellbasierte Regelung..............................................101
11.1 Kompensationsregler (1).........................................................103..................230
11.2 Kompensationsregler (2).........................................................103..................230
11.3 Kompensationsregler (3).........................................................104..................231
11.4 Smith-Prädiktor.......................................................................104..................233
11.5 SPFC-Regelkreis.....................................................................104..................238
12 Wissensbasierte Regelung.............................................105
12.1 Klimaanlage.............................................................................113..................239
12.2 Ofenheizung............................................................................114..................240
12.3 Statische Kennlinie des Fuzzy-Reglers....................................115..................241
12.4 Optimierung des Fuzzy-Reglers..............................................115..................241
12.5 Einzelschicht-KNN..................................................................116..................243
12.6 Mehrschicht-KNN...................................................................116..................244
12.7 Mustererkennung.....................................................................117..................244
12.8 Stabilitätsgrenze......................................................................117..................245
Literaturverzeichnis..........................................................................247
Formelsammlung..............................................................................249
Sachwortverzeichnis.........................................................................257
X
Formelzeichen
A, B, C, D Matrizen der Zustandsbeschreibung
a , a , a , a Koeffizienten der Differentialgleichung
0 1 2 3
b Koeffizient, Schnittpunkt einer Geraden mit der Ordinaten-Achse
b Koeffizient der Differentialgleichung
0
C , C Integrierkonstanten
0 1
C(s), C(0) Koppelfaktor, statischer Koppelfaktor
c Koeffizient der Differentialgleichung
0
D, D , D Hauptdeterminante, Teildeterminanten
1 2
d Muster-Ausgang eines Neurons
e Regeldifferenz
e aktuelle Regeldifferenz eines Fuzzy-Reglers
akt
e(∞) bleibende Regeldifferenz e(t) bei t → ∞
f Funktion, Frequenz
G Erfüllungsgrad eines Fuzzy-Reglers
G(jω) Frequenzgang
|G(jω)| Amplitudengang in dB
dB
G(s) Übertragungsfunktion
G (s) Übertragungsfunktion des aufgeschnittenen Kreises
0
G (s) Übertragungsfunktion des gewünschten Regelkreisverhaltens
M
G (s) Übertragungsfunktion des Reglers
R
G (s) Übertragungsfunktion der Regelstrecke
S
G (s) Übertragungsfunktion des Vorwärtszweigs
v
G (s) Führungsübertragungsfunktion
w
G(s) Störübertragungsfunktion
z
H Durchhang, Sollwert eines Dead-Beat-Reglers
i, i Strom
E
J Massenträgheitsmoment
j= −1 imaginäre Einheit
K Differenzierbeiwert des Reglers
DR
K , K Integrierbeiwert der Strecke, Integrierbeiwert des Reglers
IS IR
K kritischer Proportionalbeiwert des Reglers
PRkrit