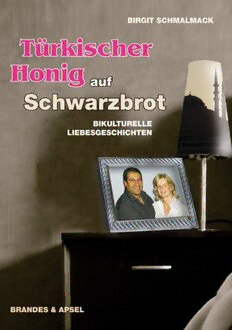Table Of ContentBirgit Schmalmack
Türkischer Honig
auf Schwarzbrot
Bikulturelle Liebesgeschichten
Brandes & Apsel
1. Auflage 2007
© Brandes & Apsel Verlag GmbH, Frankfurt a. M.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der
Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung,
Mikroverfilmung, Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen oder optischen Systemen, der öffentlichen
Wiedergabe durch Hörfunk-, Fernsehsendungen und
Multimedia sowie der Bereithaltung in einer Online-Datenbank
oder im Internet zur Nutzung durch Dritte.
Lektorat: Josefine Schubert,
Brandes & Apsel Verlag GmbH, Frankfurt a. M.
DTP und Umschlagsidee und -gestaltung:
Antje Tauchmann, Frankfurt a. M.
Druck: Impress, d.d. Ljubljana, Printed in Slovenia
Bibliografische Information Der Deutschen
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86099-725-3
Können Ehen zwischen Türken und Deutschen gut
gehen? Was machen diese Paare anders? Wie
gestalten sie ihren Beziehungsalltag? Welche Rolle
spielt »die« andere Kultur des Partners? Wie
wachsen Kinder in deutsch-türkischen Familien
auf?
Diese und noch viele andere Fragen stellte die
Autorin deutsch-türkischen Paaren. Ihre
Liebesgeschichten sind etwas Besonderes. Sie
erzählen vom Alltag, aber auch den
Besonderheiten bikultureller Beziehungen und
davon, wie die Partner aus verschiedenen Kulturen
ihre Konflikte meistern. Es sind persönliche
Lebensgeschichten, die den Blick für den einzelnen
Menschen in der multikulturellen Gesellschaft
schärfen.
Die Autorin:
Birgit Schmalmack, geboren 1963, Ausbildung zur
Verlagskauffrau, Studium der Fächer Deutsch,
Mathematik und Pädagogik. Sie arbeitet als
Lehrerin und freie Journalistin und wohnt in
Hamburg. Sie lebt selbst seit zwölf Jahren in einer
Partnerschaft mit einem türkischstämmigen
Deutschen.
Vorwort
Der Situation des Verliebens wohnt ein besonderer Zauber
inne: Die plötzlichen Gefühls- und Hormonüberschüsse sorgen
dafür, dass das Gegenüber als eine ganz einzigartige,
unvergleichliche Persönlichkeit wahrgenommen wird. In
diesem Moment spielen Schubladen keine Rolle mehr.
Klischeevorstellungen werden unwichtig. Nur das Einzelwesen
zählt. Diese Phase des Verliebens weitet den Blick, macht
unempfänglich für normative, gesellschaftliche
Grenzziehungen und ist damit der Anfang eines wahren
Verstehens des anderen.
Vielleicht könnte sich die Gesellschaft bei ihrer Diskussion
um die Integrationsfähigkeit bestimmter Migrantengruppen
von dieser Haltung ein wenig bedienen. Erst wenn der Mensch
nicht mehr nur als Vertreter einer nationalen Gruppe sondern
auch als Einzelperson gesehen werden kann, können
vorschnelle Pauschalierungen vermieden werden.
Ich durfte zu Gast sein in den Küchen und Wohnzimmern
von 42 deutschtürkischen Paaren. Sie haben mir freimütig von
den schwierigen und schönen Seiten ihrer Beziehung erzählt.
Vertreten sind alle Altersstufen und Bildungsgrade. Unter
ihnen befinden sich sowohl der Hafenarbeiter, der Psychiater,
die Künstlerin als auch die Fließbandarbeiterin. Ihre ganz
persönlichen Lebensgeschichten sollen dazu anregen, wieder
den Blick für den einzelnen Menschen zu entwickeln und
somit auch gesamtgesellschaftliche Probleme sensibler
betrachten und besser verstehen zu können.
Ich selbst lebe seit elf Jahren in einer Partnerschaft mit einem
in Deutschland geborenen Türken, der mittlerweile rein
statistisch gesehen nicht mehr zu ihnen zählt: Seit 2001 ist er
deutscher Staatsbürger. Vielleicht steuerte mich also auch die
persönliche Neugier, als ich immer größere Lust bekam,
Geschichten von deutsch-türkischen Paaren in Deutschland zu
erzählen. Doch eventuell war es auch einfach der zunehmende
Unmut darüber, dass im Moment nur von solchen zu lesen ist,
die im Drama enden. Doch wenn von Fehlentwicklungen zu
berichten ist, dann gehören zu einer ausgewogenen
Berichterstattung auch Geschichten von Paaren, die ihre
eventuellen Schwierigkeiten überwunden haben. Wo
abschreckende Beispiele zur Geltung kommen, sollten die
Vorbilder auch Gelegenheit dazu haben.
Zahlenmaterial zu binationalen Ehen
Laut Statistischem Bundesamt hatte bei 16,5 Prozent der
396.000 Paare, die sich 2004 das Jawort gaben, einer der
Ehepartner nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das war jede
sechste Ehe. Jedes vierte Kind hatte mindestens einen
ausländischen Elternteil. Diese Zahlen werden in Zukunft
sicher noch steigen. In Großstädten liegen sie schon jetzt
wesentlich höher. So war in Berlin laut Pressemitteilung des
Berliner Senats vom 13.4.2005 jede vierte Ehe interethnisch
und hatten 40 Prozent aller Kinder einen
Migrationshintergrund. Die Art der Beziehungen, die
Menschen in Deutschland eingehen, wird sich also in Zukunft
immer weiter ausdifferenzieren.
Dieser Trend war in den vergangenen Jahrzehnten auch bei
der Bandbreite der Lebensformen zu beobachten. Immer mehr
Paare verzichten auf den Trauschein und leben in
nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen. Auch die
Frage, ob sie zusammen Kinder bekommen wollen, stellen sie
zur Diskussion. Und die Geburt eines Kindes hat nicht
zwingend eine Heirat zur Folge. Eine Ehe oder Partnerschaft
dauert nur noch solange, wie die Partner es wünschen. Eine
lebenslange Lebensgemeinschaft ist zu einer bewussten
Entscheidung füreinander geworden. Die Scheidungszahlen in
Deutschland sprechen eine deutliche Sprache: Fast jede zweite
Ehe wird geschieden (2003: 43 Prozent).
In diesen Trend zur größeren Variationsbreite fügt sich die
Wahl eines Partners aus einem anderen Kulturkreis ein. Die
Lieblingspartner der Frauen sind dabei Männer aus der Türkei.
Das Statistische Bundesamt teilte 2005 mit, dass 4.900 von
ihnen einen Türken als Ehepartner wählten. Die Männer
bevorzugten eher eine Partnerin aus Osteuropa. Eine Türkin
nahmen nur knapp 1 800 der Männer zur Ehefrau. Das
Statistische Bundesamt geht in seinem Mikrozensus von 2006
für das Jahr 2005 von circa 146.830 deutsch-türkischen
Ehepaaren aus. Im Vorjahr gab es deren Zahl noch mit 129.000
Paaren an.
Bei diesen Statistiken ist zu berücksichtigen, dass die Zahlen
nur diejenigen erfassen, die noch über ihren ausländischen
Pass verfügen. Eingebürgerte Ausländer fallen hier nicht mehr
ins Gewicht. Da es aber alleine im Jahre 2005 140.731
Einbürgerungen gegeben hat, sagen die Zahlen alleine wenig
aus. Denn die größte Gruppe unter den Eingebürgerten waren
mit 39 Prozent Personen türkischer Herkunft. Mittlerweile
besitzt jeder dritte Türkischstämmige einen deutschen Pass und
ihre Zahl hat sich bis Ende 2004 auf 840.000 erhöht. So fallen
Staatsangehörigkeit und Herkunft zunehmend auseinander. Die
Zahl der Ehen, in denen die Partner dieselbe Herkunft aber
unterschiedliche Pässe haben, steigt stetig an. Genauso wie die
Zahl der Paare, bei denen beide Partner dieselbe
Staatsangehörigkeit besitzen, aber unterschiedlicher Herkunft
sind.
Bei den Scheidungen entfielen im Jahr 2005 12,4 Prozent
aller Trennungen in Deutschland auf solche, bei denen
mindestens einer der Ehepartner eine ausländische
Staatsbürgerschaft hatte. Dagegen lag der Prozentsatz aller
Eheschließungen mit Auslandsberührung im Jahr 2004 bei
16,5 Prozent.
Unter ihnen ist die Zahl der Scheidungen bei deutsch-
türkischen Ehepaaren laut Statistischen Bundesamtes am
bedeutsamsten: Die Anzahl der Scheidungen lag 2003 in dieser
Gruppe bei etwa 3.390. Demgegenüber gaben sich im Jahr
2000 5.784 deutsch-türkische Ehepartner das Jawort.
In einer Stadtbeobachtung aktuell wurde exemplarisch für die
Stadt Wiesbaden im Zeitraum 2002-2004 die so genannte
Einheiratsquote untersucht. Es wurde herausgefunden, dass nur
16 Prozent der türkischen Migranten in Deutschland eine Ehe
mit einem Deutschen eingehen. Damit lagen sie unter dem
durchschnittlichen Wert aller in die deutsche Gesellschaft
einheiratenden Migranten von 28 Prozent. Meist wird das als
Abschottung interpretiert. Doch die Gründe können vielfältiger
sein. Bei 1,8 Millionen Türken in Deutschland ist die
Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Ehepartner der eigenen
Herkunft zu finden, viel größer als bei anderen Nationalitäten.
Die Konzentration auf bestimmte Wohngebiete erhöht die
Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme um ein weiteres. Ein
weiterer Gesichtspunkt ist der rechtliche Status der türkischen
Bevölkerung: Anders als Italiener, Griechen oder Spanier sind
sie keine EU-Bürger. Ihre Freizügigkeit und rechtliche
Absicherung ist stark eingeschränkt. So stellt für ihre Familien
die Heirat eines noch in der Türkei Lebenden auch eine
Möglichkeit zur Einreise nach Deutschland dar. Es ist zu
vermuten, dass mit der Schaffung anderer Einwanderungswege
für die Türken eine Vielzahl der viel geschmähten arrangierten
Ehen zu verhindern wäre.
Die tatsächliche Zahl der türkisch-türkischen Ehen kann nur
geschätzt werden. Sie ergibt sich einerseits aus den
Eheschließungen in deutschen Standesämtern (1996: 917,
2003: 1.534), in türkischen Konsulaten in Deutschland (1996:
4.920) und den Eheschließungen in der Türkei. Über die
ungefähre Anzahl letzterer kann die Zahl der
Ehegattennachzüge zu den in Deutschland lebenden
Ehepartnern eine Vorstellung geben. Laut Auswärtigem Amt
gab es 1996 17.662 Nachzüge. Somit käme man für das Jahr
1996 auf 2.3499 türkisch-türkische Eheschließungen. Im
selben Jahr wurden in Deutschland 4.657 deutsch-türkische
Ehen geschlossen. Das wäre ein Anteil von 16,5 Prozent aller
Ehen mit Beteiligung von türkischen Staatsangehörigen (vgl.
Straßburger, in: Migration und Bevölkerung, 1999).
Die Anzahl der Anträge auf Ehegattennachzüge nimmt stetig
ab: Sie sanken bis 2003 auf 10.614 und 2004 nochmals auf
8.360. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich auch auf diesen
Bereich die Zahl der Einbürgerungen ausgewirkt haben könnte.
2003 gab es daneben 7.158 und 2004 6.443 Ehegattennachzüge
zu deutschen Ehegatten. Je nach Perspektive mögen sie nun die
Zahl der deutsch-türkischen oder der türkisch-türkischen Ehen
vergrößern.
Die Scheidungsquote der türkisch-türkischen Ehepaare bleibt
gänzlich spekulativ. In Deutschland werden nur die
Ehescheidungen erfasst, die vor deutschen Gerichten
beschlossen werden. Das waren im Jahre 2003 2.657 Fälle.
Dass aber 1996 nur 917 und auch 2002 nur 1.482 türkisch-
türkische Ehen vor deutschen Ämtern geschlossen wurden,
macht wieder einmal die Schwierigkeiten der statistischen
Erhebungen bezüglich transnationaler Heiratsdaten deutlich.
Türkisch-türkische Ehepaare hatten 1997 44.197 Kinder,
während im selben Jahr aus deutsch-türkischen Ehen 6.880
Kinder hervorgingen. Laut Mikrozensus im März 2004 hatten
also 91.000 der damals 129.000 Paare Kinder. Daraus folgt,
dass auch deutsch-türkische Paare sich nicht immer für Kinder
entscheiden. 20 Prozent der Ehen zwischen einem deutschen
Mann und einer türkischen Frau blieben kinderlos. Bei den
Ehen zwischen einer deutschen Frau und einem türkischen
Mann waren es sogar 35 Prozent.
Situation der türkischen Migranten
1961 wurde der Gastarbeiteranwerbevertrag mit der Türkei
geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt kamen auch Türken als so
genannte »Gastarbeiter« nach Deutschland, um den
Arbeitskräftemangel der deutschen Industrie zu stillen. Was
zunächst als kurzfristige Aktion geplant war, weitete sich im
Laufe der nächsten Jahre aus. War zuerst noch daran gedacht
worden, die Arbeiter rotieren zu lassen und alle ein bis zwei
Jahre neue Kräfte aus der Türkei zu holen, so erwies sich
dieses Vorhaben für die Unternehmen bald als ineffektiv. Die
gerade gut eingearbeiteten Arbeitskräfte sollte man wieder
gehen lassen? Sie blieben also. Damit waren ihnen auf längere
Sicht die provisorischen Wohn- und Lebensverhältnisse in den
Sammelunterkünften nicht mehr zu zumuten. Also gestattete
man ihnen, nach und nach ihre Familienangehörigen
nachzuholen, Wohnungen anzumieten, eigene Geschäfte zu
eröffnen und ihren Aufenthaltstatus allmählich zu verfestigen.
1971 zeigte das deutsche Wirtschaftwachstum mit der
Erdölkrise eine Abschwächung. Die Bundesregierung erließ
1973 den Anwerbestopp für neue Gastarbeiter. Doch statt einer
Reduzierung hatte das zunächst einen Anstieg der
ausländischen Wohnbevölkerung zur Folge. Während 1965
132.800 und 1970 469.200 Türken in Deutschland wohnten,
waren es 1975 bereits 1.077.100 und 1980 1.462.000. Denn