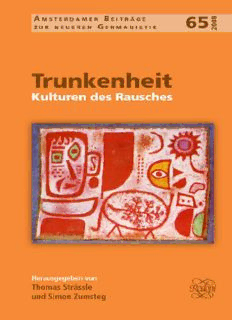Table Of ContentTrunkenheit
Kulturen des Rausches
A B 65 8
m s t e rd A m e r e i t r ä g e
0
g 0
z u r n e u e re n e r m A n i s t i k 2
Herausgegeben von
Gerd Labroisse
Gerhard P. Knapp
Norbert Otto Eke
Wissenschaftlicher Beirat:
Christopher Balme (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Lutz Danneberg (Humboldt-Universität zu Berlin)
Martha B. Helfer (Rutgers University New Brunswick)
Lothar Köhn (Westf. Wilhelms-Universität Münster)
Ian Wallace (University of Bath)
Trunkenheit
Kulturen des Rausches
Herausgegeben von
Thomas Strässle und Simon Zumsteg
Amsterdam - New York, NY 2008
Die 1972 gegründete Reihe erscheint seit 1977 in zwangloser Folge in der
Form von Thema-Bänden mit jeweils verantwortlichem Herausgeber.
Reihen-Herausgeber:
Prof. Dr. Gerd Labroisse
Sylter Str. 13A, 14199 Berlin, Deutschland
Tel./Fax: (49)30 89724235 E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Gerhard P. Knapp
University of Utah
Dept. of Languages and Literature, 255 S. Central Campus Dr. Rm. 1400
Salt Lake City, UT 84112, USA
Tel.: (1)801 581 7561, Fax (1)801 581 7581 (dienstl.)
bzw. Tel./Fax: (1)801 474 0869 (privat) E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Norbert Otto Eke
Universität Paderborn
Fakultät für Kulturwissenschaften, Warburger Str. 100, D - 33098 Paderborn,
Deutschland, E-Mail: [email protected]
Cover:
Paul Klee: Rausch (1939, 341 [Y 1]; Aquarell und Ölfarbe auf Jute, 65 x 80 cm).
Standort: Städtische Galerie im Lenbachhaus, München. © 2007, ProLitteris,
Zürich
All titles in the Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik
(from 1999 onwards) are available online: See www.rodopi.nl
Electronic access is included in print subscriptions.
The paper on which this book is printed meets the requirements of “ISO
9706:1994, Information and documentation - Paper for documents -
Requirements for permanence”.
ISBN: 978-90-420-2323-9
©Editions Rodopi B.V., Amsterdam – New York, NY 2008
Printed in The Netherlands
Inhaltsverzeichnis
Thomas Strässle und Simon Zumsteg:Einleitung 7
I. ABSOLUTE TRUNKENHEIT – TRUNKENHEIT DES ABSOLUTEN
Jean-Luc Nancy:Wirbel 13
II. KONZEPTIONEN DES DIONYSISCHEN
Karl Heinz Bohrer:Heißer und kalter Dionysos. Das Schillern einer
Metapher Nietzsches 19
Dieter Mersch:Ästhetik des Rausches und der Differenz.
Produktionsästhetik nach Nietzsche 35
Peter Fuchs:Dionysos im System. Anmerkungen zu ‘trunkener’
Sozialität 51
III. ÄSTHETIKEN DES RAUSCHES
Wolfgang Proß:Masse und Rausch. William Hogarth und Charles
Dickens 75
Richard Klein:Rausch und Zeit in Wagners Ring 101
IV. EKSTASEN DES REDENS
Barbara Naumann:Emphase. Madame de Staëls Improvisation
und die Trunkenheit der Rede 129
Magnus Wieland:Teuflische Trinker: Satan, Sokrates,
Sechsflaschenmann 153
Eckhard Schumacher:Die Kunst der Trunkenheit. Franz Kafkas Ein
Bericht für eine Akademie 175
V. LIEBESTRUNKENHEITEN
Mireille Schnyder:Die Angst vor der Ernüchterung. Liebestrunkenheit
zwischen Magie und Rhetorik in Heinrichs von dem Türlin Diu Crône 193
Sonja Osterwalder:“Alcohol is like love”. Chandler, Marlowe und
The Long Good-bye 205
VI. POETIKEN DER TROCKENEN TRUNKENHEIT
Dirk Niefanger:In “Plutons Hof-Capelle”. Tabakrausch in Sigmund
von Birkens Die Truckene Trunkenheit(1658) 225
Simon Zumsteg:Schallen und Rauchen. Zur poetologischen Funktion
der ‘trockenen Trunkenheit’in Hermann Burgers Brenner-Romanen 241
Thomas Strässle und Simon Zumsteg
Einleitung
“Erhabenes Wunder der Welt! Mein Geist erhebt sich in heiliger Trunkenheit,
wenn ich deine unermeßliche Pracht anstaune! Du erweckest mit deiner stum-
men Unendlichkeit Gedanken auf Gedanken und lässest das bewundernde
Gemüt nimmer in Ruhe kommen”.1Als Wilhelm Heinrich Wackenroder vor der
Peterskirche im Vatikan steht, gerät er unvermutet in einen anderen Zustand:
Überwältigt vom Anblick des erhabenen Bauwerks “erhebt sich” sein Geist
und eilt ruhelos von Gedanke zu Gedanke. Es ist ein seliger Taumel des
Phantasierens, ein Überschwang des Denkens, der von seinem Gemüt Besitz
ergreift: “heilige Trunkenheit”. In äußerster Verdichtung führt diese Passage
aus den Phantasien über die Kunstvor, was für die Trunkenheit allgemein gel-
ten kann: daß sie ein Zustand anderer Ordnung ist – exaltiert und ekstatisch,
exzentrisch und exzeptionell, exzessiv und enthusiastisch. In ihr ist vorüberge-
hend außer Kraft gesetzt, was ansonsten gilt. Es ist der Austritt aus einer
Ordnung und der Übertritt in eine andere, wodurch sich die Trunkenheit
ebenso kennzeichnet wie auszeichnet – kurz: die Figur der Transgression.
Vergleicht man die Ordnung der Trunkenheit mit jener der Nüchternheit, die
derTrunkene verläßt, in die er aber unweigerlich wieder zurückfallen muß, so
unterscheiden sie sich insbesondere in einem Punkt: In der Trunkenheit geht
jene Kontrolle verloren, auf die die Nüchternheit sich so viel einbildet. Der
Trunkene vermag nicht zu beherrschen, was ihn ergriffen hat. Vielmehr wird er
davon getrieben und getragen, und “nimmer” wird er, wie Wackenroder schreibt,
“in Ruhe kommen”, solange er nicht wieder nüchtern geworden ist. Diese
eigengesetzliche Unruhe verleiht der Ordnung der Trunkenheit ihr generatives
Prinzip: Sie ist vom Trunkenen weder vorgängig festlegbar, noch ist sie durch
ihn steuerbar, er verfügt nicht über sie, sondern sie entwickelt sich aus sich
selbst heraus, indem sie immerzu “Gedanken auf Gedanken” oder Wort auf
Wort oder Empfindung auf Empfindung folgen läßt. Gemessen am Muster der
Nüchternheit – und nur daran – ist die Trunkenheit entschieden unordentlich.
Mehr noch: In ihrer absoluten Ausprägung ist sie gar ein Zustand jenseits der
Möglichkeit von Ordnung. Absolute Trunkenheit als völlige Entdifferenzierung
hebt die Voraussetzung jeder Ordnung selbst, nämlich das Prinzip der Differenz,
aus den Angeln und weist insofern auch Verwandtschaften mit der Vorstellung
des (Ur-)Einen auf.
1Wilhelm Heinrich Wackenroder/Ludwig Tieck: Phantasien über die Kunst (1799).
Hg. von Wolfgang Nehring. Stuttgart: Reclam 1983. S. 36.
8
Wenn Wackenroder seine Trunkenheit angesichts der Peterskirche als “heilig”
apostrophiert, so schließt er damit an eine religiöse, im engeren Sinn mystische
Prägung des Begriffs an: an die “geistliche Trunkenheit”, eine Form religiöser
Entzückung und Entrückung.2Dadurch hebt er die Trunkenheit aber nicht nur
in die Sphäre romantischer Kunstreligion hinauf, sondern zugleich aus dem
alltagssprachlichen Wortgebrauch heraus. Denn meist wird die Trunkenheit –
schon um 1800 und noch heute – zunächst mit “Betrunkenheit” gleichgesetzt:
mit einem Rauschzustand, der vornehmlich durch Alkohol herbeigeführt wird.
Auch das Grimmsche Wörterbuch paraphrasiert die Vokabel an erster Stelle mit
“‘rausch, berauschtheit’nach alkoholgenusz”.3Freilich wird in der alkoholischen
Trunkenheit das Moment des Kontrollverlusts nur allzu offensichtlich: Der
Betrunkene verliert nicht nur die Gewalt über seinen Körper, indem er schwankt,
sondern auch über die Sprache, indem er lallt – und damit das geregelte Maß
der Wörter in einen Sprachfluß auflöst. Darin verlieren die Wörter ihre feste
Gestalt, und doch entsteht umgekehrt aus dem verflüssigten Sprachmaterial
zumindest auch ein neuer Klang, ein neuer Rhythmus. Dieser Kontrollverlust
kann aber natürlich nicht nur produktive, sondern auch destruktive Wirkungen
zeitigen. Die mit dem Exzeß einhergehende Enthemmung birgt, zumal für die
soziale Gemeinschaft, immer auch die Gefahr der Entfesselung unzensurierter
Kräfte, die in den Ausbruch von Gewalt münden – sei dies nun auf der individu-
ellen Ebene oder auf der kollektiven der Masse.4
Daß der alltagssprachliche Gebrauch der Vokabel “Trunkenheit” indes bei
weitem zu kurz greift, beklagt schon Goethe im Saki Nameh, dem Schenkenbuch
aus dem West-östlichen Divan, in dem zwar tüchtig gezecht, aber eben auch
ausgiebig geschwatzt und gedichtet, geliebt und gestritten wird. Eines der
Gedichte mahnt zu Beginn gerade die (polemische) Verengung des Begriffs
auf den Alkoholrausch an:
Sie haben wegen der Trunkenheit
Vielfältig uns verklagt,
Und haben von der Trunkenheit
Lange nicht genug gesagt.5
2Vgl. z.B. Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann(1675). Kritische Ausgabe.
Hg. von Louise Gnädinger. Stuttgart: Reclam 1984. S. 161 [IV. 57].
3Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig: Hirzel 1854–1960. Bd.
22 (1952). Sp. 1398.
4Zur Brutalität der Trunkenheit vgl. z.B. Michel de Montaigne: Die Essais (1608).
Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Arthur Franz. Stuttgart: Reclam 1999.
S. 166f. [II. 2].
5Johann Wolfgang Goethe: West-östlicher Divan (1819). In: Goethe: Sämtliche Werke.
Briefe, Tagebücher und Gespräche. Hg. von Hendrik Birus, Dieter Borchmeyer u.a.
Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 1985–1999. 1. Abt. Bd. 3/1 (1994). S. 107.
V. 1–4 (Bibliothek deutscher Klassiker 113).
9
Das Gedicht kontert die “vielfältigen Verklagungen” wegen zu hohen
Alkoholkonsums damit, daß es den Begriff der “Trunkenheit” auffächert und
ihn so aus seiner polemischen Vereindeutigung herausnimmt, ohne jedoch den
Aspekt der “Betrunkenheit” aus seinem semantischen Spektrum zu löschen:
Der Text spricht im Anschluß von “Lieb’, Lied und Weines Trunkenheit” (V. 17)
ebenso wie von “nüchterne[r] Trunkenheit” (V. 15) oder von “göttlichste[r]
Betrunkenheit” (V. 19).6
Doch hat selbst Goethe damit “lange nicht genug gesagt”. Der Begriff der
“Trunkenheit” ist noch umfassender: So entstand in Übertragung der alkoholi-
schen Trunkenheit auf ein erst in der Frühen Neuzeit in Europa aufgetauchtes
Genußmittel die Wendung von der “trockenen Trunkenheit”, die sich beim
“Tabaktrinken” einstellt. Beide Formen der Trunkenheit – alkoholische und
tabaccistische – gelten je nach Sichtweise als Laster oder, gerade in literarischen
Texten, als Zustände der Inspiration. Keiner moralischen Bewertung ausgesetzt
dagegen sehen sich all jene Formen von Trunkenheit, die auch ohne Einnahme
stofflicher Stimulantien herbeigeführt werden können: Zustände gesteigerter bis
überbordender Empfindsamkeit wie beispielsweise nebst der “Liebestrunkenheit”
auch die “Glückstrunkenheit” oder die “Freudentrunkenheit”. Allesamt sind sie
Modi des ‘Außer-sich-Seins’, Überschreitungen einer emotionalen ‘Normalität’.
Die “Schlaftrunkenheit” schließlich belegt vielleicht am deutlichsten die These
zweier konkurrierender Ordnungen: Wer “schlaftrunken” durch den Tag geht,
gehört eigentlich der Nacht.
So vielfältig der Begriff “Trunkenheit” lesbar ist, so vielschichtig sind auch
seine Beziehungen zu einem weiten Begriffsfeld, die er über die Momente des
Transgressiven, des Ephemeren und des Autopoietischen unterhält. Hierzu
gehören namentlich “Rausch” und “Ekstase”, aber auch Begriffe wie das
“Dionysische”, die “Trance”, der “Taumel” oder “Schwindel”. Auch wenn jeder
dieser Ausdrücke seine eigene Begriffsgeschichte und sein eigenes Spektrum an
Konnotationen aufweist: Gemeinsam ist ihnen – ebenso wie der Trunkenheit in
all ihren genannten Formen –, daß sie auf einen (Bewußtseins-)Zustand ver-
weisen, in dem interimistisch ein Modus der ‘Normalität’überschritten ist, und
zwar dadurch, daß eine kontemplative, reflexive oder emotionale Distanz zugun-
sten einer Steigerung der Intensität eingezogen wird. Um diese Grundfigur
und auf diesem Begriffsfeld kreisen die Beiträge, die der vorliegende Band
versammelt.
Unser Dank gilt den Reihen-Herausgebern der Amsterdamer Beiträge zur
neueren Germanistikund Marieke Schilling vom Rodopi-Verlag für die sorgfältige
Betreuungdieser Publikation sowie allen Autorinnen und Autoren, daßsie uns
ihre Originalbeiträge zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben.
Paris und Zürich, im Mai 2007
6Ebd. S. 108.