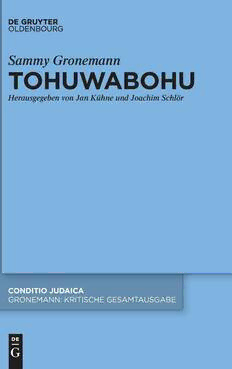Table Of ContentSammy Gronemann: Kritische Gesamtausgabe
Tohuwabohu
Conditio Judaica
Studien und Quellen zur deutsch-jüdischen
Literatur- und Kulturgeschichte
Herausgegeben von
Hans Otto Horch
In Verbindung mit Alfred Bodenheimer, Mark H. Gelber
und Jakob Hessing
Band 92/2
Sammy Gronemann:
Kritische Gesamtausgabe
Tohuwabohu
Herausgegeben von Jan Kühne
und Joachim Schlör
Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT
ISBN 978-3-11-062549-3
e-ISBN (PDF) 978-3-11-062937-8
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-062580-6
ISSN 0941-5866
Library of Congress Control Number: 2019936232
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de
abrufbar.
© 2019 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
♾ Printed on acid-free paper
Printed in Germany
www.degruyter.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung VII
Zur Entstehung VII
Zum Inhalt IX
Zur vorliegenden Ausgabe X
Biographisch-Historischer Kontext XII
Die Exzesse in Schitomir (Brief von Sonja Gronemann) XVII
Zwischen Witz und Zeugnis XX
Editorische Hinweise XXIII
Danksagungen XXIV
Text
Sammy Gronemann: Tohuwabohu 3
Goethe in Borytschew 5
Ein literarisches Unternehmen 30
Eine fromme Stiftung 48
Seelsorge 72
Paradiesäpfel 102
Ostergeläute 122
Posaunentöne 150
Der Minjan-Mann 176
Die Erstgeborenen 195
Abwehr 217
Pogrom 237
Die grosse Woche 259
Anhang
Zur Rezeption 287
Auflagen und Verlage 287
Übersetzungen 288
Zeitgenössische Rezension 290
Kritische Rezeption 299
„Tohuwabohu“: Eine kleine Begriffsgeschichte 304
VI Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis 311
Abkürzungen 311
Primärquellen 311
Sekundärquellen 314
Personen- und Werkregister 319
Sach- und Ortsregister 321
Einleitung
Zur Entstehung
„Die leichte Form, die mir nun einmal eigen ist, täuscht oft darüber hinweg, daß
ich es bitter ernst meine, in dem was ich sage und berichte“,1 schreibt Sammy
Gronemann (1875–1952) in seinen Erinnerungen eines Optimisten.2 Immer wieder
kommt er darin auf Anekdoten zu sprechen, die er „verwertet“ habe in seinem
Roman Tohuwabohu, auf den sich diese Aussage bezieht und „in dem sich über-
haupt kaum eine Episode befindet, die nicht auf tatsächliche Vorgänge“ zurück-
gehe.3
Seinen Erinnerungen zufolge hatte Gronemann als deutscher Soldat in der
Presseabteilung Ober-Ost in Kowno „eines Tages“ im Jahre 1916 jenen Anfangs-
satz „hingeschrieben“, aus dem sich sein literarisches Erfolgsdebut Tohuwabohu
chaotisch und in „labyrinthischen Irrgängen“ entwickelte:4 „Berl Weinstein hatte
sich wieder einmal taufen lassen, und diesmal mit besonderem Erfolg.“ Wie jeder
Witz verweist auch dieser auf einen ernsten Hintergrund. Hier ist es die Praxis des
sogenannten „Shmaddgeld“5 – Geld, mit denen Juden zur Taufe gelockt wurden,
und das sich hier ein osteuropäischer Jude auf findige Art und Weise zu Nutzen
macht.
Tohuwabohu entstand somit spontan aus einem Witz und entwickelte sich
intuitiv: „Mir scheint, ich schreibe gar nicht, sondern irgend etwas anderes oder
ein anderer schreibt durch mich. Jedenfalls ein seltsames Gespenst, das gerade
meine Handschrift bevorzugt“, berichtet Gronemann seiner Frau Sonja in einem
1 Sammy Gronemann: Erinnerungen an meine Jahre in Berlin. Hg. Joachim Schlör. Berlin 2004,
Kap. XXXIV, 275.
2 Entstanden sind diese Erinnerungen in den 1940er Jahren in Tel Aviv, wo 1946 der erste Band
in hebräischer Übersetzung unter dem Titel Erinnerungen eines Jeckes, also eines deutschspra-
chigen Juden erschien. In dt. Originalsprache wurden sie erst 2002 und 2004, in zwei Bänden von
Joachim Schlör herausgegeben. Idem.: Erinnerungen. Hg. Joachim Schlör. Berlin 2002. Vgl. Idem:
Erinnerungen eines Optimisten. Jedioth Chadashoth (23. 4. 1948 – 25. 3. 1949); Idem.: לש תונורכז
הקי [Erinnerungen eines Jecken]. Übers. Dov Sadan. Tel Aviv 1946.
3 Idem., Erinnerungen, Kap. V, 58.
4 Idem., Erinnerungen an meine Jahre, Kap. XXXIV, 277.
5 Jidd. Kompositum aus dt. „Geld“ und hebr. „shamad“ (דמש), d. h. „vernichten“. Im Jiddischen
bezeichnet das Nomen „Schmad“ und das Verb „schmadden“ respektive Charakter und Akt des
Übertritts zu nichtjüdischer Religionspraxis. Abraham Tendlau: Sprichwörter und Redensarten
deutsch-jüdischer Vorzeit. Berlin 1934 (1860), 111. Vgl.: „Ein Meschummed!! […] ein Abtrünniger,
der den Glauben seiner Väter, der sein Volk verraten und verlassen hatte.“ Unten, S. 253. Dank
an Jakob Hessing für seinen Hinweis auf diese Praxis.
https://doi.org/10.1515/9783110629378-001
VIII Einleitung
Brief vom 16. Dezember 1916, und fährt fort: „Aber es ist so. Es geht rascher, als
ich denke, und ich lese mit Staunen und wie etwas ganz Neues, was ich eben
geschrieben habe …“.6 Ende Dezember dann, mitten im Ersten Weltkrieg, bekam
Gronemann Urlaub nach Berlin. Dort las er in „intimen Kreise bei uns zu Hause
die damals vollendeten ersten fünf Abschnitte“ vor und
war über die günstige Aufnahme, die sie fanden, sehr erfreut. Freilich muß ich gestehen,
daß ich mir die Zuhörerschaft dadurch geneigt gemacht hatte, daß ich einen Karton Würst-
chen – damals eine unerhörte Delikatesse in Berlin – mitgebracht hatte, deren Genuß
während der Vorlesungspause sicher stimmungshebend war.7
Gronemann hatte ideale Bedingungen für das Verfassen seines Romans vorgefun-
den, als er infolge des Separatfriedens von Brest-Litowsk (März 1918) von der Ost-
an die Westfront versetzt wurde, wo er „in Brüssel, in dem netten Gartenhäuschen
hinter der Pressestelle“ nun „alle Gelegenheit“ hatte, sich „in Muße der Arbeit an
meinem ‚Tohuwabohu‘ zu widmen.“8 Seine amtliche Tätigkeit nahm nur wenig
Zeit in Anspruch und so traf er sich auch regelmäßig mit Carl Sternheim, Grone-
mann zufolge der „bedeutendste Satiriker und Komödienschreiber seiner Zeit.“9
Aus ihren gemeinsamen „täglichen Spaziergängen“ schöpfte Gronemann „viel
Anregung“ und kehrte schließlich am Ende des Krieges, vom „Bazillus poeticus“
infiziert, heim – ein Heim, das sich damals noch in Berlin befand.10 Gronemanns
literarische „Krankheit“, wie er seinen Roman bezeichnete, war „in ein ernsteres
Stadium“ getreten:11 1920 wurde Tohuwabohu im Welt-Verlag veröffentlicht und
sofort ein Bestseller, der kontroverse Reaktionen auslöste (s. Anhang).
Zwischen Gronemanns Tohuwabohu und seinen Erinnerungen eines Opti-
misten liegen dreißig Jahre deutscher und jüdischer Geschichte. Diese sind vom
Standpunkt heutiger Leser vor allem durch die Shoah geprägt. In der Tat wollte
Gronemann seine Zeitgenossen humorvoll vor pogrom-ähnlichen Entwicklungen
warnen — mit seinem Roman Tohuwabohu, der nur zum gespielten Erstaunen
seines Verfassers „vielfach als ein humoristisches Werk angesehen“ wurde.12
Denn Gronemann sah den Juden als einen „unverbesserlichen Optimisten“:
6 Gronemann, Erinnerungen an meine Jahre, Kap. XXXIV, 277.
7 Ibid.
8 Ibid., Kap. XXXVII, 304.
9 Ibid., 308.
10 Zum Einfluss der Urbanität auf Gronemann, Joachim Schlör: Das Ich der Stadt: Debatten über
Judentum und Urbanität, 1822–1938. Göttingen 2005, 110, 419 f.
11 Gronemann, Erinnerungen an meine Jahre, Kap. XXXIV, 275.
12 Ibid.
Einleitung IX
Auch im schlimmsten Fall – egal, was passiert – sagt er: „Auch dies ist zum Guten.“ Er ver-
tritt jene Weltanschauung, die man im Deutschen mit „Wenn Schon“ bezeichnet. Um diese
Weltanschauung zu verteidigen bedient er sich der Waffe des Witzes. Doch seinem Humor
und Witz wird nie der tragische Hintergrund fehlen.13
Diese Ausgabe hat es sich daher zum Ziel gesetzt, Tohuwabohu als mehrschichti-
ges, historisches Dokument lesbar zu machen. Sie will, nebst seinem Witz, auch
dessen „tragischen Hintergrund“ erläutern, der in der zeitgenössischen Rezep-
tion von der Würdigung des Romans als literarische, weil satirische Besonderheit
des deutschen Zionismus überlagert wurde. „Von diesem klugen Buch kommt
keiner los, der es nur aufblättert“, schrieb beispielsweise der Zionist Theodor
Zlocisti 1920 in seiner Rezension von Tohuwabohu: „Ein Sprühfeuer von Witz,
Spott und überlegenem Geist empfängt uns und jähe Lichter erhellen — schmerz-
haft grell! — die dunkle Seele eines durcheinandergewirbelten Volkes, über das
nur lächeln kann, wer es aufrichtig beweint.“14 Ein Lachen unter Tränen also,15
oder – so sah es Gronemann – ein sich unter Lachen verschleierndes Weinen und
darüber hinweghelfendes Augenzwinkern.
Zum Inhalt
Die Handlung des satirischen Romans beginnt im Frühjahr 1903 im fiktiven,
bei Wilna gelegenen Ort Borytschew mit einer Diskussion zwischen dem geset-
zestreuen Jossel Schlenker und der scharfsinnigen Chane Weinstein über die
religiösen Bestimmungen zum Schabbat. Dabei erweist sich Jossels halachisch
begründete Argumentation Chanes Witz und Ironie gegenüber als unterlegen. In
der Folge verlieben sich Jossel und Chane, heiraten und siedeln nach Berlin über,
um mittels des Universitätsstudiums ihrem Freiheits- und Wissensdrang zu folgen
sowie der beengenden Lebenswelt des östlichen Europa, nicht aber der jüdischen
Tradition zu entfliehen. Anhand von Jossels und Chanes Erlebnissen zeichnet
13 Sammy Gronemann: „ידוהיה לש רומוההו החידבה [Jüdischer Witz und Humor]“. Bamah 45
(1945), 37.
14 Theodor Zlocisti: „Das juedische Chaos (Tohuwabohu)“. Ost und West 7–8 (Juli 1920), 199.
15 Ein Topos der Gronemann-Rezeption, das als Merkmal des jiddischen Autors Schalom Alei-
chem gilt, und hier – im Jahre 1920 – schon vorwegnimmt, dass Gronemann später als „Schalom
Aleichem der Jeckes“ in die Geschichtsschreibung eingehen wird. Angedeutet wird dabei auch
eine Fortsetzung osteuropäisch-jüdischer literarischer Traditionen in der deutschen Literatur an-
hand von Gronemanns Werken. Vgl. Theodor Weisselberger: „Sammy Gronemann zum Gruss“.
Ostjüdische Zeitung (31. 5. 1936), 1. Schalom Ben-Chorin: „Der Schalom Alejchem der Jeckes Zu
Sammy Gronemanns 25. Todestag“. Mitteilungsblatt des „Irgun Olei Merkas Europa“ 9 (4. 3. 1977).
X Einleitung
Gronemann ein ebenso schillerndes wie humorvolles Porträt jüdischen Lebens
in Berlin, ein Kaleidoskop grotesker Verzerrungen der jüdischen Tradition infolge
der Emanzipation – ein striktes Festhalten an rigiden religiösen Vorschriften auf
der einen und Abfall vom Judentum durch Assimilation und Konversion zum
Christentum auf der anderen Seite. Das von Jossel verkörperte jüdische Leben im
östlichen Europa wird dabei als natürliches Gleichmaß präsentiert, an dem die
Lebensformen deutscher Juden satirisch kontrastiert werden.
In Berlin lernt Jossel seinen Großcousin Heinz Lehnsen kennen, der in dessen
Familie die zweite Generation von Konvertiten vertritt. Er lädt Heinz nach Bory-
tschew ein, wo dieser zum ersten Mal das Pessachfest erlebt. Als beim rituellen
Sederabend die Haustür symbolisch für den Propheten Elija geöffnet wird, nähert
sich der Lärm eines Pogroms. Heinz versteht, dass Selbstwehr und politisches
Handeln nötig sind. Sein Selbst- und Weltbild werden nachhaltig erschüttert.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland verdrängt er diese Erfahrung und wähnt
sich in Sicherheit. Zur Zerstreuung reist er nach Baden-Baden. Im selben Zug
befinden sich Jossel und Chane, die Heinz jedoch meidet. Während sich Heinz auf
dem Weg zu einem Pferderennen mit trivialen Fragen beschäftigt, reisen Jossel
und Chane zum sechsten Zionistenkongress nach Basel. Mit diesem indirekten
Ausblick auf die Verwirklichung des modernen Judenstaats schließt der Roman.
Zur vorliegenden Ausgabe
„Kunstwerk?“ fragt Zlocisti in seiner Rezension von Gronemanns Tohuwabohu
und gibt sich selbst Antwort:
Gronemanns Tohuwabohu ist ein Dokument; ein Querschnitt durch die neujüdische Kultur-
geschichte, durch den die Schichtungsbedingungen und Lagerungsverhältnisse nach einer
katastrophalen seelischen Revolution sichtbar werden. Spätere Historiker werden dieses
scheinbar so heitere Buch würdigen. Ob sie alle Pointen, Anspielungen, Beziehungen auch
verstehen werden?16
Die Frage ist auch an uns heutige Leser gerichtet. Zlocisti konnte nicht ahnen,
durch welche weiteren Schichten der deutsch-jüdischen Geschichte und der sie
beinahe vollständig zerstörenden Katastrophe spätere Leser und Historiker sich
arbeiten müssen, um sich dem von Gronemann beschriebenen Tohuwabohu zu
nähern. Dabei fällt es schwer, Gronemanns noch im Jahre 1945 ausdrücklich geäu-
ßerten Optimismus zu teilen, dass auch der „schlimmste Fall – egal, was pas-
16 Zlocisti, Das juedische Chaos (Tohuwabohu), 199.