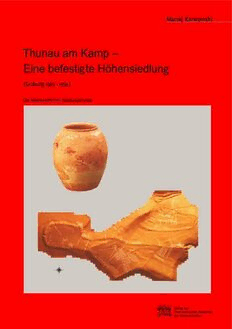Table Of Content(Grabung 1965 - 1990)
Maciej Karwowski
Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965 - 1990)
Die latènezeitlichen Siedlungsfunde
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Philosophisch-historische Klasse
M P K
ITTEILUNGEN DER RÄHISTORISCHEN OMMISSION
Herausgegeben von Herwig Friesinger
BAND 61
Redaktion: Michaela Lochner
Maciej Karwowski
THUNAU AM KAMP – EINE BEFESTIGTE HÖHENSIEDLUNG
(GRABUNG 1965 - 1990)
Die latènezeitlichen Siedlungsfunde
V
ERLAG DER
Ö A W
STERREICHISCHEN KADEMIE DER ISSENSCHAFTEN
Wien 2006
Vorgelegt von w. M. Herwig Friesinger in der Sitzung am 14. Oktober 2005
Gedruckt mit Unterstützung durch die
Abteilung Kultur und Wissenschaft
des Amtes der NÖ Landesregierung
und die Alexander von Humboldt-Stiftung
Umschlagbild:
Thunau am Kamp, Gefaß aus der Siedlung [0097]
Aufnahme:
Maciej Karwowski
Ausschnitt aus dem geographischen Informationssystem mit 3D-Modell der
befestigten Höhensiedlung von Thunau am Kamp mit eingetragenen
Grabungsschnitten der Jahre 1965-1990
Herstellung:
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, M. Doneus
Lektorat: Eleonore Melichar
Layoutkonzept: Thomas Melichar
Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt,
frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig.
Alle Rechte vorbehalten
ISSN 3-7001-3603-X
ISSN 0065-5376
Copyright © 2006 by
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Gesamtherstellung: Crossdesign Weitzer, A-8042 Graz
http://hw.oeaw.ac.at/3603-X
http://verlag.oeaw.ac.at
5
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung – 7
2. Fundstelle – 9
3. Keramikfunde – 20
3.1 Tontypen – 20
3.2 Beschreibung und Typologie der Keramikerzeugnisse – 23
3.2.1 Gefäßkeramik – Mündungen von hohen Gefäßen – 23
3.2.2 Gefäßkeramik – Mündungen breiter Gefäße – 29
3.2.3 Gefäßkeramik – schwer bestimmbare Mündungsfragmente – 32
3.2.4 Gefäßkeramik – Böden – 32
3.2.5 Gefäßkeramik – Wandungsreste – 34
3.2.6 Scheiben aus Wandungsscherben – 34
3.2.7 Spinnwirtel – 35
3.2.8 Tonfragment – 35
3.3 Zusätzliche Elemente an den Oberflächen von Gefäßkeramik – 36
3.3.1 Kammstrich – Feinkammstrich – Besenstrich – 36
3.3.2 Glättlinien – Ritzlinien – Rillen – Kehlen – 42
3.3.3 Horizontale plastische Leisten – 43
3.3.4 Bemalung – 45
3.3.5 Beidseitige Polierung der Oberfläche – 46
3.3.6 Pech- und Rußspuren – 46
3.3.7 Durchbohrungen – 46
3.3.8 Ein- und Abdrücke – 47
4. Nichtkeramische Funde – 48
4.1 Metallfunde – 48
4.1.1 Fibeln – 48
4.1.2 Sonstige Metallfunde – 49
4.2 Glasfunde – 51
4.2.1 Armringe – 51
4.2.2 Noppen-Perle – 53
5. Auswertung und Chronologie – 54
5.1. Die Keramik der frühen Latènezeit – 54
5.2. Die Keramik der mittleren und späten Latènezeit – 56
5.3. Metallschmuck und Trachtzubehör – 63
5.4. Glasschmuck – 64
5.5. Bronzene Attasche – 66
5.6. Eisengeräte – 67
6 Inhaltsverzeichnis
6. Schlussbemerkungen – 69
7. Katalog – 71
8. Literatur – 108
9. Tafeln – 115
7
1. Einleitung
Thunau am Kamp gehört zu den wichtigsten archäologi- Großteil der Schweiz und Österreichs sowie Böhmen, Mäh-
schen Fundstellen Ostösterreichs. Im Laufe der langjährigen ren, die Slowakei, Ungarn, Siebenbürgen wie auch einen
Ausgrabungen konnten dort reiche, sowohl vor- als auch Teil Serbiens, Sloweniens, Kroatiens und der Transkarpaten-
frühgeschichtliche Besiedlungsspuren entdeckt werden. Die Ukraine umfasst. Deutliche Elemente der Latènekultur sind
späteisenzeitlichen, mit der Besiedlung der Latènekultur in auch in Südbritannien, Norditalien sowie nördlich der Kar-
diesem Gebiet, damit also mit der Anwesenheit der kelti- paten und Sudeten fassbar. Zahlreiche keltische Völkerschaf-
schen Stämme in dieser Region zusammenhängenden Fun- ten West- (ein beträchtlicher Teil der Britischen Inseln),
de, die den Gegenstand der vorliegenden Bearbeitung bilden, Süd- (Spanien) und Südosteuropas sowie Kleinasiens gerie-
stellen einen wichtigen Bestandteil des aus Ausgrabungen ten in den Bereich der starken Einwirkungen der eigentli-
gewonnenen Fundmaterials dar. Sie stammen größtenteils chen Latènekultur.
aus den 1965–1990 von H. Friesinger geleiteten Ausgrabun- Die Kelten hatten eine Reihe von neuartigen technischen
gen; spärliche Fundstücke stammen allerdings aus den For- Lösungen übernommen und gleichzeitig auch selbst viele
schungen von J. Höbarth im Jahre 1944. Es handelt sich Verbesserungen vorgenommen und zahlreiche Erfindungen
dabei fast ausschließlich um bisher unpublizierte Funde. gemacht. Eine der wichtigen chronologischen Zäsuren war
Die Genese des von den Griechen als Κελτοι, von den diesbezüglich der Vorstoß der Kelten nach Makedonien,
Römern als Celtae oder Galii bezeichneten Volkes ist bis Thrakien und Griechenland bis Delphi im Jahre 279 v. Chr.
heute unbekannt und ruft viele Kontroversen hervor. Die Im Rahmen der Rückzugswellen vom Balkan kam es zur
ältesten Quellen erwähnen die Sitze der Kelten im oberen endgültigen Ausformung der keltischen Besiedlung im Ost-
Donaugebiet (Herodot von Halikarnassos). Bekanntlich bereich der Latènekultur. In dieser Zeit setzt im Bereich der
gehören die Kelten einer großen, die indoeuropäischen Besiedlungs-, Wirtschafts- und wohl auch Gesellschaftsver-
Sprachen nutzenden Völkerfamilie an. Als diese Völker im hältnisse eine deutliche Wende ein, die für den Anbeginn
ausgedehnten eurasischen Raum in Erscheinung getreten der mittleren Latènezeit bestimmend ist und bald zur Her-
waren, besiedelten die Kelten den westlichen Teil dieses ausbildung der hoch stehenden Oppida-Kultur führt. Die
Raumes, der dort an die älteren Stammesgebiete der Ligurer Oppida, große Burgen mit einer Fläche bis zu mehreren
und Iberer angrenzte. Die allerfrühesten Sitze der Kelten hundert Hektar, waren die Zentren des politischen und
lagen in der frühen Eisenzeit im Verbreitungsbereich der wirtschaftlichen Lebens. Sie geben Zeugnis davon, dass die
Westhallstatt-Kultur. Es handelt sich dabei um die erste Kelten in der Zeit ihrer größten Machtentfaltung die
archäologische Kultur, in der aller Wahrscheinlichkeit nach Grundlagen für die städtischen Zentren gesetzt hatten.
keltische Stämme fassbar werden. Durch den relativ engen Die Vorherrschaft der Kelten im europäischen Raum fand
Kontakt mit der griechischen Zivilisation des westlichen bald nach den Eroberungen Caesars ihr Ende. Zum Unter-
Mittelmeerraumes und in späterer Zeit auch mit den Etrus- gang ihrer Kultur hatten außer dem Römischen Reich die
kern erfährt die sozial-wirtschaftliche Entwicklung im Daker beigetragen, die die Kelten als eine im unteren Do-
Verbreitungsbereich der Westhallstatt-Kultur einen abrup- naugebiet führende politische Macht eliminiert hatten, und
ten Aufschwung. In den Hauptzentren dieser Kultur setzte die Germanen, die im mittleren und oberen Donaugebiet
die Anwendung der Töpferscheibe und der Drechselbank sowie östlich vom Rhein Druck auf die Kelten ausübten.
ein, auch die Buntmetall- und Eisenverarbeitungsverfahren Die Gebiete von Böhmen und Mähren wurden von dem
entwickelten sich deutlich. germanischen Stamm der Markomannen besetzt, die dort
Im Gebiet der Westhallstatt-Kultur entwickeln sich dann die keltischen Boier verdrängt hatten.
der Frühlatènestil und die den historisch belegten Kelten Die Latènekultur spielte bei der Herausbildung der Kul-
entsprechende Latènekultur. Diese bildet einen Kulturkom- turen der im Norden und Osten an die Kelten angrenzenden
plex, der Ost- und Mittelfrankreich, Süddeutschland, einen Stämme eine wesentliche Rolle. Diese Einwirkungen haben
8 Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990). Die latènezeitlichen Siedlungsfunde
im Bereich der Wirtschaft und der materiellen Kultur wie Die vorliegende Bearbeitung entstand in Zusammenarbeit
auch auf dem Gebiet der sozialen Verhältnisse und wohl mit einer Reihe von Personen, denen an dieser Stelle mein
auch der geistigen Kultur ihren Niederschlag gefunden. Die bester Dank gebührt. Zu danken habe ich in erster Linie
stärkste keltische Ausstrahlung auf diese Stämme fällt in die Prof. Dr. Herwig Friesinger, für den mir erwiesenen Bei-
Blütezeit der Oppida (ab dem 2. Jh. v. Chr.). In dieser Zeit stand und das freundlicherweise zur Verfügung gestellte
erfolgt der Prozess der Latènisierung des nördlichen Mittel- Material aus seinen langjährigen Forschungen. Für wertvol-
europas und in gewissem Maße sogar auch der dakischen le Informationen über den Grabungsverlauf und die Hilfe
und getischen Kultur. bei der Erschließung der Grabungsdokumentation möchte
Die ersten Besiedlungsspuren der Latènekultur im ostös- ich mich auch bei Prof. Dr. Erik Szameit sowie Mag. Beate
terreichischen Gebiet erscheinen bereits in der frühen Lethmayer sehr herzlich bedanken. Mein bester Dank gilt
Latènezeit, wahrscheinlich als das Ergebnis der frühesten auch Herrn Werner Murtinger vom Höbarthmuseum in
Migrationsbewegungen der keltischen Stämme nach dem Horn für die Zur-Verfügung-Stellung des in diesem Muse-
Osten. Zu Beginn der mittleren Latènezeit ist die Latène- um aufbewahrten Materials. Besonderen Dank für den
kultur im behandelten Gebiet den tief greifenden Umwand- Beitrag zur Entstehung der vorliegenden Bearbeitung schul-
lungen im Bestattungsritus ausgesetzt, was letzten Endes zu de ich nicht zuletzt auch Dr. Alois Stuppner.
einem völligen Schwund der Gräberfelder führt, wie dies Die Zeichnungen der behandelten Fundstücke wurden,
auch in ihren zahlreichen anderen Verbreitungsbereichen soweit nicht anders vermerkt, von Mag. Beate Lethmayer
der Fall ist. Andererseits zeichnet sich eine deutliche Ver- angefertigt. Die Fotos wurden, falls nicht anders angegeben,
dichtung der Besiedlung ab. In diesem Zeitraum setzt in den im Fotolabor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte in
Besiedlungsverhältnissen eine Wende ein, in deren Folge in Wien durch Olivia Chrstos, Andreas Jurkowitsch und Ni-
der mittleren und späten Latènezeit sich eine voll ausgepräg- cola Sautner aufgenommen.
te Latènekultur entwickelt. Die endgültige Fassung der vorliegenden Arbeit entstand
Die Frage des Ausklingens der Latènekultur im behandel- während meines Aufenthalts am Vorgeschichtlichen Semi-
ten Gebiet sowie der begleitenden historischen Ereignisse ist nar der Philipps-Universität zu Marburg im Rahmen eines
nicht vollends geklärt. Dieser Abbruch wird offensichtlich von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung finanzierten
mit dem Untergang der keltischen Besiedlung in Mähren, Stipendiums. Meinem wissenschaftlichen Gastgeber in Mar-
d.h. in der Phase LT D1, erfolgt sein. Nicht ausgeschlossen burg, Prof. Dr. Andreas Müller-Karpe, möchte ich auch an
ist allerdings eine lokale Fortsetzung mancher Elemente der dieser Stelle meinen herzlichen Dank zum Ausdruck brin-
Latènekultur, möglicherweise in etwas veränderter Form. gen.