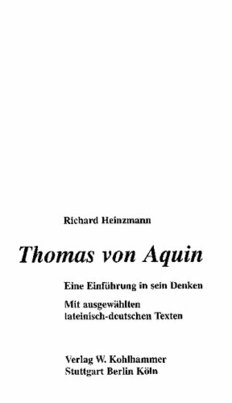Table Of ContentRichard Heinzmann
Thomas von Aquin
Eine Einführung in sein Denken
Mit ausgewählten
lateinisch-deutschen Texten
Verlag W. Kohlhammer
Stuttgart Berlin Köln
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Heinzmann, Richard:
Thomas von Aquin : eine Einführung in sein Denken ;
mit ausgewählten lateinisch-deutschen Texten /
Richard Heinzmann. - Stuttgart; Berlin ; Köln :
Kohlhammer, 1994
(Urban-Taschenbücher ; Bd. 447)
ISBN 3-17-011776-9
NE: GT
Universitäts-
Bibliothek
München
Umschlagbild: Sandro Botticelli (1444 - 1510 Florenz)
Hl. Thomas von Aquin
Öl auf Leinwand über Holz
50 x 36 cm
Abegg-Stiftung Bern in Riggisberg
Alle Rechte vorbehalten
© 1994 W. Kohlhammer GmbH
Stuttgart Berlin Köln
Verlagsort: Stuttgart
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. Stuttgart
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
Einleitung 9
Erster Teil:
Einführung in das Denken des
Thomas von Aquin 13
A. Die geistesgeschichtliche Lage:
Die Scholastik des Mittelalters 13
I. Griechisches und christliches Denken 13
II. Scholastik des Mittelalters 18
B. Leben und Werk 22
I. Leben 22
II. Werk 23
C. Der philosophische Grundgedanke 26
I. Zum Verhältnis von Philosophie und Theologie 26
1. Thomas als Theologe 26
2. Thomas als Philosoph 27
II. Die Frage nach der Welt: Analyse des ens 31
1. Der Seinsbegriff 31
^ I 2. Seins- und Denkgesetze 32
1 \ 3. Nichtdefinierbarkeit des Seinsbegriffs 34
J 4. Die Kategorien 35
£ X 5. Analogie des Seins 36
^ I 6. Die Transzendentalien 37
j$ I 7. Akt und Potenz 39
^ J 8. Materie und Form 41
> x 9. Wesen und Dasein 42
5
Einleitung
Die Zielsetzung dieser Einführung ist es, in enger Rückbindung an die
Quellen einen Zugang zum Denken des Thomas von Aquin zu eröff
nen; darüber hinaus soll anhand größerer Textabschnitte ein Durch
blick durch sein Werk geboten werden.
Ein so umfangreiches Werk wie das des Thomas von Aquin - laut
EDV-Information besteht es aus 8 767 654 Wörtern - wirft naturgemäß
besondere Probleme auf, und zwar sowohl hinsichtlich der Auswahl
der Themen wie auch der Texte, mit denen diese belegt werden sollen.
Erschwerend kommt hinzu, daß es unmöglich ist, einzelne Fragen iso
liert zu behandeln, ausgewählte Texte für sich zu kommentieren, da als
Zugang für ein angemessenes Verständnis Grundkenntnisse mittelalter
licher und insbesondere thomasischer Philosophie unverzichtbare
Voraussetzung sind. So mußte beides geleistet werden: die Vermittlung
des philosophischen Horizontes und die Erschließung einzelner
Problemkreise.
Die Einführung verfolgt deshalb die Absicht, den philosophischen
Grundgedanken des Aquinaten so zu entfalten, daß er aus sich selbst
ohne Rückgriff auf die ausgewählten Texte Verstanden und nachvoll
zogen werden kann. Die einzelnen Schritte dieser zusammenhängen
den Explikation thomasischer Philosophie werden durch die ausge
wählten Texte begleitend dokumentiert, während umgekehrt vom Gan
zen dieser Einführung her die Texte erläutert und aufgeschlossen wer
den. Diese Absicht, das Ganze methodisch in einer gewissen Geschlos
senheit und inneren Einheit zu entfalten, ist zugleich ein vorentschei
dendes Kriterium über die Inhalte der aufzunehmenden Texte.
Damit ist der Gesamtaufriß vorgegeben. Nach einer Skizze des gei
stesgeschichtlichen Horizontes, in dem Thomas steht, kommen Leben
und Werk des Aquinaten kurz zur Darstellung. Das Hauptgewicht liegt
bei der Entwicklung des philosophischen Grundgedankens, der sich als
Philosophie des Aufstiegs von der Welt zu Gott, vom ens zum ipsum
esse subsistens darstellt. Auf die fachwissenschaftliche Diskussion ab
weichender Richtungen der Thomas-Interpretation konnte in einer sol
chen ersten Hinführung verständlicherweise nicht eingegangen wer
den. Einige Gedanken zur Bedeutung des Thomas für den Gang des
abendländischen Denkens im ganzen beschließen den Ersten Teil.
Im Zweiten Teil kommt der Erklärung wichtiger philosophischer
Begriffe besondere Bedeutung zu, da die Kenntnis der Terminologie
9
naturgemäß unabdingbare Voraussetzung für ein angemessenes Ver
ständnis eines Textes ist. Der philosophiegeschichtlichen Information
und Orientierung soll das Verzeichnis der Autoren und geistigen Be
wegungen aus Antike, Patristik und Mittelalter dienen.
Die im Dritten Teil vorgelegten Texte sind so gewählt, daß die Ent
faltung des philosophischen Grundgedankens im Werk des Thomas
selbst nachvollzogen werden kann. Auf diese Weise wird die allge
meine Einführung zum speziellen Textkommentar. Der Vorteil liegt da
bei darin, daß die einzelnen Passagen im Kontext des Ganzen aus
gelegt werden können, wobei das Gewicht auf dem großen Zusammen
hang liegt und die Einzelanalysen zurücktreten. Durch entsprechende
Verweise zwischen Teil I und III kann der Textteil von kommentieren
den Bemerkungen völlig freigehalten werden. Alle Texte werden in der
Einführung angesprochen, aber nicht alle angesprochenen Probleme
werden durch Texte mit gleicher Ausführlichkeit dokumentiert.
Bei der Textauswahl wurde nicht nur auf inhaltliche Gesichtspunkte
geachtet. Es war auch das Bemühen, aus allen wichtigen Werkgattun
gen des Thomas Partien aufzunehmen. Jede Übersetzung bedeutet Ver
lust an inhaltlicher Präzision. Das damit verbundene Unbehagen wird
sowohl hinsichtlich der übernommenen als auch der eigens angefer
tigten Übersetzungen dadurch gemindert, daß das Original mit abge
druckt ist. Die deutsche Version kann somit als Hinführung zum latei
nischen Text gelesen werden. Auf den kritischen Apparat und die
Quellennachweise wurde verzichtet.
Um die Quellen noch umfangreicher heranzuziehen, wurden in der
Einleitung selbst Thomastexte miteinbezogen, die nicht im Textteil ste
hen, so daß das Ganze dadurch noch einmal eine breitere Basis erhält.
Die einzelnen Texte wurden in dem Wissen aufgenommen, daß
nahezu alle Passagen durch andere aus dem Werk des Aquinaten er
setzt werden könnten. Um möglichst viele Themen in den Texten an
sprechen zu können, wurden angesichts des begrenzten Raumes nur
Summa theologiae I, q.2, a.l-a.3 als Beispiel eines vollständigen
Artikelaufbaus, also mit allen Einwänden und deren Auflösungen, auf
genommen, in allen anderen Fällen wurde nur das sogenannte corpus
articuli abgedruckt.
Durch einen sprachlichen Schlüssel soll der Zugang zum Werk des
Aquinaten über die ausgewählten und übersetzten Texte hinaus erleich
tert und einem größeren Kreis von Interessenten ermöglicht werden.
Daß breite Verwendbarkeit und wissenschaftlicher Anspruch nur
schwer vereinbar sind, soll damit nicht bestritten werden. Vielleicht ist
es gelungen, beiden Forderungen gerecht zu werden.
Noch eine letzte Einschränkung ist zu machen. Dieser Band behan
delt mit Absicht im wesentlichen nur die Philosophie des Aquinaten.
10
Philosophie und Theologie zu berücksichtigen, wäre bei dem zur Ver
fügung stehenden Umfang ein aussichtsloses Unterfangen gewesen.
Ohne die Kenntnis seiner Philosophie kann aber die Theologie des
Thomas nicht verstanden werden. Damit war die Frage der Priorität
schon entschieden. Hinzu kommt, daß auch der, der sich, gleich aus
welchen Gründen, mit der Theologie des Thomas nicht befassen möch
te, an den zentralen Fragen seiner Philosophie nicht vorbeigehen kann.
11
Erster Teil
Einführung in das Denken des Thomas von
Aquin
A. Die geistesgeschichtliche Lage: Die Scholastik
des Mittelalters
Wenn es vornehmlich um klassische Latinität, um Stil, Schönheit und 1
Glanz des Sprachkunstwerks ginge, dann müßte man im Ernst fragen,
ob sich eine intensivere Beschäftigung mit Thomas von Aquin lohnte.
Er verfügt weder über die formale Eleganz eines Cicero noch über die
um die Wahrheit ringende Sprachgewalt Augustins. Rhetorik und gro
ße Worte sind nicht seine Sache. Dichterische Bilder und Metaphern,
ausschmückende Adjektive und eindrucksvolle Redewendungen, auf
brechende Emotionen und laute Töne, solches findet sich bei ihm
nicht. Alles Persönliche, Subjektive tritt zurück hinter die Sache, der
sein Denken gilt. Nüchternheit, Funktionalität und Objektivität prägen
seinen Stil. Sprache ist für ihn nie Selbstzweck, kein Satz läßt im Leser
den Verdacht aufkommen, er sei um der schönen Formulierung willen
geschrieben. Ausufernde Redseligkeit gar ist Thomas völlig fremd.
Seine Sprache wird vielmehr von der Strenge des Denkens in den 2
Dienst seines wissenschaftlichen Vorhabens genommen. Präzision und
Knappheit, bis hin zur stereotypen äußeren Form, sind deshalb ihre be
sonderen Kennzeichen, und darin liegt ihre einzigartige Kraft. Ginge es
um Sprache als Kunstwerk sui generis, dann müßte man anderen
Autoren des 12. und 13. Jahrhunderts, insbesondere Bonaventura, den
Vorzug geben. Wenn aber die Einheit von Form und Inhalt, der Rang
des Gedankens und dessen Gewicht und Stellung in der abendländi
schen Geistesgeschichte maßgebend sind, dann kommt Thomas her
ausragende Bedeutung zu.
I. Griechisches und christliches Denken
Um Leistung und Werk des Aquinaten, wenn auch nur in groben Zü- 3
gen, würdigen zu können, muß man den geistesgeschichtlichen Wandel
13
in Erinnerung rufen, der sich im 12. und 13. Jahrhundert vollzog und
den Thomas selbst prägend und entscheidend mitgetragen hat. Dieser
epochale Umbruch muß jedoch seinerseits noch einmal in jenen größe
ren und übergeifenden Zusammenhang gestellt werden, der sich aus
der Begegnung von griechischer Philosophie und jüdisch-christlichem
Glaubenswissen ergibt. Durch diese Synthese werden Probleme aufge
worfen, die für Jahrhunderte Impuls und Dynamik auch des philoso
phischen Denkens ausmachen. Die Gemeinsamkeit gleicher Grund
worte wie Gott, Welt, Seele, Mensch verdeckt leicht die vom Ansatz
her radikale Verschiedenheit dessen, was mit diesen Worten in den bei
den heterogenen Traditionen eines je anderen menschlichen Selbst-
und Weltverständnisses gemeint ist.
4 Für griechisches Denken ist die Welt ein großes Ordnungsgefüge.
Die Frage nach dem Sein, als dem Bleibenden im Gegenüber zum
Werden, steht am Anfang und bleibt bei allen Modifikationen durch
gehend bestimmend. Das Allgemeine als das Beständige hat immer
den Vorrang vor dem Einzelnen, das nur als zu überwindende Durch
gangsphase gesehen werden kann. Dem Einzelnen, Faktischen und
Vergänglichen ist das sinnliche, ästhetische Vernehmen zugeordnet,
während sich der Geist, das noetische Vernehmen, auf das übereinzel
ne, Gültige und Normative, aller Veränderung Entzogene richtet. Diese
Dualität steht am Anfang der griechischen Metaphysik und bestimmt
sie durchgehend. Die Scheidung von Sein und Werden, von Idee und
uneigentlichem Abbild, von allgemeiner Form und konkreter Verwirk
lichung schließt aber zugleich eine wesentliche gegenseitige Verwie-
senheit ein. Das Unbedingte der Idee, des Wesens und des Seins gehört
zu dieser Welt des Werdens und Vergehens, es ist ihr immanent, eben
als das Bleibende, das Tragende und in aller Vergänglichkeit sich
Durchhaltende. Als die Ermöglichung aller Ideen und Wesen ist auch
Gott, von dem Plato ausdrücklich sagt, er sei jenseits allen Wesens und
in dem Aristoteles das in sich ruhende, unbewegt Bewegende sieht, in
sofern alles Werden auf es hinstrebt, doch nur in einer relativen
Transzendenz und Jenseitigkeit. Als der immanente Weltgrund ist die
ser Gott, oder besser gesagt dieses Göttliche, obwohl der Veränder
lichkeit entzogen und insofern transzendent, zutiefst der Welt zugehö
rig. Nicht nur das Einzelne, sondern vor allem auch der einzelne
Mensch, ist in diesem großen Ordnungsgefüge nur ein defizienter
Modus des Allgemeinen, der seinen Sinn nicht in sich selbst trägt.
Alles ist in eine alles umgreifende Kreisbewegung mit hineingenom
men, in der nichts Einzelnes Bestand hat.
5 Gleichgültig, ob in der platonischen Ausprägung mit dem Prinzip
der Idee oder der aristotelischen mit dem Prinzip der Bewegung: In
beiden Fällen liegt ein in sich geschlossenes System vor. Thomas von
14