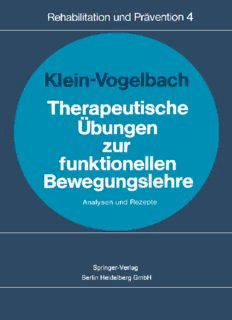Table Of Content4
Rehabilitation und Prävention
Susanne Klein-Vogelbach
Therapeutische
Übungen
zur funktionellen
Bewegungslehre
Analysen und Rezepte
w.
Mit einem Geleitwort von M. Zinn
Mit 172 Abbildungen und einer Ausklapptafel
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg GmbH 1978
Susanne Klein-Vogelbach
Institut rur Physiotherapie
Malzgasse 14, CH-4052 Basel
ISBN 978-3-540-08422-8 ISBN 978-3-662-10457-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-10457-6
Library ofCongress Cataloging in Publication Data. Klein-Vogelbach,
Susanne, 1909. Therapeutische Übungen zur funktionellen Bewegungslehre.
(Rehabilitation und Prävention; 4) Bibliography: p. Inc1udes index. I. Exer
eise therapy. I. Title. RM725.K55 615'.824 77-11142
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von
Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben,
auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Bei Vervielfliltigungen fiir gewerbliche Zwecke ist gemäß § 54 UrhG eine Ver
gütung an den Verlag zu zahlen, deren Höhe mit dem Verlag zu vereinbaren ist.
© by Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1978.
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Y ork 1978
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen
usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht
zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Marken
schutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Herstellung: Triltsch, Würzburg
212113140-543210
Geleitwort
Mit den Analysen und Rezepten fur eine ökonomische
Übungstherapie legt Frau Klein-Vogelbach, die langjährige
Leiterin der Schule fur Physiotherapie des Kantonsspitals Ba
sel, den zweiten Teil ihres Werkes über die von ihr kreierte
funktionelle Bewegungslehre vor. Es handelt sich dabei um
einen von der Autorin in schöpferischer Beobachtung und
selbständiger konsequenter Entwicklungsarbeit geschaffenen
Beitrag, den wir bereits seit langem als elementares, Beobach
tung und Interpretation menschlicher Bewegung beinhalten
des Kapitel der Physio- und Ergotherapie betrachten.
Ohne ausdrückliche Bezugnahme folgt die Arbeit in allen Be
reichen den Erkenntnissen moderner Neurophysiologie und
Biomechanik. Es sei hier nur auf den prophylaktischen und
therapeutischen Wert ökonomischer Haltung und Bewegung,
die Auffassung des Menschen als eines ständig gegen die
Schwerkraft und andere von außen einwirkende Stimuli re
agierenden Wesens, den therapeutischen Gebrauch der Hal
tungsreaktionen und mannigfaltiger anderer Fazilitations
techniken hingewiesen. Die Wiederholung einer Übung oder
einer anderen Leistung des Zentralnervensystems fuhrt nicht
nur zu einer Herabsetzung des Widerstandes an den Synapsen
der von den entsprechenden Erregungspotentialen durchlau
fenen Regelkreise - hier liegt die physiologische Basis allen
Lernens, ohne die es keine Entwicklung gäbe -, sondern ne
ben dem anvisierten speziellen Leistungs- und Kraftgewinn
auch noch zu einer unspezifischen Globalfazilitation. Perzep
tionstraining, Selbsterfahrung und anderweitige Schulung des
Körperbildschemas sind eminent wichtige Kapitel jeder Nor
malisierung und Schmerzlinderung anstrebenden Behandlung
von Störungen im Bereich des Stütz-und Bewegungsappara
tes. Mit der funktionellen Bewegungslehre und den daraus
abgeleiteten Übungen wird daher eine Methode vorgelegt,
welche mit größter Wahrscheinlichkeit auch die in Zukunft zu
ihrer vollen Anerkennung noch notwendigen Tests verglei
chender Therapiestudien mit Kontrollgruppen anders oder
gar nicht behandelter Patienten bestehen wird.
Der vorliegende Band enthält eine Serie von Übungsanlei
tungen fur den Physiotherapeuten, deren Lektüre auch dem
die Bewegungstherapie verordnenden Arzt dringend empfoh-
v
len sei. Wieder ist aus jahrzehntelanger Praxis und Auseinan
dersetzung mit dem Stoff ein sehr knapper, jedoch äußerst
dichter und gehaltvoller Text entstanden, der ein konzentrier
tes Studium verlangt. Die gründliche Verarbeitung gibt jedem
Therapeuten den sofortigen Zugang zu sinnvoller praktischer
Arbeit und später zur selbständigen Entwicklung eines unbe
schränkten, eminent individuell gestaltbaren Übungsrepertoi
res. Besonders hervorgehoben seien die Möglichkeiten der
Physiotherapie der Wirbelsäulen-, Schultergürtel-und Bek
kengürtel-Affektionen, sowie der erste logisch aufgebaute
Versuch der Behandlung der Aerophagie, alles Methoden, de
ren Wert wir bereits in jahrelanger Erfahrung an unserem
großen eigenen Krankengut von Bad Ragaz und Valens bes
tätigen konnten.
Auch wir Rheumatologen haben dringend auf dieses Buch ge
wartet, und wir möchten der Verfasserin nicht nur für ihren
entscheidenden Beitrag zur Physio-und Ergotherapie, son
dern auch für die große zusätzliche Arbeit danken, die sie mit
der Publikation ihres Lebenswerkes im Dienste unserer Pa
tienten aufsich genommen hat. Die Beherrschung der funk
tionellen Bewegungslehre ermöglicht es dem Therapeuten,
die Bedürfnisse seiner Kranken und Behinderten zu erfassen
und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Von dieser
Grundlage aus kann er sich in die verschiedenen Spezialg e
biete - wie propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation, die
Behandlung des entzündlichen Rheumatismus, psychosomati
scher Störungen oder zentraler und peripherer neurologischer
Krankheitsbilder, um nur einige wenige zu nennen - vertie
fen. Er wird damit in die Lage versetzt, der recht großen Ver
suchung der Einseitigkeit bei der Anwendung verschiedener
therapeutischer Methoden zu widerstehen und den Anspruch
an hohe Qualität seiner unentbehrlichen Arbeit zu erfüllen.
Bad Ragaz, im Februar 1978 W.M.ZINN
VI
Vorwort
Ein gesundes Kind lernt im Laufe seiner ersten Lebensjahre
gehen, sprechen und seine Hände gebrauchen. Dazu benötigt
es keinen anderen Lehrer, als eine Umwelt, die ihm erlaubt,
sich entsprechend seiner Anlagen und der bestehenden Sti
muli zu entwickeln und in unendlichen Wiederholungsvor
gängen Ordnung in die empfangenen Botschaften zu bringen.
Will es sich aber besondere Geschicklichkeiten aneignen, wie
z. B. die Beherrschung eines Musikinstrumentes, so braucht es
dazu Fleiß, Ausdauer und wenn möglich einen fähigen Leh
rer. Das allein genügt aber nicht, um etwas Außerordentliches
zu erreichen. Das Potential seiner Begabungen definiert zu
sätzlich seine Grenzen und Möglichkeiten. Es gibt zwar viele
Wege, Talente zu fördern, aber keine, sie zu erzeugen.
Ein Patient, der aus gesundheitlichen Gründen therapeutische
Übungen machen muß, erlebt die Situation, daß er eine kör
perliche Fertigkeit erwerben sollte, zu der er kein Talent be
sitzt. Mit anderen Worten: Auch ein idealer, kooperativer, be
stens motivierter Patient wird, trotz Fleiß und Ausdauer, mit
seinen therapeutischen Übungen höchstens einen "guten
Durchschnitt" erreichen können. Durch die Therapie muß er
eine schmerzliche Erfahrung hinnehmen, die er vielleicht zum
erstenmal bewußt erlebt. Dinge, die einem schwerfallen, weil
man dafür nicht begabt ist, und um die man sich, aus welchen
Gründen auch immer, strebend bemüht, verdienen im Lichte
der vergleichenden Kritik niemals ein besonderes Lob. Das
was einem leicht fällt, das wozu man Talent besitzt, wird be
wundert und erntet oft auch dann noch Lob, wenn dafür kein
besonderer Einsatz geleistet worden ist.
Die Konfrontation mit den eigenen Bewegungsschwierig
keiten im Rahmen der Therapie verlangt vom Patienten, daß
er durch Selbsterfahrung lernt, das Optimum im Bereich sei
ner eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu erlangen. Den
Vergleich mit "den Anderen", die er vielleicht bewundert und
beneidet, muß er ertragen und akzeptieren.
Der Therapeut aber sollte die Leistung des Patienten beur
teilen können. Er kennt das Ausmaß an Anstrengung und Ge
duld, das der Patient permanent aufbringen muß, um die Dif
ferenz zwischen seinem Bewegungsverhalten und dem "guten
Durchschnitt" zu vermindern. Dafür verdient der Patient Lob
VII
und Anerkennung. Der Therapeut ist die Bezugsperson, die
beides spenden soll. Sowohl durch die Freude über die ver
diente Anerkennung als auch durch die unbestechliche Beur
teilung seines Bewegungsverhaltens wird der Patient schneller
vom Wahrnehmen und Lernen angesprochen. Das Wahrneh
men und Verstehen seines Bewegungsverhaltens macht es ihm
leichter, seine Behinderung mit mehr Gelassenheit anzuneh
men. Gelingt diese Selbstmotivation, an seinem Bewegungs
verhalten kontinuierlich weiterzuarbeiten, dann findet der Pa
tient auch den Weg, seine eigene Wirklichkeit ökonomisch zu
planen und zu gestalten und diese mit der ihm eigenen Vitali
tät zu leben.
Das vorliegende Buch "Therapeutische Übungen - Analysen
und Rezepte" ist der Versuch, jahrelang im Umgang mit Pa
tienten erprobte therapeutische Überlegungen in einer Form
"aufzubereiten", die es dem interessierten Therapeuten er
möglicht, damit wie mit einem guten Kochbuch umzugehen.
Durch die Darstellung der Vielfalt von Aspekten rur eine the
rapeutische Übung wird es rur den Therapeuten möglich, eine
solche Übung mit seinem Patienten nachzuvollziehen, sie an
ihn anzupassen und ihm die notwendigen korrigierenden Be
wegungsinstruktionen zu geben. Nur durch eine weitgehende
Differenzierung kann es gelingen, einerseits ein spezielles
funktionelles Problem zu lösen und zugleich den Patienten
nicht nur zum Konsumenten der Therapie, sondern zum krea
tiven Produzenten der therapeutischen Übung zu machen.
Das 1977 in 2. Auflage im Springer-Verlag Berlin-Heidelberg
New York erschienene Buch "Funktionelle Bewegungslehre",
von S. KLEIN-VOGELBACH ist die theoretische Grundlage der
in diesem Buch durchgeruhrten Funktionsanalysen. Es wird
Das vorliegende Werk ist als grundlegendes Lehrbuch zur Ein
fohrung der funktionellen Bewegungslehre in der Physiothera
pie gedacht. Aus diesem Grunde glaubte man, aufa usjUhrliche
Literaturzitate verzichten zu können.
Für Beratung und Mitarbeit danke ich Georg Klein-Vogel
bach, meinem Mann. Allen meinen Schülern der Schule rur
Physiotherapie am Kantonsspital Basel. Gisela Rolf, Verena
Jung, Irmgard Flückiger, Fränzi Hertner.
Ortrud Bronner, Katrin Eicke-Wieser, Lektorinnen.
Vreny Gutzwiller-Lüscher, Beatrix Lütolf-Keller, Margrit
Meier-Waldstein, Darstellerinnen der Übungen.
Dietmar Hund (Kantonsspital Basel), Fetzer (Bad Ragaz),
Fotografien. Holger Hammerich, Grafiken.
Direktion des Kantonsspital Basel, Fortbildungszentrum Her
mitage Bad Ragaz.
Basel, im Februar 1978 SUSANNE KLEIN -VOGELBACH
VIII
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abkürzungen XIII
Allgemeine Einführung 1
1. Die Frösche, funktionelles Bauchmuskeltraining 5
1.1. Das Modell "Der klassische Frosch" 7
1.2. Anpassung des Modells "Der klassische Frosch"
an Kondition und Konstitution 15
l.2.1. Beispiel: "Der U rfrosch" 15
1.2.2. Beispiel: "Anpassung durch Veränderung der Lage der
Körperlängsachse im Raum" 22
2. Die Vierfüßler, funktionelles Rückenmuskeltrai
ning 29
2.1. Das Modell "Der klassische Vierfiißler" 31
2.2. Anpassung des Modells "Der klassische Vierfußler"
an Kondition und Konstitution 38
2.2.1. Beispiel: "Vierfiißler zur Mobilisation der WS in
FLEX/EXT" 39
2.2.2. Beispiel: "Vierfiißler zur Mobilisation der WS in
LATFLEX 42
2.2.3. Beispiel: "Vierfußler zur Stabilisation der proximalen
Extremitätengelenke" 49
2.2.4. Beispiel: "Anpassung durch Veränderung der Lage der
KLA im Raum" 54
3. Funktionelles Rotationstraining um die KLA und um
die Oberschenkellängsachsen 61
3.1. Das Modell "Wer dreht, gewinnt" 61
3.2. Anpassung der Übung "Wer dreht, gewinnt" an
Kondition und Konstitution 69
3.2.1. Beispiel: "T.V.P."= "Der träumende
Verkehrspolizist" 69
3.2.2. Beispiel: "Der Yogi" 74
4. Funktionelles Atemtraining 78
4.1. Das Modell "Die Löwenübung" 81
IX
4.2. Anpassung der "Löwenübung" an Kondition und
Konstitution 86
4.2.1. Beispiel: "Der Schläfer" 86
4.2.2. Beispiel: "Der Pascha" 89
4.3. Das Modell "Die Zeitlupenatmung" 89
4.4. Anpassung der "Zeitlupenatmung" an Kondition und
Konstitution 93
4.4.1. Beispiel: "Rhythmische Atmung" 93
4.4.2. Beispiel: "Doppelhecheln" 94
4.5. Das Modell "Der Luftschlucker" 96
4.5.1. ETAPPEI="DerDarmwind" 96
4.5.2. ETAPPE 11= "Das Rülpsen" 99
4.5.3. ETAPPE III = "Das Verhindern des
Luftschluckens" 101
5. FunktioneUes Training statisch bedingter lumbaler/
thorakaler/zervikaler Syndrome 104
5:1. Das Modell "Hubfreie Mobilisation der
Wirbelsäule" 1 07
5.2. Anpassung des Modells "Hubfreie Mobilisation der
WS" an Kondition und Konstitution 122
5.2.1. Beispiel: "Hubarme Mobilisation der
Wirbelsäule" 122
5.2.2. Beispiel: "Mobilisierende Massage" 128
5.3. Anpassung des Modells an besondere Probleme der
Lendenwirbelsäule 130
5.3.1. Beispiel: "Entlastungsstellungen rur die LWS" 131
5.3.2. Beispiel: "Die Bewegungssegmente rur eine
mobilisierende Massage des L WS-Bereiches" 134
5.3.3. Beispiel: "Hüftgelenk streck' Dich" 135
5.3.4. Beispiel: "Die Zange" 139
5.3.5. Beispiel: "Auf und Zu" 141
5.4. Anpassung des Modells an besondere Probleme der
Brustwirbelsäule 145
5.4.1. Beispiel: "Entlastungsstellungen rur die BWS" 145
5.4.2. Beispiel: "Die Bewegungssegmente rur eine
mobilisierende Massage des BWS-Bereiches" 147
5.4.3. Beispiel: "Im Gleichgewicht" 149
5.4.4. Beispiel: "Der Korkenzieher" 151
5.5. Anpassung des Modells an besondere Probleme der
Halswirbelsäule 154
5.5.1. Beispiel: "Entlastungsstellungen rur die HWS" 155
5.5.2. Beispiel: "Die Bewegungssegmente rur eine
mobilisierende Massage des HWS-Bereiches" 158
5.5.3. Beispiel: "Der Schwindler" 161
5.5.4. Beispiel: "Die Kiefersperre" 164
x