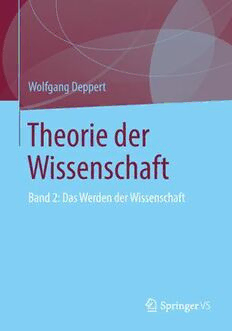Table Of ContentWolfgang Deppert
Theorie der
Wissenschaft
Band 2: Das Werden der Wissenschaft
Theorie der Wissenschaft
Wolfgang Deppert
Theorie der Wissenschaft
Band 2: Das Werden der Wissenschaft
Wolfgang Deppert
Hamburg, Deutschland
ISBN 978-3-658-14042-7 ISBN 978-3-658-14043-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14043-4
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht
ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt
auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen-
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in
diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch
die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des
Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und
Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.
Springer VS ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein
Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany
Inhaltsverzeichnis
0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
0.0 Über das Anfangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
0.1 Zur Lage der Wissenschaft in Deutschland aufgrund
der Verletzung des Grundgesetzes durch
das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
0.2 Vorbemerkungen zum Zustandekommen und
zum Zweck dieser Vorlesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Von den ersten Ursprüngen der Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.0 Vom Schöpferischen, das einen Anfang ermöglicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Von den Existenzerhaltungsfunktionen der Lebewesen . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Warum eine Evolution nur durch Lebewesen mit einem
Überlebenswillen stattfi nden kann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3 Wie der Wille in die Welt kam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4 Die Ausbildung von hierarchisch geordneten Willensformen
und Erkenntnisfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5 Die Evolution des Bewußtseins zur Bildung eines ersten
Weltbildes bis hin zur Ausdifferenzierung des mythischen
Bewußtseins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.6 Mythische Keime für die Grundbegriffe der Wissenschaft . . . . . . . . . . . 42
1.7 Mythische Grundlagen wissenschaftlicher Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.8 Wie das allgemeine Orientierungsproblem durch
den Zerfall des Mythos entstanden ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2 Vom Werden des begriffl ichen Denkens im antiken Griechenland . . . . . . . 75
2.1 Der Orientierungsweg der griechischen Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2 Unser heutiges Denken mit Begriffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
V
VI Inhaltsverzeichnis
2.3 Erste Versuche zur begriffl ichen Erfassung unserer Vorstellungen
vom Bewußtsein und deren Konsequenzen für die Beschreibung
der Entwicklung vom mythischen Bewußtsein zum Individualitäts-
bewußtsein und der damit verbundenen Entwicklung vom
mythischen zum begriffl ichen Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2.4 Die ersten begriffl ichen Formen der milesischen
Naturphilosophen und der Pythagoreer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.5 Die Zusammenführung der ionischen und pythagoreischen
Tradition: Xenophanes aus Kolophon (um –570 bis –474) später
Elea, Heraklit aus Ephesos (–543 bis –482), Parmenides aus Elea
(–530 bis ungefähr –450), Zenon von Elea (–494 bis –444),
Anaxagoras von Klazomenai (–499/495 bis –427) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6 Die empedokleisch-sophistische Tradition: Empedokles von
Akragas (–491 bis –429), Gorgias von Leontinoi (–482 bis –374),
Protagoras von Abdera (–482 bis – 412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.7 Die empedokleisch-atomistische Tradition: Leukippos von Milet,
Elea oder Abdera (um –470 bis um –420) und Demokrit von
Abdera (um –460 bis –380/370). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.8 Das sophistische Denken und das erstmalige begriffl iche Denken
bei Sokrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.8.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.8.1 Zur Bildung von Begriffen durch Sokrates . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.8.2 Zur Ausbildung von Möglichkeitsräumen
im Denken des Sokrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.8.3 Das Individualitätsbewußtsein des Sokrates
und seine Lebensregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.9 Vom Aufkommen eines absolutistischen Erkenntnisstrebens und
von der Ausbildung einer absolutistischen Tradition: Anaxagoras von
Klazomenai (–499/495-/- –427) und Eukleides (~–450-/- –380) . . . . . . . . 132
3 Die wissenschaftlichen Anfänge durch Platon, Aristoteles
und ihre antiken Nachfolger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.1 Platon (–427/26 -/- –347/46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.1.1 Platons Auseinandersetzung mit seinem Lehrer Sokrates . . . . . . 137
3.2 Die Philosophische Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.2.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.2.1 Aristoteles' Kritik an Platons Ideenlehre und die
Entwicklung seiner Erkenntnistheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.2.2 Die direkte und indirekte Schulenbildung des Aristoteles . . . . . . 151
3.2.3 Die erste Grundlegung der Wissenschaften durch
die philosophische Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Inhaltsverzeichnis VII
3.3 Die Verballhornung des Metaphysik-Begriffs in neuerer Zeit
und seine Rehabilitierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.4 Die Darstellung der Wissenschaftsentwicklung durch
objektionale und subjektionale Festsetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.5 Römische Beiträge zur Entstehung der Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.6 Das Fortleben der antiken griechischen und römischen Philosophie
in den Schulen der Philosophischen Familie und der Atomisten . . . . . . . 162
3.6.1 Die sokratische Schule: Die Stoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
3.6.2 Die platonische Schule: Die Akademie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.6.3 Die aristotelische Schule der Peripatetiker . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.6.4 Die atomistisch-epikureische Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4 Die wissenschaftliche Friedhofszeit des frühen Christentums . . . . . . . . . . . 173
4.1 Der Rückfall in ein vorwissenschaftlich-mythisches Bewußtsein . . . . . . 173
4.2 Bemühungen um die Verbindung von Christentum und
griechisch-römischer Philosophie in der Gnosis und ihr
Scheitern in einem schier ausweglosen Streit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.3 Herausragende philosophische Persönlichkeiten wie Plotin,
Porphyrios, Augustinus und Boethius, die sich aus den Streitigkeiten
um das Trinitätsdogma heraushielten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3.1 Plotin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3.2 Porphyrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.3.3 Augustinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
4.3.4 Boethius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
4.4 Der mittelalterliche Universalienstreit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
4.5 Die Auswirkungen der Ergebnisse des Universalienstreits
bis in unsere Zeit verfolgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5 Kulturelles und wissenschaftliches Aufblühen im frühen Islam
als erste Renaissance der griechischen Antike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6 Erste Anläufe zum Werden der Wissenschaft zu Beginn
der europäischen Neuzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.1 Die ersten wissenschaftlichen Gehversuche in Europa:
Die Scholastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.1.1 Zum methodischen Vorgehen der Scholastiker . . . . . . . . . . . . . . 202
6.1.2 Zur inhaltlichen Problemlage in der Scholastik . . . . . . . . . . . . . . 202
6.1.3 Nikolaus von Oresme, Nikolaus von Kues und
Johannes Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
VIII Inhaltsverzeichnis
6.2 Die Entstehung der drei Hauptrichtungen der neuzeitlichen
Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.2.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.2.1 Die ersten Begründungen des Empirismus in der Neuzeit . . . . . . 206
6.2.2 Die frühen Begründungen des neuzeitlichen Rationalismus . . . . 208
6.2.3 Zur Entstehung des neuzeitlichen Operationalismus
bzw. Konstruktivismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
7 Vereinzelte Starts zur neuzeitlichen Wissenschaft durch
die Entwicklung der dazu nötigen Bewußtseinsformen bei
Nikolaus Kopernikus, Giordano Bruno, Galileo Galilei,
Johannes Kepler, René Descartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
7.0 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
7.1 Nikolaus Kopernikus
(19. Februar 1473 in Thorn – 24. Mai 1543 in Frauenburg) . . . . . . . . . . . . 216
7.2 Giordano Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
7.3 Galileo Galilei (15.2.1564–8.1.1642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
7.4 Johannes Kepler
(27.12.1571 in Weil der Stadt–15.11.1630 in Regensburg) . . . . . . . . . . . . . 220
7.5 René Descartes (1596–1650) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
8 Das Werden der Wissenschaft im 15., 16., 17. und 18. Jahrhundert
und der wissenschaftliche Aufschwung vom 19. bis
ins 21. Jahrhundert hinein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
8.0 Einführende Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
8.1 Zu den wichtigsten Pionieren der Wissenschaft
des 17. und 18. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
8.2 Der wissenschaftliche Aufschwung des 19. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . 237
9 Die wissenschaftlichen Revolutionen des 20. Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . . . 245
10 Neuzeitliche Einsichten, in die Beschränktheit menschlicher
Erkenntnis und ihre erkenntnistheoretischen Konsequenzen . . . . . . . . . . . . 247
10.1 Aufkommende Grundlagenskepsis von Hume bis Kant . . . . . . . . . . . . . . 247
10.2 Grundlagensicherung durch die Transzendentalphilosophie
Immanuel Kants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
10.3 Ernsthafte Kritik an Kants Erkenntnissystem
im 20. und 21. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
10.4 Gründe für das Auftreten von wissenschaftlichen Revolutionen,
die aber dennoch wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen . . . . . . . . . 253
Inhaltsverzeichnis IX
11 Der wissenschaftliche Stand im 21. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
12 Das Werden der Wissenschaft in der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
12.2 Die wissenschaftlichen Aufgaben der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
12.3 Schwierigkeiten in der Bewältigung der Aufgaben
der Wissenschaften und deren mögliche Überwindung . . . . . . . . . . . . . . 267
13 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
14 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
14.1 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
14.2 Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Vorbemerkungen 00
0.0 Über das Anfangen
Seit unvordenklichen Zeiten1 kennen die Menschen das Problem des Anfangs; denn jeder
Anfang setzt etwas voraus, das dem Anfang zeitlich vorausgeht und ihn überhaupt erst
ermöglicht. Demnach kann nichts von Null anfangen, es sei denn, man wählt auf einer
Zeitskala willkürlich einen Punkt als Nullpunkt aus, wobei dann allerdings auch Punkte
vor der Null als negative Werte existieren. Wir können heute die Null ganz schlicht als
Anfangspunkt des Zahlenstrahls der natürlichen Zahlen wählen. Das war aber in Europa
vor vierzehnhundert Jahren noch gar nicht denkbar; denn mit den ersten Nullen wurde
erst seit dem 7. Jahrhundert im fernen Osten umgegangen, z. B. auf Sumatra, bis wohin
wohl indische Mönche gelangt sein mögen.2 Für die alten Griechen und für die Römer,
die ihre Weisheiten von den griechischen Philosophen ererbt haben, war es ganz klar, daß
auch nichts aus nichts werden kann: „ex nihilo nihil fi t“, sagten die Römer, und auf Platt
sagen wir noch immer: „Ut nix ward nix“. Also gab es anfänglich auch in der Mathematik
1 Den Ausdruck der „unvordenklichen Zeiten“ übernehme ich gern von meinem verehrten Leh-
rer Kurt Hübner, ohne allerdings zu wissen, ob er diesen Ausdruck erfunden oder auch nur von
einem seiner Lehrer wie etwa Walter Bröcker übernommen hat. Es ist aber durchaus möglich,
daß es eine Ausdruckskreation von ihm ist, zumindest die Ausprägung für die Bezeichnung
von einer sehr fernen Vergangenheitsvorstellung von etwas, von dem sich kein Anfang ange-
ben läßt.
2 Im indogermanischen Sprachraum hat der indische Mathematiker und Astronom
Brahmagupta (598–668) im Jahr 628 in seinem Werk Brahmasphutasidahinta das erste Mal
das Rechnen mit der Null und negativen Zahlen eingeführt, was über islamische Gelehrte wie
etwa von Al-Battani (~860–929) in Europa zusammen mit den indisch-arabischen Zahlzei-
chen eingeführt wurde, die wir bis heute in unserer Mathematik benutzen. Den Islam aus dem
europäischen Kultursystem ausschließen zu wollen (siehe AfD-Parteiprogramm) würde mit-
hin bedeuten, die Zeichen der Arithmetik nicht mehr verwenden zu wollen – welch ein Unsinn!
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019 1
W. Deppert, Theorie der Wissenschaft,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14043-4_1