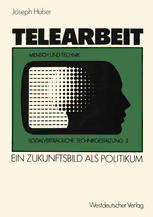Table Of Content]oseph Huber· Telearbeit
Sozialverträgliche Technikgestaltung Band 2
Herausgeber: Der Minister fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Schriftenreihe "Sozialverträgliche Technikgestaltung" veröffentlicht Ergeb
nisse, Erfahrungen und Perspektiven des vom Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen initiierten Programms "Mensch
und Technik - Sozialverträgliche Technikgestaltung" . Dieses Programm ist ein
Bestandteil der "Initiative Zukunftstechnologien" des Landes, die seit 1984 der
Förderung, Erforschung und sozialen Gestaltung von Zukunftstechnologien
dient.
Der technische Wandel im Feld der Mikroelektronik und der modernen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien hat sich weiter beschleunigt. Die öko
nomischen, sozialen und politischen Folgen durchdringen alle Teilbereiche der
Gesellschaft. Neben positiven Entwicklungen zeichnen sich Gefahren ab, etwa
eine wachsende technologische Arbeitslosigkeit und eine sozialunverträgliche
Durchdringung der Gesellschaft mit elektronischen Medien und elektronischer
Informationsverarbeitung. Aber es bestehen Chancen, die Entwicklung zu
steuern. Dazu bedarf es einer breiten öffentlichen Diskussion auf der Grundlage
besserer Kenntnisse über die Problemzusammenhänge und Gestaltungsalter
nativen. Die Interessen aller vom technischen Wandel Betroffenen müssen ange
messen berücksichtigt werden, die technische Entwicklung muß dem Sozial
staatspostulat verpflichtet bleiben. Es geht um sozialverträgliche Technikge
staltung.
Die Schriftenreihe "Sozialverträgliche Technikgestaltung" ist ein Angebot des
Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Erkenntnisse und Einsichten zur
Diskussion zu stellen. Es entspricht der Natur eines Diskussionsforums, daß die
Beiträge die Meinung der Autoren wiedergeben. Sie stimmen nicht unbedingt mit
der Auffassung des Herausgebers überein.
]oseph Huber
Telearbeit
Ein Zukunjisbild als Politikum
Westdeutscher Verlag
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Huber, Joseph:
Telearbeit: e. Zukunftsbild als Politikum/Joseph
Huber. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987.
(Sozialverträgliche Technikgestaltung; Bd. 2)
NE: GT
Alle Rechte vorbehalten
© 1987 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Horst Dieter Bürkle, Darmstadt
Satz: Schreibbüro Ursula Ewert, Braunschweig
ISBN 978-3-531-11849-9 ISBN 978-3-322-94351-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-94351-4
Inhalt
Vorbemerkung und Danksagung ........................ 7
Verzeichnis der Schaubilder ITabellen 9
Wichtige Befunde in Kurzfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
Teil I: Das Konzept der Telearbeit
1. Begriff und konzeptioneller Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
2. Zur Typologie der Telearbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
3. Ausgewählte Fall-Beispiele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
4. Futurologische Szenarios ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
Teil 11: Das Potential der Telearbeit
5. Technologische Voraussetzungen der Telearbeit: Entwickelte
Informations- und Kommunikationstechnologien ........ 39
6. Beruflich-arbeitsorganisatorische Voraussetzungen der Tele
arbeit: Das Potential möglicherweise betroffener Berufe und
Arbeitsplätze .................................... 44
7. Telearbeit und soziale Gruppen ...................... 51
8. Verbreitung der Telearbeit heute - Prognosen und Realität. 54
8.1 USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54
8.2 Europa und die Bundesrepublik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57
9. Motive für Telearbeit in der öffentlichkeit, bei Unterneh-
men und Erwerbstätigen. Erwartete Vor- und Nachteile. . .. 60
9.1 Interessen und Erwartungen in der Öffentlichkeit. . . . . . . . . .. 60
9.2 Interessen und Erwartungen der Unternehmen. . . . . . . . . . . .. 60
9.3 Interessen und Erwartungen der Erwerbstätigen . . . . . . . . . . .. 63
9.4 Interessen und Erwartungen von Arbeitnehmerorganisationen . .. 67
5
Teil III: Die Realität der Telearbeit
10. Telearbeit und Siedlungsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69
11. Büro- und Heimflächennutzung bei Telearbeit ...... . . . .. 74
12. Telearbeit, Verkehr, Energieverbrauch und Luftbelastung .. 81
13. Zu den betriebswirtschaftlichen Kosten der Telearbeit -
billiger oder teurer? ............................... 88
14. Telearbeit und Produktivität ........................ 92
15. Zum rechtlichen Status von Telearbeitenden ... . . . . . . . .. 95
16. Management von Telearbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97
16.1 Personalführung und Kontrolle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97
16.2 Datenschutz .................................. 101
16.3 Organisationstruktur - Zentralisierung versus Dezentralisierung 103
17. Arbeitszeiten bei Telearbeit ......................... 104
18. Arbeitnehmer- bzw. Auftragnehmerfragen .............. 107
18.1 Bezahlung .................................... 107
18.2 Arbeits- und Gesundheitsschutz ..................... , 108
18.3 Erwerbssicherheit, Beförderung, Qualifizierung - neue Selbstän- 109
digkeit oder neue Randständigkeit? ................... 109
19. Arbeitsmarkt und Sozialstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
19.1 Telearbeit und Arbeitsmarkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112
19.2 Telearbeit und soziale Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115
20. Telearbeit und Frauen ............................. 118
21. Telearbeit und zwischenmenschliche Beziehungen in Familie
und Büro ....................................... 124
22. Telearbeit, Individuum und Selbstbestimmung ........... 130
Teil IV: Zur Politik und Zukunft der Telearbeit
23. Präferenzen von Unternehmen und Erwerbstätigen ....... 134
24. Ausblick: Einschätzung der weiteren Entwicklung der Tele-
arbeit .......................................... 136
25. Die Stellung der Verbände zur Telearbeit . . . . . . . . . . . . . .. 141
25.1 Die Gewerkschaften ............................. 141
25.2 Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) ..... 150
25.3 Industrie-und Arbeitgeberverbände . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152
26. Zur Frage des rechtlichen Regelungsbedarfs der Telearbeit . 154
27. Zum Stand der Forschung und weiterem Forschungsbedarf . 157
Literaturverzeichnis 161
Vorbemerkung und Danksagung
Diese Untersuchung verdankt ihre Entstehung in erster Linie dem
Programm "Sozialverträgliche Technikgestaltung" des Ministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung des Landes Nordrhein
Westfalen. Die vorbereitenden mehrjährigen Recherchen und ver
schiedene Forschungsreisen in der Bundesrepublik und den Vereinig
ten Staaten wurden im wesentlichen ermöglicht durch ein Marshall
Memorial Fellowship des German Marshall Fund of the United
States, Washington, sowie durch eine freundliche Zuwendung der
Stiftung Mittlere Technologie, Kaiserslautern, wo besonders Herrn
Karl Werner Kieffer für seine Unterstützung und Zusammenarbeit
gedankt sei.
Außerdem zu danken habe ich für kollegial-unbürokratische Unter
stützung und Zusammenarbeit in der Bundesrepublik und der Schweiz:
Volk er Bahl, DGB Rheinland-Pfalz, Mainz; Angelika Bahl-Benker,
IG Metall, Frankfurt; Elisabeth Becker-Töpfer, Gewerkschaft HBV,
Düsseldorf; Thomas Bernold, Gottlieb-Duttweiler-Institut b. Zürich;
Wolfgang Borsum und Uwe Hoffmeister, Institut für Rechtsinforma
tik, Universität Hannover; Monika Goldmann und Gudrun Richter,
Sozialforschungsstelle Dortmund ; Friedhart Hegner, IIMV Wissen
schaftszentrum Berlin; Dietrich Henckel, Deutsches Institut für Urba
nistik, Berlin; Tilman Hengevoss, Projekt MANTO, ETH Zürich; Beat
Hotz-Hart, Institut für Orts- und Regionalplanung, ETH Zürich;
Carlo Jäger und Lisbeth Bieri, Geographisches Institut, ETH Zürich;
Werner Korte, empirica GmbH, Bonn; Rolf Kreibich und Günter
Feuerstein, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung,
Berlin; Carsten Kreklau und Hermann von Wolff-Metternich, BDI,
Köln; Friedemann Kunst, TU Berlin; Margarete Lehmann, Bibliothek
des Wissenschaftszentrums Berlin; Klaus Theo Schröder, Fraunhofer
Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, Karlsruhe;
Sonja Sentomaschi, Büro der Integrata GmbH Unternehmensbera
tung, Tübingen; Stephan Wawrzinek und Hans-Peter Fröschle, Fraun
hofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation, Stuttgart;
7
in den Vereinigten Staaten: Richard Adler und Robert J ohansen,
Institute for the Future, Menlo Park Ca.; Roy Anderson, Allstate
Insurance Company, Chicago; Gale Carr and Chris Rutkowsky, Ris
ing Star Industries; Torrance, L.A. Ca.; Patrick Conroy, Department
of Transportation/State of Ca., Sacramento; Sally Cornish, Andrew
Lawler und Lane Jennings, World Future Society, Washington; Paul
& Sara Edwards, Association of Electronic Cottagers, Sierra Madre,
L.A. Ca.; Gil Gordon, Management Consulting Services, Monmouth
J unction, N.J.; Marcia Kelly, Electronic Services U nlimi ted, N ew
York; Coralee Kern, National Association of Cottage Industries,
Chicago; Burt N anus und Omar EI Savy, Bridge Hall Business School,
University of Southern California, L.A.; J ames Ogilvy, Stanford Re
search Institute, Ca.; Margarethe Olson, Graduate School of Business
Administration, New York; Joanne Pratt, Allied Professional Educa
tional Services, Dallas; Lenny Siegel, Pacific Studies Center, Moun
tain View, Ca.; Leigh Stamets, California Energy Comission, Sacra
mento; Murray Turoff, New Jersey Institute of Technology, Newark;
Jacques Vuye und Michael Maibach, intel, Santa Cl ara, Ca.; Josh
Wilson und Norris Palmer, Eaglecrest Electronic Cottage, Foresthill,
Ca.
Die Studie wurde im November 1985 abgeschlossen.
8
Verzeichnis der Schaubilder/Tabellen
1. Ein Heimarbeiter im Jahr 1984? ................... 36
2. 40 Ideas for a Computer-based Horne Business ........ 47
3. Some Home-based Business Occupations ............. 49
4. Erwartete Vor- und Nachteile der Telearbeit .......... 62 f.
5. Frauen-Telearbeit zu Hause (Vor- und Nachteile) ...... 65 f.
5a. Frauen-Telearbeit in Nachbarschafts- und Satellitenbüros
(Vor- und Nachteile) ............................ 66 f.
6. Zentralisierungs- und dezentralisierungsfärdernde
Faktoren ..................................... 71
7. Faktoren veränderter Flächeninanspruchnahme ....... 79
8. Relativer Energieverbrauch von Berufspendlern ....... 83
9. Zurückgelegte Fahrzeugmeilen in Kalifornien ......... 86
10. Geschlechtsspezifische Idealtypen von Telearbeit ...... 120
9
Wichtige Befunde in Kurzfassung
Telearbeit bedeutet hier elektronische Fernarbeit im Sinne der Er
werbstätigkeit mithilfe neuer Informations- und Kommunikations
technologien von zu Hause oder von andernorts "dezentral" gelege
nen Arbeitsstätten aus. Beispiele sind Tele-Programmieren oder Text
erfassung per Teletex.
Theoretisch macht Telearbeit organisatorische Dezentralisierung,
räumliche Entballung und zeitliche Flexibilisierung möglich. Ebenso
könnte Telearbeit potentiell eine Lebensweise begünstigen, die mehr
um den privaten Haushalt und das nähere Wohnumfeld kreist. Nicht
zuletzt könnte Telearbeit potentiell auch eine größere Selbständig
keit und Selbstbestimmung der Erwerbstätigen ermöglichen.
Die potentielle Umwandlung von Arbeitsplätzen in Telearbeits
plätze hängt ab zum einen vom Grad der wissenschaftlich-techni
schen Durchdringung der Arbeitswelt, zum anderen davon, ob geeig
nete Endgeräte und Telekommunikations-Infrastrukturen zur Verfü
gung stehen. Das theoretisch mögliche Umwandlungspotential wird
heute im allgemeinen mit maximal um 60 Prozent der Arbeitsplätze
beziffert.
Bisherige Erfahrungen stammen noch überwiegend aus experimen
tellen Pilot- und Modellprojekten. In den Industrieländern gibt es
gegenwärtig insgesamt einige hundert Unternehmen und Verwaltun
gen mit einigen Tausend Telearbeitsplätzen, wobei diese Zahl allmäh
lich fünfstellig weiterwächst. In der Bundesrepublik gibt es allenfalls
ein bis zwei Dutzend Betriebe mit insgesamt kaum mehr als rund
hundert Beteiligten. Diese Zahlen müssen vage bleiben, da solche Pro
jekte aus diversen Gründen häufig nicht öffentlich gemacht werden.
Eine weitere eventuelle Realisierung des Potentials der Telearbeit
hängt u. a. davon ab, ob es sich betriebs- und volkswirtschaftlich rech
net und ob Unternehmen, Vorgesetzte, Beteiligte und ihre Angehöri
gen, Kommunen und Regierungen ein Interesse daran haben.
Der diesbezügliche allgemeine Befund ist eindeutig negativ.
10