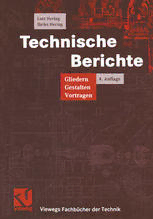Table Of ContentLutz Hering
Heike Hering
Technische Berichte
Aus dem Programm _____________
~
Grundlagen des Studiums
Lehrwerk Roloff/Matek Maschinenelemente
von D. Muhs, H. Wittel, D. Jannasch, M. Becker und J. Voßiek
Lehrwerk Mathematik für Ingenieure und
Naturwissenschaftler
von L. Papula
Das Techniker Handbuch
herausgegeben von A. Böge
Vieweg Taschenlexikon Technik
herausgegeben von A. Böge
Technische Berichte
von L. Hering und H. Hering
Englisch für Maschinenbauer
von A. Jayendran
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
von W. Weißbach
Chemie
herausgegeben von P. Scheipers
Das Vieweg Formel-Lexikon
von P. Kurzweil
vieweg _________________- "
Lutz Hering
Heike Hering
Technische Berichte
Gliedern - Gestalten - Vortragen
4., überarbeitete und erweiterte Auflage
Unter Mitarbeit von Klaus-Geert Heyne
~
Viewegs Fachbücher der Technik vleweg
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Die Nennung von Markennamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen
handels rechtlich als frei anzusehen wären.
1. Auflage 1996
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2000
3., verbesserte Auflage Februar 2002
4., überarbeitete und erweiterte Auflage August 2003
Alle Rechte vorbehalten
© Friedr. Vieweg & Sohn VerlaglGWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2003
Der Vieweg Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.
www.vieweg.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbe
sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
ISBN 978-3-528-33828-2 ISBN 978-3-322-94271-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-94271-5
Vorwort V
Vorwort
Technische Berichte werden i. A. nach Regeln erstellt, die einerseits den DIN-Nonnen
entstammen und andererseits auf Logik und langjähriger Praxis beruhen. Diese Regeln
sind bei vielen in der Berufspraxis stehenden Ingenieuren zu wenig bekannt. Es gibt hier
für zahlreiche Ratgeber allgemeiner Art. Ein Buch, das speziell für die Gestaltung Techni
scher Berichte geschrieben ist und sich dabei auch an verwandte Berufsgruppen wie Na
turwissenschaftler, Infonnatiker usw. wendet, fehlte jedoch bisher auf dem Buchmarkt.
Diese Lücke ist mit dem vorliegenden Buch geschlossen worden.
Die Autoren waren beide langjährig in der Ingenieur- bzw. Technikausbildung an der FH
Hannover tätig. Sie haben viele Lehrveranstaltungen betreut, in denen "Berichte" ge
schrieben werden müssen, und haben alle positiven und negativen Sachverhalte notiert,
die beim Konstruieren, im Labor, in Referaten und bei Diplomarbeiten wiederholt aufge
treten sind. Frau Dr. Hering arbeitet inzwischen bei der TÜV NORD AKADEMIE und
betreut dort E-Learning-Projekte und Diplomarbeiten.
Mitarbeiter ab der zweiten Auflage ist Prof. Dr.-lng. Klaus-Geert Heyne, der das Präsen
tationskapitel erweitert und neu gestaltet hat. Prof. Heyne bringt hier die Erfahrung seiner
Industriezeit, seiner Professorentätigkeit an der FH Wiesbaden und zahlreicher eigener
Rhetorik-und Visualisierungsseminare in Rüsselsheim und Mannheim ein.
Das vorliegende Buch wurde so konzipiert, dass es konsequent Fragen beantwortet und
nicht neue Fragen hervorruft. Damit der Text übersichtlich bleibt, sprechen wir mit Be
griffen wie "Leser", "Schreibende" oder "Studenten" gleichennaßen weibliche und männ
liche Personen an. Das Buch soll dem Studenten und dem in der Praxis stehenden Inge
nieur, Infonnatiker oder Naturwissenschaftler am pe die Fragen beantworten, die bei der
Erstellung von Technischen Berichten und Präsentationen auftreten.
Die bei den Schreibenden auftretenden Fragen betreffen sowohl inhaltliche als auch for
male Aspekte. Solche Fragen treten vom Anfang bis zum Ende während der gesamten
Erarbeitung des Berichtes auf. Deshalb ist das Buch als Leitfaden bzw. Handbuch zur
Erstellung Technischer Berichte konzipiert worden. Es ist nach dem zeitlichen Ablauf bei
der Erstellung Technischer Berichte in die Phasen Planung, Ausarbeitung und Fertigstel
lung gegliedert worden. Eine gründliche Anleitung zur Arbeitstechnik und zur Präsentati
on des Themas runden das Buch ab.
Das Buch hilft dadurch dem Anfänger, der die Infonnationen i. A. chronologisch entspre
chend dem Berichtsfortschritt aufuimmt. Es unterstützt aber auch den versierten Autor,
der gezielt nur bestimmte Stellen verwendet. So bietet das vorliegende Buch durch ver
ständliche Anleitung und viele Beispiele verwertbaren Nutzen filr die Praxis im Techni
schen Schreiben.
In der 4. Auflage wurden die Abschnitte bzw. Kapitel 3.4, 3.5.6, 3.7, 4, 5, 8 und 9 sowie
das gesamte Layout wesentlich überarbeitet und neue Hinweise aus Leserreaktionen ein
gearbeitet. Verlag und Verfasser bitten um Hinweise, wie das Buch in weiteren Auflagen
noch verbessert werden kann. Wir wUrden uns vor allem sehr freuen, wenn sich auch
Studierende zu Wort melden: [email protected] oder [email protected].
Hannover, Juni 2003 Lutz und Heike Hering
VI Inhalt
Inhalt
1 Ausgangssituation ............................................... ................. .................................. ... 1
1.1 Vorkenntnisse zum Gestalten Technischer Berichte ........................................... 1
1.2 Technische Berichte in Studium und Praxis ....................................................... 2
1.3 Hinweise zur Arbeit mit dem vorliegenden Buch ............................................... 3
2 Planen des Technischen Berichts ............................................................................. 5
2.1 Gesamtübersicht über die erforderlichen Arbeitsschritte ........... ......... ................ 5
2.2 Entgegennahme und Analyse des Auftrags ......................................................... 6
2.3 Prüfung bzw. Erarbeitung des Titels .................................................................. 8
2.4 Die Gliederung als "roter Faden" ..................................................................... 11
2.4.1 Allgemeines zu Gliederung und Inhaltsverzeichnis ............................... 12
2.4.2 Vorschriften und Regeln fiir die Gliederung ......................................... 12
2.4.3 Sprachlogische und formale Gestaltung von Dokumentteil-Nummem
und Dokumentteil-Überschriften ........................................................... 14
2.4.4 Zweckmäßige Vorgehensweise zur Erstellung von Gliederungen ......... 17
2.4.5 Datei-und Papierorganisation fiir die Gliederung ................................. 21
2.4.6 Muster-Gliederungen fUr Technische Berichte ..................................... 21
2.5 Der "Style Guide" sichert einheitliche Formulierung und Gestaltung ............. 26
3 Formulieren, Schreiben und Erstellen des Technischen Berichts ....................... 28
3.1 Bestandteile des Technischen Berichts und ihre Gestaltung ............................. 29
3.1.1 Titelblatt ................................................................................................ 30
3.1.2 Gliederung mit Seitenzahlen = Inhaltsverzeichnis ................................ 36
3.1.3 Text mit Bildern, Tabellen und Literaturzitaten .................................... 42
3.1.4 Literaturverzeichnis ............................................................................... 44
3.1.5 Sonstige vorgeschriebene oder zweckmäßige Teile .............................. 45
3.2 Sammeln und Ordnen des Stoffes ..................................................................... 50
3.3 Erstellung guter Tabellen ................................................................................. 51
3.3.1 Tabellengestaltung ................................................................................ 52
3.3.2 Tabellennummerierung und Tabellenüberschriften ............................... 56
3.3.3 Der Morphologische Kasten - eine besondere Tabelle ......................... 58
3.3.4 Hinweise zu Bewertungstabellen ........................................................... 64
3.4 Das Bild zum Text ............................................................................................ 66
3.4.1 Informationswirksame Gestaltung vo~ Bildern ..................................... 69
3.4.2 Bildnummerierung und Bildunterschriften ............................................ 72
3.4.3 Foto und Fotokopie sowie gescannte Bilder ......................................... 76
Inhalt VII
3.4.4 Der Einsatz von GrafIk-und CAD-Programmen ................................... 79
3.4.5 Schema und Diagramm ......................................................................... 85
3.4.6 Skizzen zur vereinfachten Darstellung und zur Berechnung ................. 93
3.4.7 Perspektivische Darstellungen .............................................................. 95
3.4.8 Technische Zeichnung und Stückliste ................................................... 97
3.5 Das Zitieren von Literatur .... ....... ....... ....... ........ ............................................. 101
3.5.1 Einleitende Bemerkungen zum Zitieren von Literatur ..... ...... ........ ..... 101
3.5.2 Gründe filr Literaturzitate . ....... ........ ......................... ........................... 102
3.5.3 BibliografIsche Angaben nach DIN 1505 ........................................... 103
3.5.4 Kennzeichnung von Zitaten im Text ................................................... 103
3.5.5 Das Literaturverzeichnis - Inhalt und Form ........................................ 109
3.5.6 Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz ............................................... 120
3.6 Der Text des Technischen Berichts ................................................................ 123
3.6.1 Allgemeine Stilhinweise ...................................................................... 123
3.6.2 Stilmerkmale des Technischen Berichts .............................................. 124
3.6.3 Verständliche Formulierung von Technischen Berichten .................... 126
3.6.4 Formeln und Berechnungen ................................................................ 131
3.6.5 HäufIge Fehler in Technischen Berichten ........................................... 134
3.7 Der Einsatz von Textverarbeitungs-Systemen ................................................ 140
3.7.1 Dokument -bzw. Seitenlayout und Hinweise zum Editieren ............... 141
3.7.2 TypografIsche Festlegungen aus der DIN 5008 .................................. 151
3.7.3 Hinweise zu Texthervorhebungen ....................................................... 155
3.7.4 Papierorganisation ....... ........ ..... ..... ..... ................. ....... ......... ...... ... ... .... 157
3.7.5 Disketten-und Festplattenorganisation ............................................... 159
3.7.6 Automatisches Erzeugen von Verzeichnissen, Beschriftungen und
Querverweisen mit Word .................................................................... 162
3.7.7 Vorbereitung des Technischen Berichts filr die Publikation in einem
Datennetz ............................................... ..... ........................................ 168
3.8 Die Fertigstellung des Technischen Berichts .................................................. 170
3.8.1 Die Berichts-Checkliste sichert Qualität und Vollständigkeit ............. 170
3.8.2 Korrekturlesen und Korrekturzeichen nach D IN 16 511 ..................... 172
3.8.3 Endausdruck, Erstellung der Kopieroriginale und Endcheck .............. 178
3.8.4 Kopieren, Binden oder Heften und Verteilen des
Technischen Berichts .......................................................................... 181
4 Zweckmäßige Verhaltensweisen bei der Erstellung des
Technischen Berichts ............................................................................................. 189
4.1 Zusammenarbeit mit dem Betreuer ................................................................ 190
4.2 Zusammenarbeit im Team ............................................................................. 191
4.3 Hinweise filr die Bibliotheksarbeit ................................................................ 192
4.4 Persönliche Arbeitstechnik ............................................................................ 193
VIII Inhalt
5 Das Präsentieren des Technischen Berichtes ..................................................... 196
5.1 Einfiihrung ...................................................................................................... 196
5.1.1 Zielbereiche Studium und Beruf ......................................................... 197
5.1.2 Worum geht es? .................................................................................. 197
5.1.3 Was nützt mir das? .............................................................................. 198
5.1.4 Wie gehe ich vor? ............................................................................... 199
5.2 Warum überhaupt Vorträge? .......................................................................... 199
5.2.1 Defmitionen ........................................................................................ 200
5.2.2 Vortragsziele und Vortragsarten ......................................................... 200
5.2.3 "Risiken und Nebenwirkungen" von Präsentationen und Vorträgen ... 202
5.3 Vortragsplanung ............................................................................................. 203
5.3.1 Erforderliche Arbeitsschritte und ihr Zeitbedarf ................................. 203
5.3.2 Schritt 1: Rahmenklärung und Zielbestimmung .................................. 205
5.3.3 Schritt 2: Materialbeschaffung ............................................................ 209
5.3.4 Schritt 3: Die kreative Phase ............................................................... 210
5.4 Vortragsausarbeitung ...................................................................................... 216
5.4.1 Schritt 4: Verdichtung und Feinauswahl ............................................. 216
5.4.2 Schritt 5: Visualisierung und Manuskript ............................................ 218
5.4.3 Schritt 6: Probevortrag und Änderungen ............................................. 233
5.4.4 Schritt 7: Aktualisierung und Vorbereitungen vor Ort ........................ 234
5.4.5 Schritt 8: Vortrag, Präsentation ........................................................... 235
5.5 Vortragsdurchfiihrung .................................................................................... 235
5.5.1 Kontaktvorlaufund Kontaktaufnahme ................................................ 236
5.5.2 Beziehungsebene herstellen ................................................................ 237
5.5.3 Richtiges Zeigen .................................................................................. 238
5.5.4 Umgehen mit Zwischenfragen ............................................................. 238
5.6 Vortragsbewertung und -auswertung .............................................................. 239
6 Zusammenfassung und Ausblick ......................................................................... 242
7 Literatur ................................................................................................................ 243
8 Anhang ................................................................................................................... 247
8.1 Bilderverzeichnis ............................................................................................ 247
8.2 Tabellenverzeichnis ........................................................................................ 249
8.3 Checklistenverzeichnis ................................................................................... 250
9 Glossar - Fachbegriffe der Drucktechnik ........................................................... 251
10 Sachwortverzeichnis (Index) ................................................................................ 256
1 Ausgangssituation
1 Ausgangssituation
Im Freizeitbereich und auch im Arbeitsleben findet zwischen verschiedenen Menschen
Kommunikation statt. Dies kann mündliche oder schriftliche Kommunikation sein. Gehö
ren die Objekte oder Sachverhalte zum Bereich "Technik", dann wird dies technische
Kommunikation genannt. Ist sie schriftlich, dann handelt es sich um "Technische Berich
te". Ist sie mündlich, dann wird der Technische Bericht als "Report" beim Chef bzw. als
Vortrag, Referat oder Präsentation vor einer Gruppe von Zuhörern dargeboten.
Das vorliegende Buch wendet sich in erster Linie an technisch vorgebildete bzw. in der
Technik tätige Leser. Dies sind hauptsächlich Ingenieurstudenten, Ingenieure und Techni
ker. Auch andere Berufsgruppen wie Naturwissenschaftler, Informatiker usw. werden dem
Buch nützliche Hinweise entnehmen können.
In der Industrie müssen heute Technische Berichte von Sachbearbeitern geschrieben wer
den, die früher von Gruppen- oder Abteilungsleitern erarbeitet wurden. Hier wird der
technische und naturwissenschaftliche Nachwuchs mit einer Anforderung konfrontiert, tUr
die er i. d. R. nicht ausgebildet wurde. Das vorliegende Buch ist deshalb durchgehend so
konzipiert worden, dass die Leser sich im Selbststudium die Kenntnisse aneignen können,
die sie zum Schreiben und Vortragen von Technischen Berichten benötigen.
Bei allen Nutzergruppen des vorliegenden Buches sind in der Regel erste Erfahrungen mit
den Problemen bei der Erstellung Technischer Berichte vorhanden. Daran anknüpfend
werden eintUhrend erst einmal häufige Mängel in Technischen Berichten näher betrachtet.
Die nachfolgend angesprochenen Mängel können übrigens auch in Berichten ganz ande
rer Wissensgebiete auftreten, wie z. B. in den Wirtschafts-, Rechts- und Geisteswissen
schaften, der Medizin usw.
1.1 Vorkenntnisse zum Gestalten Technischer Berichte
Die Vorkenntnisse zum Gestalten Technischer Berichte sind sehr vielfliltig. Hier sollen
nur einige Punkte angetUhrt werden, um erst einmal ein "Problembewusstsein" zu erzeu
gen. Es beginnt bereits mit dem "In die Hand Nehmen" eines schriftlichen Berichtes. Ist
er sauber geheftet? Ist ein neuer Hefter oder Ordner verwendet worden? Gibt es ein aus
sagefahiges Titelblatt? Bei der inhaltlichen Prüfung tritt die Frage auf: Gibt der Titel aus
reichende und sachgerechte Information über den Inhalt des Technischen Berichts?
Beim weiteren Durchsehen können u. a. folgende Fragen auftreten. Ist ein Inhaltsver
zeichnis vorhanden? Hat es auch Seitenzahlen? Sind die Abschnitte nach DIN 1421
nummeriert? Ist das Inhaltsverzeichnis logisch gegliedert bzw. ist der " rote Faden" er
kennbar? Ist die Ausgangssituation verständlich formuliert? Hat sich der Ersteller am
Ende des Berichts kritisch mit der AufgabensteIlung auseinander gesetzt? Sind literatur
quellen angegeben? Existiert ein Literaturverzeichnis usw.?
Die Erfahrung zeigt, dass die Fähigkeit zur sachgerechten und zielgruppenorientierten
Abfassung Technischer Berichte bei fertig ausgebildeten Ingenieuren und Technikern oft
L. Hering et al., Technische Berichte
© Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003
2 1 Ausgangssituation
noch nicht ausreichend entwickelt ist. In den allgemein bildenden Schulen aller Schular
ten - von der Hauptschule bis zum Gymnasium - wird in der Regel auf flüssiges, stili
stisch schönes Schreiben deutlich mehr Wert gelegt als auf die Präzision im sprachlichen
Ausdruck. Obwohl Referate fiir die Schule oft auf dem zu Hause vorhandenen pe erstellt
werden, gibt es in der Schule zu wenige Hinweise zur Typografie.
Dieses Ausbildungsdefizit bleibt üblicherweise auch an der Hochschule bestehen. Die
knappe Betreuungskapazität wird meist auf fachliche Fragen konzentriert und nicht so
sehr fiir das Abfassen der Berichte verwendet. Dabei muss jeder Ingenieurstudent sowohl
an der Uni als auch an der FH während seines Studiums etwa 10 bis 15 größere schriftli
che Arbeiten erstellen, wofiir heute praktisch ausschließlich Textverarbeitungs-Systeme -
meistens Microsoft Word - verwendet werden. Dies können Studienarbeiten sowie La
bor-, Konstruktions- und Projektierungsberichte sein. Aber auch Praktikums- bzw. Pra
xissemesterberichte sowie die Diplomarbeit am Ende des Studiums gehören zu diesen
schriftlichen Arbeiten. Genügend "Lernstoft" ist also vorhanden.
Es stellt sich aber auch die Frage nach der Unterstützung der Studenten beim Schreiben
Technischer Berichte durch "schreibkundige" wissenschaftliche Mitarbeiter. Dabei kön
nen signifikante Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Universitäten festgestellt
werden. Im Universitätsbereich tritt - mindestens im Hauptstudium während der vorge
schriebenen Studienarbeiten bzw. Entwürfe - eine nennenswerte Unterstützung durch die
Assistenten der Institute auf. Da diese im Zusammenhang mit der meist beabsichtigten
Promotion häufig Veröffentlichungen fiir Fachzeitschriften schreiben, sind ihnen die
geltenden Regeln weitgehend bekannt. Diese Kenntnisse werden dann an die Studenten
im Rahmen der Betreuung weitergegeben. Auch Hilfsassistenten ("Hilfswissenschaftier"),
die in promotionsrelevanten Forschungsprojekten eingesetzt sind, werden vom Doktoran
den angehalten, die Arbeitsergebnisse in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln zu
erstellen, damit möglichst wenig Nacharbeit beim Veröffentlichen der Ergebnisse bzw.
beim Zusammenschreiben der Dissertation auftritt.
Die Situation in der Ingenieurausbildung an Fachhochschulen ist völlig anders. Hier fin
det - ähnlich wie an den Universitäten - keine systematische Ausbildung im "Techni
schen Schreiben" statt. Aber auch die Betreuung und Wissensweitergabe von den Assi
stenten an die Studenten findet faktisch nicht statt, weil die Assistenten an Fachhoch
schulen i. d. R. nicht promovieren.
Zusammengefasst stellt sich die Situation so dar: Weder an Universitäten, noch an Fach
hochschulen ist eine systematische Ausbildung im "Technischen Schreiben" vorhanden.
Insofern kann es nicht überraschen, wenn die von Studenten und vielfach auch von Mitar
beitern in der Industrie erstellten Technischen Berichte noch starke Verbesserungsmög
lichkeiten aufweisen. Das vorliegende Buch ermöglicht deshalb, die vielfach nicht vor
handene Ausbildung im "Technischen Schreiben" wenigstens teilweise zu kompensieren.
1.2 Technische Berichte in Studium und Praxis
Die ISO 5966 "Documentation - Presentation of scientific and technical reports" defi
niert, dass ein wissenschaftlicher oder ein Technischer Bericht einen Forschungsprozess
oder Forschungsergebnisse oder den Stand der Technik zu einem wissenschaftlichen oder