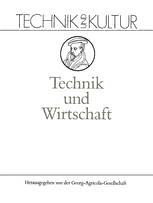Table Of ContentTECHNIK UND KULTUR
in 10 Banden und einem Registerband
Band I Technik und Philo sophie
Band II Technik und Religion
Band III Technik und Wissenschaft
Band IV Technik und Medizin
Band V Technik und Bildung
Band VI Technik und Natur
Band VII Technik und Kunst
Band VIII Technik und Wirtschaft
Band IX Technik und Staat
Band X Technik und Gesellschaft
1m Auftrage der Georg-Agricola-Gesellschaft
herausgegeben von
Armin Hermann (Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats)
und
Wilhelm Dettmering (Vorsitzender der Gesellschaft)
Gesamtredaktion: Charlotte Schonbeck
TECHNIK
UND
WIRTSCHAFT
Herausgegeben von Ulrich Wengenroth
VDI VERLAG
IV
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Technik und Kultur : in 10 Banden und einem Registerband /
im Auftr. der Georg-Agricola-Gesellschaft hrsg. von Armin
Hermann und Wilhelm Dettmering. - Dusseldorf: VDI-Verl.
Teilw. hrsg. von Wilhelm Dettmering und Armin Hermann
ISBN-13: 978-3-642-95795-6 e-ISBN-13: 978-3-642-95794-9
DOl: 10.1007/978-3-642-95794-9
NE: Hermann, Armin [Hrsg.]; Dettmering, Wilhelm [Hrsg.]
Bd. 8. Technik und Wirtschaft - 1993
Technik und Wirtschaft / hrsg. von Ulrich Wengenroth [1m
Auftr. der Georg-Agricola-Gesellschaft]. - Dusseldorf: VDI
VerI., 1993
(Technik und Kultur ; Bd. 8)
ISBN-13: 978-3-642-95795-6
NE: Wengenroth, Ulrich [Hrsg.]
Gedruckt mit Unterstutzung des Forderungs-und Beihilfefonds Wissenschaft der VG Wort
Bildredaktion: Margot Klemm
Fotoarbeiten: Werner Kissel u. a.
© VDI-Verlag GmbH, Dusseldorf 1993
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1993
Aile Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollstandi
gen photomechanischen Wiedergabe (Photokopie, Mikrokopie) und das der Ubersetzung,
vorbehalten.
Satz: Konrad Triltsch GmbH, Wurzburg
ISBN-13: 978-3-642-95795-6
v
Zum Gesamtwerk
"Technik und Kultur"
Wir diirften die Vertreibung aus dem Paradies nicht als einen Verlust
beklagen: im "Ausschlagen des Paradieses", so meinten Georg Agri
cola und Paracelsus, eroffne sich dem Menschen vielmehr ein "neues,
seligeres Paradies", das er sich selbst auf der Erde schaffen konne durch
seine "Kunst". Mit "Kunst" war alles vom Menschen kiinstlich Herge
stellte gemeint, wie die "Windkunst" (oder Windmiihle), die "Wasser
kunst" und die "Stangenkunst", also auch das, was wir heute mit
"Technik" bezeichnen.
Die Gestaltung der Natur galt im 16. und 17. Jahrhundert als ein dem
Menschen von Gott erteilter Auft rag : Wir miissen versuchen, schrieb
Rene Descartes 1637, die "Kraft und die Wirkung des Feuers und des
Windes" und iiberhaupt aller uns umgebenden Korper zu verstehen;
dann wiirde es moglich, aIle diese Naturkrafte fUr un sere Zwecke zu
benutzen: "So konnten wir Menschen uns zu Herren und Besitzern der
Natur machen."
Diese Visionen schienen sich am Ende des 19. Jahrhunderts tatsach
lich zu erfUllen. Bezwungen wurden die groBen GeiBeln der Mensch
heit, die Cholera, die Pest und die anderen Seuchen, die einst in
wcnigcn Tagcn Hundcrttausendc hingerafft hatten. Die Ernteertrage
stiegen, und nur noch die ganz Alten erinnerten sich an die schreck
lichen Hungersnote, die zum Alltage des Menschen gehort hat ten wie
Sonne und Regen. Mit dem Beginn des neuenJahrhunderts wurde auch
ein Anfang gemacht mit der Befreiung des Menschen von der Fron in
den Fabriken. Ohne daB die Arbeiter hatten angestrengter schaffen
miissen und ohne Verminderung der Produktion gelang es, die Arbeits
zeit herabzusetzen.
Die religiose Motivierung des technischen Schaffens war im
19. J ahrhundert verlorengegangen; die allgemeine Sakularisierung
hatte auch die Arbeitswelt erfaBt. Was blieb, war der Glaube an den
ununterbrochenen, durch Wissenschaft und Technik herbeigefUhrten
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. "Man glaubte an
diesen Fortschritt schon mehr als an die Bibel", hat Stefan Zweig in
seinen Lebenserinnerungen geschrieben, "und sein Evangelium schien
unumstoBlich bewiesen durch die taglich neuen Wunder der Wissen
schaft und der Technik."
VI ZUM GESAMTWERK "TECHNIK UND KULTUR"
Ein gutes Beispiel fur diese Fortschrittsglaubigkeit gibt uns Werner
von Siemens. Bei der Versammlung der Deutschen Naturforscher und
Arzte 1886 in Berlin sprach Siemens vor 2700 Tagungsteilnehmern von
der ihnen allen gemeinsamen Dberzeugung, "daB unsere Forschungs
und Erfindungstatigkeit" die Lebensnot der Menschen und ihr Siech
tum mindern, "ihren LebensgenuB erhohen, sie besser, gliicklicher und
mit ihrem Geschick zufriedener machen wird".
Es war eine Illusion zu glauben, daB die Macht, die uns die Technik
verleiht, die Menschheit notwendigerweise, das heiBt von selbst und
ohne unser Zutun, auf eine "hohere Stufe des Daseins" erheben werde.
Vielmehr miissen wir alle unsere Anstrengungen daraufkonzentrieren,
daB die uns durch die Technik zugewachsene MachtfUlle nicht miB
braucht wird, sondern daB sie tatsachlich die gesamte Menschheit - und
nicht nur privilegierte Teile - auf die apostrophierte "hohere Stufe des
Daseins" erhebt. Hier liegt die groBte politische Aufgabe, die uns am
Ende des 20. Jahrhunderts gestellt ist.
Wie sollen wir es halten mit der Technik? Bei fast jedem gesell
schaftspolitischen Problem - und so auch hier - gibt es ein breites
Spektrum von Meinungen. Das eine Extrem ist die blinde Technik
glaubigkeit, wie sie vor allem im fin de siec1e geherrscht hatte, und wie
sie vereinzelt auch heute noch vorkommen mag. Das andere Extrem
ist die unreflektierte Technikfeindlichkeit.
Schon Georg Agricola hat sich mit der Meinung auseinandersetzen
miissen, daB der Mensch ganz die Finger lassen solIe von der Technik.
In seinem Werk "De re metallica" (1556) nimmt Agricola gleich auf
den ersten Seiten Stellung zur Kritik, die sich gegen die Verwendung
der Metalle und iiberhaupt jede technischen Betatigung wendet:
"Wenn die Metalle aus dem Gebrauch der Menschen verschwinden,
so wird damit jede Moglichkeit genommen, sowohl die Gesundheit zu
schiitzen und zu erhalten als auch ein unserer Kultur entsprechendes
Leben zu fUhren. Denn wenn die Metalle nicht waren, so wiirden die
Menschen das abscheulichste und elendeste Leben unter wilden Tieren
fUhren; sie wiirden zu den Eicheln und dem Waldobst zuriickkehren,
wiirden Krauter und Wurzeln herausziehen und essen, wiirden mit den
NagelnHohlen graben, in denen sie nachts lagen, wiirden tagsiiber in den
Waldern und Feldern nach der Sitte der wilden Tiere umherschweifen."
Mit Agricola sind wir der Meinung, daB ein menschenwiirdiges
Leben ohne Technik eine Illusion ist. Der Mensch kann der Technik so
wenig entfliehen, wie er der Politik entfliehen kann.
Bleiben wir bei diesem Vergleich: In den zwanziger und dreiBiger
Jahren wollten viele Menschen in Deutschland mit Politik nichts zu tun
ZUM GESAMTWERK "TECHNIK UND KULTUR" VII
haben. Die Konsequenz war, daB die Entscheidungen von anderen und
in durchaus unerwunschter Weise getroffen wurden. Diesen Fehler
durfen wir heute mit der Technik nicht wiederholen: Wir mussen uns
mit ihr entschlossen auseinandersetzen und mit entscheiden, wclche
Technik und wieviel wir haben wollen und worauf wir uns besser nicht
einlassen.
Zur funktionierenden Demokratie gehort das Engagement und die
politische Bildung der Burger. Genauso gehort zur modernen Welt ein
Verstandnis fUr die Rolle der Technik.
Genau darum geht es:
Einen verstcindigeren Gebrauch zu machen von der Technik.
Wir wissen alle noch viel zu wenig von der Bedeutung der Technik
fUr unsere Gesellschaft und unser Denken. Tatsachlich spielte bei der
Entwicklung der Menschheitskultur die Technik von Anfang an eine
entscheidende Rolle, weshalb auch der franzosische Philosoph und
Nobelpreistrager Henri Bergson den Begriffd es "homo faber" gepragt
hat. Fur Bergson begrundet die Fahigkeit, sich machtige Werkzeuge
fUr die Gestaltung der Welt schaffen zu konnen, das eigentliche Wesen
des Menschen.
Da nun uberall die Auseinandersetzung urn die Technik voll ent
brannt ist - und neb en klugen Vorschlagen auch viele torichte und
gefahrliche zu horen sind -, fUhlt sich die Georg-Agricola-Gesellschaft
aufgerufen, den ihr gemaBen Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten.
Zu Beginn der Neuzeit hat sich Georg Agricola, unser Namenspatron,
Gedanken uber den sinnvollen Gebrauch der Technik gemacht. Mehr
als vierhundertJahre spater, zu "Ende der Neuzeit", wie manche sagen,
stellt sich die Georg-Agricola-Gesellschaft die Aufgabe, eine Bestands
aufnahme vorzulegen, welche Rolle die Technik bisher in der Entwick
lung der Menschheit gespielt hat.
Dabei solI es zwar auch urn die auf der Hand liegende wirtschaftliche
Bedeutung der Technik gehen und naturlich urn die Spannung von
Natur und Technik, aber ebenfalls urn die weniger bekannten Aspekte.
Dazu gehort etwa die zu Beginn dieses Vorwortes angesprochene
ursprungliche religiose Motivierung des technischen Schaffens oder
auch die Rolle, die der Technik in den verschiedenen Ideologien zuge
wiesen wird. Weitere Beispiele sind die Veranderung der "Bedingun
gen des Menschseins", etwa durch die modernen Kommunikationsmit-
VIII ZUM GESAMTWERK "TECHNIK UND KULTUR"
tel, und die Veranderungen der Gesellschaftsstruktur. Dazu gehort
etwa das Entstehen des" vierten Standes" durch die industrielle Revolu
tion und der sozusagen umgekehrte ProzeB, der sich heute vor unseren
Augen vollzieht: das Verschwinden des Unterschiedes zwischen dem
Arbeiter und dem Angestellten.
Wie laBt sich ein derart komplexes Thema sinnvoll gliedern? Ein
Vorbild haben wir in den 1868 ausgearbeiteten "Weltgeschichtlichen
Betrachtungen" von Jacob Burckhardt gefunden. Dem Basler Histori
ker ging es seinerzeit urn die Entwicklung von Staat, Religion und
Kultur. Nach einer kurzen Betrachtung tiber Staat, Religion und Kul
tur behandelt Burckhardt nacheinander die "sechs Bedingtheiten", das
heiBt den EinfluB des Staates auf die Kultur und umgekehrt der Kultur
auf den Staat und so fort.
Dieses anspruchsvolle Programm hat Burckhardt vermoge seiner
umfassenden Bildung bewaltigen konnen. Einen Nachfolger aber wird
er wohl kaum £lnden, der aufarbeitet, wie sich das Verhaltnis von
Staat und Kultur von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute gestal
tet hat. Inzwischen sind viele neue Staatsformen entstanden (und
einige zum Gltick wieder verschwunden). Auf dem Gebiete der Kultur
hat es tiefgreifende Aufspaltungen gegeben, wobei man nur an das
Schlagwort von den "zwei Kulturen" zu denken braucht. Mit einer
pauschalen Behandlung der "Kultur" ist es heute also nicht mehr
getan.
Selbst der Unterbereich "Wissenschaft" ist, was zum Beispiel die
"Bedingtheit durch den Staat" betrifft, in ganz unterschiedliche Sekto
ren zu gliedern. Hatte der Staat dereinst, im Deutschland der Dichter
und Denker, Philosophie, klassische Philologie und die Altertumswis
senschaften bevorzugt gefordert, so stand urn 1850 die Chemie in der
Sonne der staatlichen Gunst und urn 1950 die Physik. Ganz offensicht
lich konnte heute kein einzelner Historiker mehr das Burckhardtsche
Pragramm bewaltigen.
Einen Teil dieser graBen Aufgabe hat sich nun die Georg-Agricola
Gesellschaft vorgenommen, und zwar den Teil, der sich auf die Tech
nik bezieht. Untersucht werden zehn "gegenseitige Bedingtheiten":
(I) Technik und Philosophie, (II) Technik und Religion, (III) Technik
und Wissenschaft, (IV) Technik und Medizin, (V) Technik und Bil
dung, (VI) Technik und Natur, (VII) Technik und Kunst, (VIII) Tech
nik und Wirtschaft, (IX) Technik und Staat, (X) Technik und Gesell
schaft.
Diese zehn Themenbande und ein Registerband bilden das Ge
samtwerk. Jeder Band ist einzeln fUr sich verstandlich; seinen besonde-
ZUM GESAMTWERK "TECHNIK UND KULTUR" IX
ren Wert freilich erhalt er erst durch die Vernetzung mit den iibrigen
Themen.
Ehe wir nun die Bande nacheinander vorstellen, noch eine ab
schlieBende Bemerkung zum Gesamttitel. Das Gesamtwerk haben wir
"Technik und Kultur" genannt, weil es zwar nicht ausschlieBlich, aber
doch in der Hauptsache darum geht, die engen Beziehungen und
vieWiltigen Verschrankungen zu zeigen, in denen die Technik zu allen
Bereichen der menschlichen Kultur steht. Wer sich auf diese Weise mit
der Technik beschaftigt, dem wird wohl deutlich, daB bei allem MiB
brauch, die vielen von uns die Technik suspekt gemacht hat, diese einen
integrierenden Teil unserer Kultur darstellt.
Das Generalthema des vorliegenden Werkes ist die Beziehung zwi
schen Technik und Kultur. Damit ist bereits stillschweigend eine be
stimmte Grenze gezogen: Es kommen hier nur diejenigen Aspekte der
Technik zur Sprache, die in einem Zusammenhang mit der Kultur
stehen. So sind spezielle ingenieurwissenschaftliche Fragen und im
engeren Sinn technikhistorische Gesichtspunkte ebenso ausgeschlossen
wie ins Einzelne gehende psychologische oder soziologische Fragestel
lungen.
Das vordringliche Anliegen dieser Reihe - zu einem tieferen und
umfassenderen Verstandnis des Phanomens Technik in Gesellschaft und
Kultur beizutragen -laBt sich nur verwirklichen, wenn sich die Leitge
danken des Gesamtwerkes auch in der inneren Architektur der einzel
nen Bande widerspiegeln: die wechselseitigen Beziehungen und engen
Verschrankungen zwischen der Technik und anderen Kulturbereichen
sollen in ihrer Entwicklung nachgezeichnet und in ihren systematischen
Zusammenhangen bis zur Darstellung der gegenwartigen Situation
herangefuhrt werden. - U m eine Auswahl aus der Vielfalt der wechsel
seitigen Einfliisse zu gewinnen, wird in allen Banden immer wieder
folgenden Fragen nachgegangen:
Welche technischen Ideen, Erfindungen und Verfahren haben zu
einer grundsatzlichen Anderung in der Denkweise und den Methoden
anderer Kulturbereiche gefUhrt? - Man denke dabei nur an die revolu
tionierende Wirkung des Buchdrucks auf das Bildungswesen, an die
Fortschritte der Medizin durch die Erfindung des Mikroskops und die
tiefgreifenden Einfliisse von Radio und Fernsehen auf das Verhalten der
Menschen.
Welche theoretischen Vorstellungen, Strukturbedingungen oder
drangenden Lebensprobleme gaben den AnstoB fUr technisches For
schen, Erfinden und Konstruieren? - Hierher gehort die Vielfalt techni
scher Losungen fur bestimmte wirtschaftliche oder politische Aufgaben.
x
ZUM GESAMTWERK "TECHNIK UND KULTUR"
Die verschiedenen Themenkreise und ihre Aufeinanderfolge in
den einzelnen Banden sind so ausgewahlt, daB charakteristische We
sensztige und tibergreifende Strukturen der Technik sichtbar werden.
Die gegenwartige Diskussion tiber die Technik ist zwar oft emotio
nal und irrational bestimmt, aber sie beruht nicht nur auf Eindrticken
und GefUhlen. Sob aid dabei Argumente ins Feld gefUhrt werden,
interpretiert man Tatsachen und appelliert an die verntinftige Einsicht.
In dieser Situation ist die Philosophie gefordert. Sie ist namlich zustan
dig, wenn es darum geht, Begriffe zu klaren und grundsatzliche theore
tische Zusammenhange der Technik aufzuzeigen. Am Anfang des
Gesamtwerkes steht daher der Band
TECHNIK UND PHILOSOPHIE (Band I)
Dieser Eingangsband beginnt mit der Erorterung des Technikbegrif
fes. Es folgen Ausfuhrungen zur Bewertung der Technik in der Ge
schichte der Philosophie, Untersuchungen zum technischen Problem
losen und zur instrumentellen Verfahrensweise sowie Darlegungen
zum geschichtlichen Wertwandel, Oberlegungen zu den drangenden
Fragen der Verantwortung fur den technischen Fortschritt und zur
moglichen Abschatzung der Technikfolgen. Die Diskussion tiber die
Ambivalenz der Technik, tiber ihre weltweit kulturgeschichtlichen
Auswirkungen, tiber ihre erhofften und realisierten Leistungen und
auch ihre Gefahren schlieBen diesen Band abo
Die moderne Technik in der Form, wie wir sie heute kennen, ist nicht
denkbar ohne zwei Elemente, durch die die europaische Tradition
entscheidend gepragt wurde: das Christent um und die Entstehung der
modernen Naturwissenschaften in der Renaissance. So werden in dem
Band
TECHNIK UND RELIGION (Band II)
in einem weitgespannten historischen Zusammenhang die wechselsei
tigen Beziehungen zwischen technischem Wandel und religiosen Vor
stellungen untersucht. U m fUr die Beitrage dieses Bandes eine ge
meinsame Ausgangsbasis zu finden, werden in dem Eingangsartikel
die Begriffe Religion, Theologie und Kirche gegeneinander abge
grenzt.
Die folgenden Kapitel des Religionsbandes behandeln den allgemei
nen Zusammenhang zwischen der technischen Entwicklung und den
groBen auBerchristlichen Religionen und den christlichen Kirchen bis
hin zur Gegenwart. Oberlegungen zu esoterischen Stromungen der